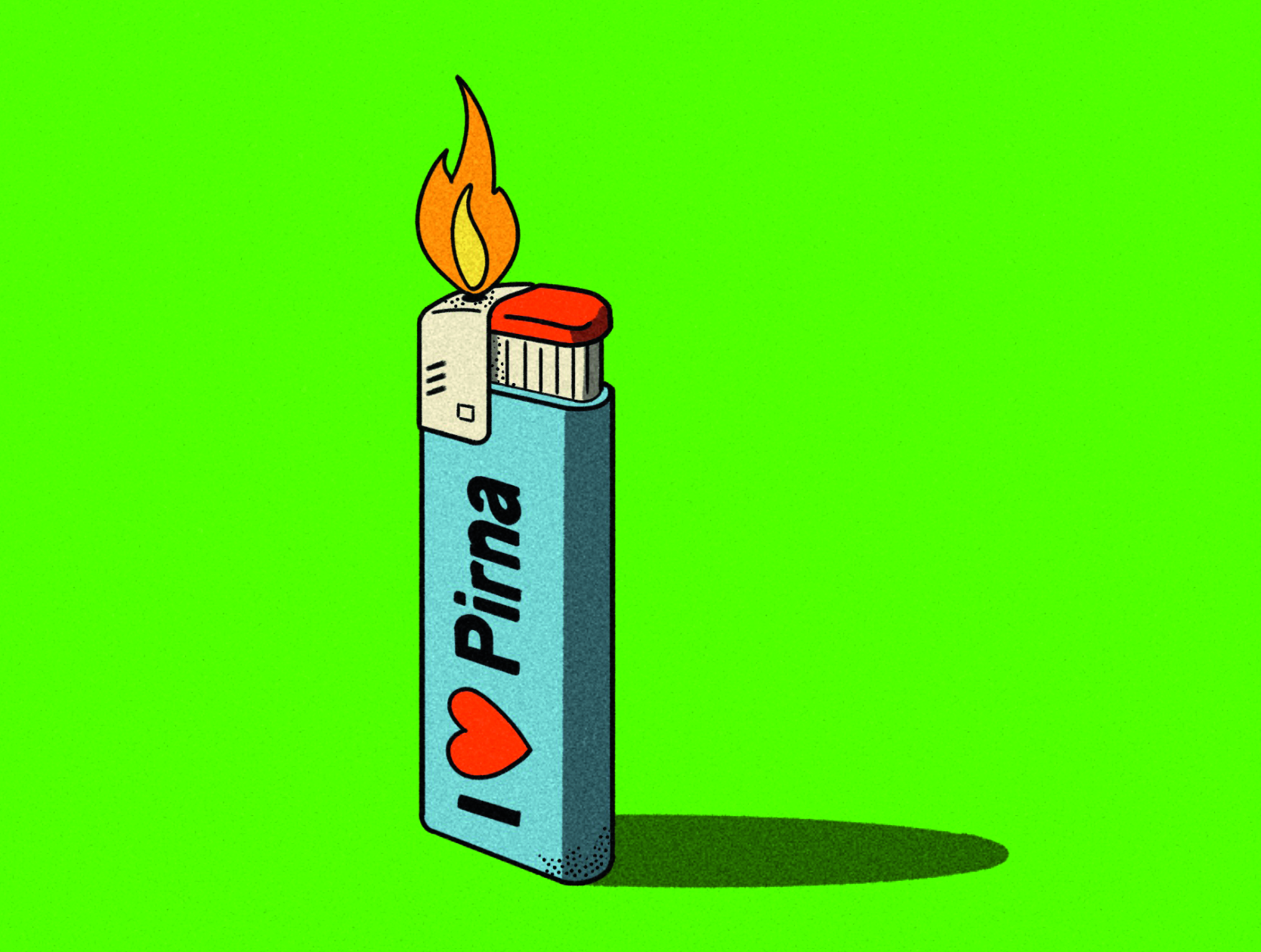Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen: Die Suche nach dem Ost-Gefühl
Eine Generation von Nachwendekindern sucht nach ihrer Ost-Identität und schaut mit Grauen auf die Wahlprognosen

Ich komme aus Sachsen-Anhalt, weiß aber erst seit ein paar Jahren, dass ich „aus dem Osten“ komme. Ich wurde nach der Wende geboren. Das war aber lange Zeit gar kein Thema für mich. Es gab kein Ost-Gefühl oder sowas.
Seit ein paar Jahren aber ist es für mich aber überall präsent. Selbst wenn ich so wie jetzt gerade mit Mathilda im Urlaub in der Toskana bin. Sie zeigt mir ein Video einer Künstlerin namens „tumvlt“ auf Instagram, die gerade eine Torte herstellt, die unter anderem aus Toastbrot, Eiern und eben Bautzener Senf besteht – das Signature-Product aus dem Osten. Außerdem in tumvlts-Feed: eine ganze Video-Reihe mit dem Titel „Wir kochen gut“, bei dem sie lauter lustige DDR-Party-Rezepte aus dem gleichnamigen DDR-Kochbuch im Stil eines Food- und Tutorial Blog mit unterlegter trashiger Musik präsentiert.
„Ich finde das mega witzig“, sagt Mathilda, während wir tumvlt zuschauen, wie sie das Rezept „als Apfel verkleidetes Ei“ präsentiert. Ein Ei in Mayonnaise getunkt und mit Paprikapulver rot gefärbt. Überhaupt bestehen die meisten Gerichte aus Mayonnaise und Gelatine und heißen „Würstchenmax“ oder „Lustige Salatschüssel“.
Ahnenforschung
Mathilda wurde 1999 in Konstanz geboren, ich 1997 in Wernigerode im Harz. Seitdem wir zusammen sind, reden wir auch immer wieder über die Teilung, die wir beide nicht erlebt haben. Das Buch „Wir kochen gut“ kenne ich daher, weil es das Kochbuch war, das in jedem DDR-Haushalt stand, und Mathilda kennt es daher, weil meine Oma es ihr zu Weihnachten geschenkt hat, nachdem sie das in einer Neuauflage im Buchladen gefunden hat.
Ich scrolle mich weiter durch den Instagram-Feed. Bei einer Insta-Fragerunde, sagt tumvlt selbstbewusst, dass sie aus Sachsen kommt, und hält ein Feuerzeug hoch, auf dem „I ♥ Pirna“ steht. Sie hat. so wie ich, die DDR und die Teilung nicht miterlebt. Trotzdem scheinen diese Zeit und der Osten für sie eine Rolle zu spielen.
Genau wie für mich. Seit ich für ein Buch die Geschichte meines Urgroßonkels Willi Sitte, einem der einflussreichsten Künstler der DDR und ZK-Mitglied der SED, recherchiert habe, habe ich anfangen, mich mit meiner Familiengeschichte zu beschäftigen und so überhaupt erst ein Gefühl zu dem aufgebaut, was man „den Osten“ nennt. Vorher hat der für mich gar keine Rolle gespielt. Jetzt ist er aber extrem präsent. Jetzt herrscht da so ein diffuses Gefühl, das sich immer wieder stark äußert. Aber woher rührt dieses Ost-Gefühl, und wo führt es hin? Und es gibt in meiner Generation, der Gen-Z, viele, die aus dem Osten kommen, denen es ähnlich geht, die sich fragen, was dieses nicht mehr existierende Land mit ihnen zu tun hat.
Den Osten konservieren
Nach dem Italien-Urlaub verabrede ich mich mit tumvlt, die eigentlich Olivia heißt, in ihrem Wohnort Dresden. Seit 2015 lebt sie hier. Sie ist 1996 in Sachsen geboren und in einem Dorf bei Pirna aufgewachsen. Am Bahnhof Dresden-Neustadt begrüßt Olivia mich mit einer Umarmung und einem selbst zusammengestellten Dresden-Goodie-Bag. Darin enthalten: Sticker mit Bildern ihres Instagram-Avatars, das Erfrischungsgetränk „Kolle-Mate“, auf dem der antifaschistische Ruf „alerta alerta“ steht, und eine nach DDR-Rezept gebackene Eierschecke, die mich nach einem Bissen sofort in meine Kindheit zurückversetzt. Super.
Wir laufen durch Neustadt. Ein Typ mit Sonnenbrille, in Shorts und Hose grüßt uns. „Hallo“, sagt Olivia so höflich, wie man alte Nachbarn oder im Osten eigentlich jeden begrüßt, der an einem vorbeiläuft. Der Typ ist inzwischen außer Reichweite. „Das war Steffen Israel!“, sagt Olivia schnell. „Der Gitarrist von Kraftklub!“
„Kennt ihr euch?“
„Eigentlich nicht!“
Olivia hat auf Instagram 19.000 Follower. Der größte Teil kommt aus dem Osten. Viele schreiben, dass sie das „Wir kochen gut“-Buch auch haben – oft von ihrer Oma geschenkt. Olivia interessiert sich schon länger für die Alltagskultur der DDR. „Irgendwie habe ich so oft das Gefühl, ich müsste die Dinge aus der DDR konservieren. Meine ganze Ost-Beschäftigung hat angefangen, weil ich vieles lange nicht verstanden habe, bis ich gemerkt habe, dass das nicht mit meiner Kindheit zu tun hat, sondern mit etwas Größerem“, sagt sie, als wir in einem Café Platz nehmen.
Herkunftsscham
Das tiefere Nachdenken über ihre Ost-Prägung begann für Olivia erst zur Zeit der Corona-Pandemie. Sie ist mit Freund:innen in einem Lesekreis, und eines Tages schlägt einer von ihnen vor, das Buch „Ostbewusstsein“ von Valeria Schönian zu lesen. Die Autorin wurde 1990 in Sachsen-Anhalt geboren. Das Buch erzählt, wie Nachwendekinder über den Osten nachdenken. Ich habe es vor einem Jahr geschenkt bekommen und gelesen. „Seit einigen Jahren ist etwas anders geworden. Ostdeutschland ist heute ein drängendes Thema“, heißt es da relativ am Anfang. „Nicht nur für mich, sondern für die ganze Republik. Und ich glaube, es wird mehr und mehr zu einem für meine Generation.“
Olivia erzähle ich, dass ich das Buch erst vor einem Jahr gelesen habe. „Ich hatte da so ein Awakening, kind of, wo ich so dachte: krass“, sagt sie. Sie finde sich in so vielen Sachen wieder, die da drinstehen. „So viele Erfahrungen gleichen sich bei uns, die ich vorher nie so richtig gecheckt habe vorher“, erzählt sie konzentriert. Davor hat sie einen ziemlichen Überdruss verspürt, wenn es um das ganze Ost-Thema ging. Als sie 2015 nach Dresden gezogen ist, war die Stadt seit zwei Jahren schon für jeden als PEGIDA-Stadt bekannt. „Das hat mich hat damals so übel getroffen und schockiert, aber diese rechten Strukturen, die kannte ich ja schon, aus meinem Dorf“, sagt sie.
Die ewige AfD
Während Olivia erzählt, erinnere ich mich daran, wie ich vor kurzem mit Mathilda bei ihr in der Küche saß und wir in einem Zeitungsartikel darüber lasen, dass die Partei, die laut der aktuellen Trendstudie „Jugend in Deutschland“ am meisten Zuspruch unter allen 14- bis 24-Jährigen bekommt, mit 22 Prozent die AfD ist. „Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das vor der AfD war“, hatte sie zu mir gesagt. Und mir fiel ein, dass fast in jedem Gespräch, das ich bisher mit Nachwendekindern geführt habe, irgendwann die Jahreszahlen 2015 und 2016 gefallen sind. Als der Wahlkampf losging in Sachsen-Anhalt. Die AfD zum ersten Mal zweistellige Ergebnisse in Deutschland bekam.
Ein Jahr davor gründete sich in meiner Heimatstadt eine Facebookgruppe „Nein zum Heim“, obwohl dort nie geplant war, ein Asylbewerber:innenheim zu errichten. Die Initiative stand trotzdem, es fand eine Bürger:innensprechstunde in meiner Schule statt, bei der plötzlich Eltern von Mitschüler:innen, ausgerastet sind und vor lauter Hass gegen den nicht vor Überfremdung warnenden Bürgermeister der Stadt schrien.
„Solche Sachen haben mich auch genervt, und ich habe mich geschämt. Wobei, das ist vielleicht zu viel gesagt. Aber ich hatte jetzt nicht so Bock drauf. Wenn mich andere angesprochen haben, dass ich aus Dresden komme, war mir das eher peinlich“, sagt Olivia. „Und bei meinen Eltern ist das vermutlich ähnlich.“ Sie lacht. „Als ich meinem Vater erzählt habe, dass ich mich jetzt mit dem Osten beschäftige, meinte er sowas wie ,What the fuck – was willst du damit?‘ und hat mir erst einmal einen Vortrag gehalten, dass wir jetzt wiedervereint sind und dass das kein Thema mehr ist heutzutage“
Die Ostfluencerin
Meine Eltern haben mir in meiner Kindheit und Jugend auch kein Bild vom Osten vermittelt. Die Wende lernte ich erst später als eine Zeit kennen, die für viele Ostdeutsche mit Schwierigkeiten und Umorientierung, Arbeitslosigkeit und immer Orientierungssuche verbunden war. Lange war sie einfach nur das Allergrößte, was passieren konnte. Weil es sich für meine Eltern, die damals 18 waren und gerade ihr Abitur gemacht hatten, vermutlich tatsächlich so angefühlt hat. Ich habe das nie hinterfragt. In der Schule wurde das Thema schnell abgehakt: Einparteiendiktatur, Stasi, Mauerbau, Mauerfall, Wiedervereinigung – fertig.
Als Olivia an der Kunsthochschule Dresden studierte, war sie hauptsächlich von westdeutschen Kunststudierenden umgeben, die sich immer über Dresden aufgeregt haben. „Davon war ich einfach irgendwann genervt“, sagt sie jetzt. Ein Freund aus Dortmund hat mal gefragt, ob sie eigentlich in Dresden bleiben würde. Sie hat gesagt, dass es für sie schwierig wäre, zu gehen, weil sie dann das Gefühl hätte, etwas zurückzulassen.
Die Idee, Ostdeutschland in ihre Kunst einfließen zu lassen, kam erst danach. In einem Sommer postete sie ein Video: ostdeutsche Vita – Sommerimpressionen aus Sachsen, in denen unter anderem auch in einem Schrebergarten eine Sachsen-Fahne hängt und ein Dynamo-Dresden-Fan-Auto mit lauter Krimskrams zu sehen ist. „Für mich war das so eine lustige Prolligkeit, oder ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll“, sagt sie. Das Video ging viral. Seitdem nennt sie sich „Ostfluencerin“.
„Ich würde sagen, als Ostfluencerin setze ich mich damit auseinander, was meine ostdeutsche Nachwende-Identität geprägt hat und ausmacht und teile mit meinem Content meine Sicht auf den Osten, und beziehe mich auch auf DDR-Kultur und andere identitätsstiftende Dinge wie halt etwa Bautzner Senf als Kult-Ostprodukt, das viele ja auch genau aus dem Grund abfeiern. Der Effekt ist, was mir viele schreiben, dass der Osten für sie dadurch ,positiver besetzt wird‘, und ich denke es fördert, dass Leute sich mehr mit dem Osten auseinandersetzen – unabhängig ob das Teil ihrer eigenen Identität ist oder nicht.“
Keine Verklärung
Manchmal hat sie Sorge, dass dieses Spiel mit dem Ost-Gefühl falsche Leute anlocken und unerwünschte politische Diskusräume schaffen könnte. Um Rechte fern zu halten, schreibt sie in ihre Instagram-Bio, dass ihr Account ein „Zeckenaccount“ ist. Außerdem studiert sie die Vergangenheit, um nicht Gefahr zu laufen, die DDR-Diktatur zu verklären. Erst vor Kurzem hat sie das Stasigefängnis Bautzen II besucht. „Einfach, um mir ein weiteres Bild zu machen, was alles zur DDR und zum Osten gehört“, bekräftigt sie.
Ich erinnere mich, wie ich einmal, mit einem Reality-TV-Star und Modedesigner, der Enkel eines führenden SED-Funktionärs war, der maßgeblich an der Propaganda für den Mauerbau beteiligt war, einen lustigen Tag verbracht habe, und danach den Drang verspürte, mir die Gedenkstätte Hohenschönhausen, das Stasi-Gefängnis, anzuschauen. Die Spuren der Diktatur sind neben Alltag und Individualgeschichten Fußnoten unserer Generation. Nicht jeder liest sie.
„Was mir aber seit einiger Zeit passiert, dass ich mich richtig freue, wenn ich Leute aus dem Osten treffe, um mich auszutauschen“, sage ich. „Geht mir auch so“, sagt Olivia fröhlich und erzählt, wie Leute aus dem Osten mit ihr ihre Erfahrungen teilen. Andererseits wolle sie kein Account sein, der in so eine Ostalgie-Ecke abrutscht. „Ich find‘s schon cool, so über den Osten und so universelle Erfahrungen zu sprechen“, sagt sie, als wir Richtung Bahnhof gehen. „Ostsachen sind nicht nur so Erinnerungen von früher, sondern auch ein anderer Diskurs!“ Sie erzählt, dass sie nach dem Kunstdiplom ein zweites Studium der Sozialen Arbeit begonnen hat und gerade Interviews mit Leuten führt, die nach der Wende ihre Arbeit verloren haben. „Ich weiß nur manchmal nicht, ob das an meinem Studieninteresse vorbeigeht, weil es ja vor allem mich so sehr interessiert.“
Nachwendekinder
Ein paar Tage später bin ich mit Jerome und Janek unterwegs. Jerome ist einer meiner engsten Freunde, 24 Jahre alt, und kommt aus Troisdorf bei Köln. Janek ist 20 Jahre älter, mein Mitbewohner und kommt, wie ich, ursprünglich aus dem Harz, wo er gerade eine Reportage dreht. Wir helfen ihm dabei. Am letzten Morgen steht der Abschlussdreh beim örtlichen Pfingstfeuer-Volksfest an. Jerome erzählt mir irritiert davon, wie er am Abend zuvor draußen rauchen war und so ein ganz dumpfes Geknatter und Gegröle aus dem Wald wahrgenommen hatte. „Ich habe erst überhaupt nicht gecheckt, was das war, und dann fuhr da so eine Gruppe auf Mopeds vorbei, die ,OST-OST-OSTDEUTSCHLAND‘ gebrüllt hat.“
Ich weiß sofort, worum es geht. Simson Mopeds. Das Einheits-Modell in der DDR. Jeder im Osten ist irgendwie mit einer Simson aufgewachsen. Als ich mal im Harz wandern war, habe ich einen Jungen in einem Dorf gefragt, wie ich zur alten innerdeutschen Grenze komme. Er nahm mich dann auf so einer Simson mit und hat mir einen ganzen geschichtlichen Abriss über die Region und die DDR gegeben. Ich habe ihn dann gefragt, woher er das alles wisse. Er strich über den Lenker seiner Simson und sagte: „Na ja, man will ja wissen, wo die Teile herkommen.“
Olivia hat mir erzählt, dass sie ihre Wohnung mit DDR-Möbeln ausgestattet hat. Das passte irgendwie zu meinem Ost-Gefühl und meiner Beschäftigung mit der Frage, was diese Zeit noch mit uns „Nachwendekindern“ zu tun hat.
Überall Nazis?
Janek, 1980 in Wernigerode geboren, hat die Wende als 9-Jähriger erlebt. Wir haben in unserer Wohnung schon oft darüber gesprochen: Er habe an diese Zeit überhaupt keine Erinnerungen mehr, und wenn ich versuche zu bekräftigen, dass das Thema für junge Leute eine Rolle spielt, fragt er, ob ich jetzt wirklich von mir auf andere schließen wollen würde? Ob ich wirklich glaube, dass alle diesen Drang verspüren? Natürlich nicht alle. Aber ich fragte mich, was diese Abwehr zu bedeuten hatte. Gerade bei Leuten, die doch auch aus dem Osten kommen.
Vielleicht reden wir aneinander vorbei. Als wir zurück nach Berlin fahren, weist Jerome auf die die vielen AfD-Plakate hin, die hier kurz vor den Kommunalwahlen überall hängen, und ich erzähle von einer Reportage über die 90er-Jahre, die ich kürzlich geschrieben habe, in der es darum geht, wie viele Neonazis in Janeks und meiner Heimatregion herumgestiefelt sind. „Dann muss ich wohl in einer liberalen Enklave gelebt haben“, unterbricht Janek mich und lächelte. „Als schwuler Junge im Oberharz, der nie Probleme hatte, dessen ganze Klasse hinter mir stand.“
„Seltsam wie abwehrend Janek ist“, sagt Jerome später verwundert auf dem Autobahnrasthof, und erzählt mir davon, wie er ihn auf die ganzen FCK Antifa und wenigen „FCK AfD“-Tags an den Hauswänden angesprochen hat. Es ist kompliziert.
In der Ferne so nah
Mir fiel Sophia ein, Mathildas erste ostdeutsche Freundin. Sie kommt aus Pirna, und über sie kannte Mathilda Olivias Instagram-Account. Sophia ist nach Lissabon ausgewandert, und ich wollte von ihr wissen, ob sie ihre Heimat in Portugal mit sich trägt und ob „das mit dem Osten“ dort für sie eine Rolle spielt.
Sie antwortete per Sprachnachricht, dass sie erst dort den Drang verspürt habe, mit ganz vielen Leuten dort über den Osten und die DDR zu sprechen. Dass aber viele der vornehmlich westdeutsch sozialisierten Deutschen mit ihrem Geburtsort nichts anfangen können, nicht mal Dresden kennen, so dass sie sich irgendwo in Berlin verorten, muss im Gespräch. „Und sorry, ich komme nicht aus fucking Berlin.“ Und wenn es um Dresden gehe, fühle sie sich schnell schuldig.
„Und weißt du, es fehlt mir so, es fehlt mir so, mit Ostdeutschen zu reden. Ich hatte hier eine Freundin, die jetzt nicht mehr hier wohnt, aus dem Osten. Wir haben die gleichen Grundbedingungen gehabt, und das fehlt mir mit den Mädels hier so. Weil ich denke mir: Wir haben eine gleiche Zukunft, eine gleiche Gegenwart, aber nicht die gleiche Vergangenheit.“
Ja, es ist schwer mit Leuten über die eigene Herkunft zu sprechen, die nicht mal wissen, wo Magdeburg liegt und auf deren innerer Landkarte der Osten einfach nur rechts vom Westen liegt. Ein bisschen verstehe ich Janeks Abwehrhaltung.
Von der Magdeburger Börde nach Bonn
Am nächsten Tag fahre ich nach Bonn. Und fairerweise muss ich gestehen, dass ich so gut wie nichts über die alte Bundeshauptstadt weiß und sich das auch auf dieser Recherche nicht ändern wird. Ich bin hier mit Julian verabredet. Er und ich kennen uns, weil wir beide auf Poetry Slams auftreten, und ich habe mich erinnert, dass er vor Kurzem einen Text performt hat, in dem er über das Leben in Sachsen-Anhalt gesprochen hat. Er wurde, wie ich, 1997 geboren.
Mein Zug hat Verspätung, aber das macht bei Julian gar nichts, denn er hat nach dem Abi und kurzem Versuch eines Jurastudiums eine Ausbildung als Lokführer gemacht und weiß, wo und wann und warum ich zu spät am Bahnhof eintreffen werde. Jetzt studiert er hier Schauspiel und Wirtschaft. „Herzlich willkommen in der Bundesstadt ohne nennenswerte Nachbedeutung“, sagt er zur Begrüßung im breitesten Magdeburger-Börde-Dialekt, und als ich unsicher bin, ob ich lachen darf oder soll, fügt er schnell hinzu. „Das sagen die Einheimischen hier.“
Julian wurde eigentlich in Goslar, im niedersächsischen Westharz geboren. Seine Eltern sind beide aus Magdeburg, und seit er ein Kleinkind war, ist er dort aufgewachsen. Als sich seine Eltern trennten, zog sein Vater aufs Dorf in die Magdeburger Börde. Seitdem trägt er sowohl den Westen als auch den Osten, das Dorf und die Stadt in sich. Er erzählt mir das alles, während wir auf durch die Altstadt spazieren.
Stadt vs. Land
„Im Dorf hatte ich Freunde, mit denen hätte ich im städtischen Kontext nie etwas zu tun gehabt“, sagt er. „Weil man die einfach nicht getroffen hätte, wenn man sich in seiner Bubble bewegt.“ Einige von ihnen seien inzwischen nach rechts abgedriftet, das sei schon schlimm. Seine Magdeburger Freunde fragen ihn, wieso er mit denen überhaupt noch abhängen würde. Aber Julian ist halt mit ihnen aufgewachsen.
Er erzählt von Frust auf den Nahverkehr in Sachsen-Anhalt, dass die meisten Sekundarschulen dort nicht die Perspektive bieten, mal ein Auslandsjahr oder sonstige Weltoffenheitsförderungen zu betreiben und von immer mehr Frust, „Irgendwann ist aber bei mir auch die Grenze, da rede ich dann nicht mehr weiter“, sagt er. „Aber wenn jemand sagt, dass er die AfD wählt, würde ich nicht sofort das Gespräch abbrechen.“
Das wäre derzeit auch schwierig, weil man dann gut ein Drittel der Bevölkerung nicht ansprechen könnte, denke ich bitter. Wir gehen in die nächste Kneipe und bestellen Bier. „Ich glaube, dass es gerade bezogen auf dein Ostbewusstsein einen Riesen-Unterschied macht, ob du in der Stadt oder auf dem Land groß wirst“, sagt Julian. Auch er trägt das in sich. Während er Abitur macht, seine Wege und die seiner Freunde sich eigentlich in Magdeburg schon trennen, die Leute in andere Unistädte fahren, zieht es ihn immer wieder auf das Dorf. In Bonn fährt er neben dem Studium Eisenbahn. Er genießt beides. Die Abende mit Bahnfahrern, die Schnitzelbrötchen in den Pausenräumen, die Deep Talks mit Kommiliton:innen, das Bühnenleben.
Das sei wie damals in seiner Jugend. „Mit den Leuten auf dem Dorf habe ich gerne zusammengesessen und gesoffen, weil ich einfach richtig schön banal sein konnte“, sagt er. Er spielt Trinkspiele und baut mit einem Freund einen Trabi zusammen. Seine Beziehung zum Osten entwickelt sich aber nicht wie bei mir und Olivia durch Gegenstände aus der DDR, sondern durch Erzählungen: über Gemeinschaftsgefühl, über die Zeit der Teilung.
DDR-Quiz-Champions
Nach dem Bier spielen wir ein DDR-Quiz, das ich mitgebracht habe. Die Multiple-Choice-Antworten auf den Spielkarten brauchen wir meist nicht. „Ein Broiler ist ein … “, beginne ich.
„Brathähnchen“, ruft Julian.
„Die Mauer wurde …“, sagte er.
„1961 gebaut“, vervollständige ich.
Nach vier Runden legt Julian das Kartenspiel weg. „Irgendwie auch seltsam“, sagt er. „Hier gelte ich als Ossi und zu Hause als Wessi.“
„Aber als was siehst du dich denn?“
„Keine Ahnung – als Deutscher“, sagt Julian. „Aber das klingt ja irgendwie auch scheiße.“
Es geht vielleicht auch gar nicht darum, sich irgendwo einzuordnen. Viel zu oft wird das von Älteren aus Ost und West schon vorsorglich im Gespräch gemacht, wenn sie über sich, den Sozialismus und ihren einen Besuch in der DDR auf der Durchreise nach Westberlin erzählen. Oder davon, dass früher mehr Gemeinschaft herrschte. Dann halten sie kurz inne und packen die Erinnerungen und eigenen Wahrheiten in den rhetorischen Schutzumschlag: „Na ja – ihr müsst euch doch nicht mehr damit beschäftigen“
Ist doch mal gut jetzt mit der Ost-Vergangenheit
Dabei hat die Beschäftigung doch längst begonnen, und es geht um uns. Die DDR endete wenige Jahre, bevor wir geboren wurden. Unsere Städte, Mitmenschen und Familien wurden von dieser Zeit geprägt und gestalten unsere Leben mit. Ich will als Nachwendekind keine aufgegebenen oder nie begonnenen Kämpfe meiner Eltern um Gerechtigkeit beginnen, sondern die Möglichkeit haben, diese Prägung als Teil von mir anzuerkennen, will mich darüber auszutauschen, um mich und damit auch andere zu verstehen.
Neulich habe ich mit der Autorin Paula Fürstenberg gesprochen. Sie ist zehn Jahre älter als ich und hat 2016 mir „Familie der geflügelten Tiger“ einen Roman darüber geschrieben, wie Nachwendekinder die DDR und die Wendezeit noch in sich tragen. Während ihrer Arbeit daran hat sie oft den Satz „Ist doch mal gut jetzt“ gehört, wobei sich das im Westen auf das Jammern über die Probleme nach der Wiedervereinigung und im Osten auf den Diktatur-Aufarbeitungsdrang bezog. „Aber was habt ihr denn geglaubt?“, hat Paula sich dann gefragt. „Dass 40 Jahre Diktatur für die Nachgeborenen egal sind? Dass sie rechte Gewalt der 90er- und 00er-Jahre keine Spuren hinterlässt? Eine kollektive Arbeitslosigkeit durch die Elternbiografien geht und die Kinder das nicht mitkriegen?“
Wir wollen niemanden beschuldigen, sondern Fragen zu dieser Zeit stellen. Fragen, die zu uns gehören, weil wir sie stellen. Und vermutlich geht es unseren Nachfolgegenerationen auch so. Das ist aber nicht mit Schmerz verbunden, erst dann, wenn sich das Recht darüber zu reden, erkämpft werden muss. Wenn sich junge Leute im Osten immer wieder fragen, was die DDR und die Wendezeit mit ihnen zu tun hat, geht es vermutlich nicht vorrangig darum, Andersartigkeit zu erzeugen, sondern sie zu verstehen. Wie kommt es dazu, dass sie mir immer dann auffällt, wenn ich mich mit Gleichaltrigen unterhalte, die nicht im Osten aufgewachsen sind?
„Dresden ist geil“
Während ich zurück nach Berlin fahre, schickt Mathilda mir ein Interview aus der „taz“ mit der Dresdener Rap-Gruppe 01099, die mit ihrem Song „Schnelle Brille“ das Modeaccessoire der GenZ – eine Radfahrerbrille – gehyped hat. „Das ist doch der Inbegriff von OstGenZ“, schreibt sie.
Die Bandmitglieder sind alle Anfang 20, rappen über das Bedürfnis jung und unbeschwert sein zu wollen. Ihre Heimatstadt kommt als Kulisse in ihren Songs prominent vor. Sie werden gefragt, was es für sie bedeutet, aus Dresden kommen. „Dresden ist geil!“, sagt Bandmitglied Paul. „Wenn du abends durch die Neustadt fährst und dann knallt da die Abendsonne rein: Das ist brutal schön. Wir kennen jede Ecke dort, jeden Sticker. Und ich finde es auch so nice, dass wir aus Dresden kommen und nicht aus Wuppertal oder so. Man hat automatisch Underdog-Status und kann eigentlich nur überraschen. Ich mag das total.“
Ich schreibe eine Mail an Katrin Gottschalk, die das Gespräch mit der Band geführt hat. Sie wurde 15 Jahre vor den Rappern in Dresden geboren. „Mich hat überrascht, wie gerne sie aus Dresden kommen“, schreibt sie. Sie habe seit Pegida oft einen entschuldigenden Gesichtsausdruck aufgelegt, wenn sie sagen musste, woher sie kommt. „Ich wäre früher gerne schon so selbstbewusst gewesen, wie die Jungs es heute sind.“
Sie hat 01099 gefragt, ob manche Beleidigungen wie „Ossi-Ottos“ im Internet treffen. Erste Antwort: „Nö wir kommen gern aus Sachsen.“ Zweite Antwort: „Wobei, wir fühlen uns schon auch manchmal zerrissen zwischen den vielen coolen ostigen Sachen und dem anderen – diesem ganzen ultrarechten Scheiß.“
Während ich das lese denke ich an Olivia, Sophia, Julian und eigentlich alle jungen Leute aus dem Osten, mit denen ich mich in der letzten Zeit unterhalten habe. Vielleicht geht es vielen Ost-GenZlern so. Natürlich darf man die Rechten nicht ignorieren, aber man darf ihnen den Osten und das Reden über den Osten und die noch unerzählten Geschichten nicht überlassen.
Vorurteile
Auf meiner Suche nach Spuren DDR-Vergangenheit ist mir klar geworden, dass ich zwar mit Älteren, also Ortskundigen, sprechen muss, um eine Orientierung zu finden, doch was das Gefundene für meine Geschichte bedeutet, muss ich selbst herausfinden.
Als ich wieder in Mathildas Berliner Wohnung eintreffe, höre ich auch der Küche einen blechernen Männerchor das schon vertraute „OST – OST – OSTDEUTSCHLAND“ skandieren. Es kommt aus dem iPhone von Pierre, dem Freund ihrer Mitbewohnerin Nina, die neben ihm sitzt, daneben Matildas andere Mitbewohnerin Karo. Der Bericht dreht sich um ein Fußballspiel, bei dem Leute festgenommen wurden und einer wohl auch einen Hitlergruß gezeigt habe.
„Ist das ein Regionalligaproblem?“, fragt Mathilda in die Runde.
„Nee, das ist ein ostdeutsches Problem“, antwortet Pierre sofort und zeigt auf eine hüpfende Gruppe Dynamo-Dresden-Ultras, die bei ihrem Tanz ihre rechten Arme heben, was ich zu ignorieren versuche. Warum bloß schon wieder Dresden? Soviel Klischee kann doch nicht sein. „Das habe ich so oft in Spanien!“, sagt Karo. Immer wenn sie ihre Partnerin da besucht und Klischees gegenüber Deutschen hört, wird sie verteidigend.
Niemand kommt von Nirgendwo
Das Gespräch geht hin und her. Mir fällt ein, wie oft ich schon Witze über Mathildas Verhältnis zum Geld gemacht habe oder wie sie „Liebä“ sagt statt Liebe. „Worüber wir hingegen gar nicht reden, ist ja deine katholische Prägung“, sage ich und lege ihr bedeutungsschwer eine Hand auf die Schulter. „Aron, nochmal: Nicht alle Kinder in Baden-Württemberg sind ständig in die Kirche gegangen.“
„Reagierst du nicht auch oft eingeschnappt, wenn ich Bosnien, Kroatien und Serbien über einen Kamm schere?“, fragt Nina Pierre herausfordernd. „Quatsch“, sagt der schnell.
„Sprechen die etwa die gleiche Sprache?“, frage ich. Pierre sieht genervt auf den Boden. Nina stößt ihm in die Seite und beginnt zu lachen.
Dann erklärt er ausführlich, dass sich Bosnisch und Kroatisch schon unterscheiden und erzählt, wie er angefangen hat mehr über das Land herauszufinden, aus dem seine Familie kommt. Vom Krieg in den Neunzigern, der ja vor unserer Haustür, stattfand, und doch hat niemand in der Schule davon gesprochen. Auch seine Familie nur wenig. Er eignet sich das jetzt alles selbst an, sagt er.
„Es gibt da aber noch voll viel zu erfahren.“
Ich sehe zum Kühlschrank, auf dem ein Magnet vom Brocken hängt, den ich mit Mathilda gekauft habe, als sie dort zum ersten Mal war. Es ist der höchste Berg Norddeutschlands und gehört zu meiner Herkunft wie der Bautzener Senf nach Sachsen. Ich schaue in die Runde.
Das Gespräch geht weiter von Jugoslawien, zum Bodensee, in den Harz und über Spanien nach Offenburg. Keine Ahnung, ob wir alle auf der gleichen Suche sind. Aber egal wohin sie führt, denke ich, so macht sie auf jeden Fall richtig Spaß.