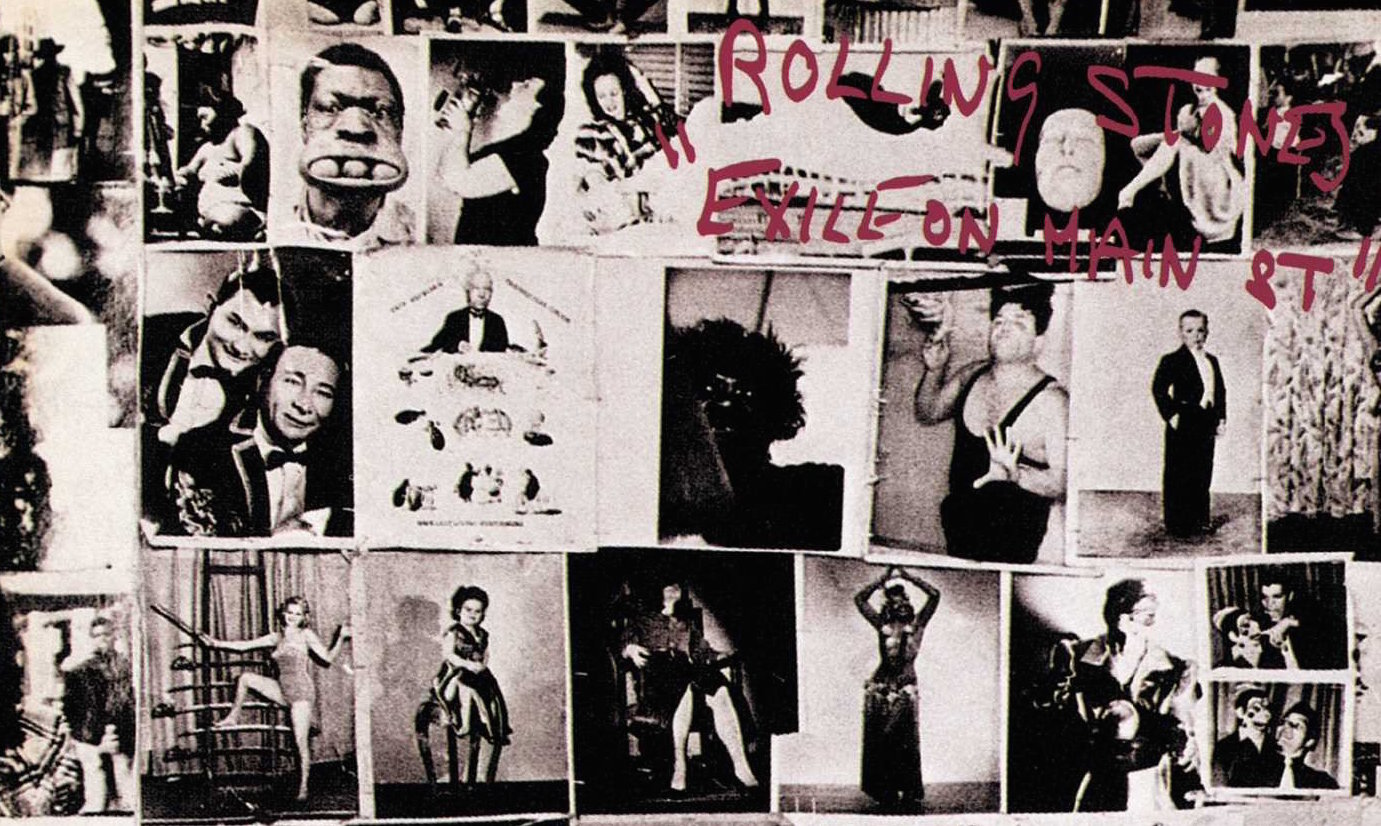Kritik: Was „Dune: Teil 2“ über die Angst vor Fundamentalisten und Atombomben verrät
„Oppenheimer“ und „Dune: Teil 2“ sind zwei der größten Filme der vergangenen Jahre. Vielleicht auch, weil wir Angst haben

Diese Rezension enthält Spoiler.
Das Haus Harkonnen und der Sohn des Herzogs Leto Atreides, Paul (Timothée Chalamet), kämpfen in „Dune: Teil 2“ um die Vorherrschaft auf dem Wüstenplaneten Arrakis. Sie setzen verschiedene Waffen ein. „Die gute alte Artillerie!“ ruft Baron Wladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård) und schaut befriedigt zu, wie seine Admiräle aus einem ihrer Raumschiffe einen Bombenhagel auf einen Felsen einschlagen lassen, in deren Höhlen sie die Feinde vermuten.
Aber der Gegner hat die passende Antwort. „Wir haben Atomraketen versteckt“, sagt der Waffenmeister der Atreides, Gurney Halleck (Josh Brolin) zu Paul. „Insgesamt 92, in einem Depot. Genug, um den ganzen Planeten in die Luft zu jagen!“. Die Empörung seiner indigenen Freunde, den Fremen, folgt sofort. Arrakis ist ihre Heimat. Sie wollen ihre Welt am Leben erhalten. Das kann Halleck nicht nachempfinden. Aber er versteht. „Ist ja gut!“, versucht Halleck sie zu beschwichtigen. „So viele brauchen wir nicht“. Und dann sagt er in „Dune: Teil 2“ einen sehr schönen Satz, der für Erleichterung sorgt: „Außerdem ist das nur so eine Redewendung!“.
Die Entstehung des globalen nuklearen Winters
Redewendung. Wahrscheinlich hat der Waffenmeister Recht. Selbst, wenn das nur einen schwachen Trost bietet. Auch wir Menschen auf dem Planeten Erde benutzen diese Redewendung, wenn wir das Potenzial sämtlicher verfügbarer Atomwaffen beschreiben und davor warnen wollen: „Genug, um den ganzen Planeten in die Luft zu jagen.“
Das stimmt so natürlich nicht. Würden alle 12.500 Nuklearwaffen (Stand: Januar 2023) unserer Welt gleichzeitig detonieren, entstünden riesige Krater. Die Menge an Trümmern, die in die Atmosphäre geschleudert würde, hätte weit größere Auswirkungen. Die Entstehung des globalen nuklearen Winters.
Aber wir nutzen die Redewendung zur Verdeutlichung der Tatsache, dass bei einer Zündung aller Atombomben die Existenz sämtlicher Lebewesen gefährdet ist. Um einen Planeten explodieren zu lassen, braucht es wohl tatsächlich eine andere Sci-Fi-Erzählung, die vom „Krieg der Sterne“, und die vom Imperium gebaute und im Todesstern installierte Laserkanone, praktischerweise „Superlaser“ genannt.
Auch in Denis Villeneuves „Dune: Teil 2“ bekriegen sich die Häuser mit allerlei futuristischem Kampfgerät. Laser in allen Farben und eben jener Artillerie, auf die der am Ende glücklose Baron Harkonnen stolz ist. Doch es sind die Atomraketen, die den Unterschied ausmachen. Für Halleck reichen für seinen Überraschungsangriff nur drei davon. Die gigantische Detonationswolke im Wüstensand erfüllt ihren Zweck. Seine Kämpfer nutzen die turmhohen, undurchsichtigen Staubwirbel, um auf hunderten Metern hohen Sandwürmern die Truppen des Gegners zu attackieren. Dass sämtliche Menschen sich während des Gefechts im Fallout-Radius von drei gezündeten Nuklearwaffen befinden, wird in Kauf genommen. Hey, dies ist schließlich Science-Fiction.
Regisseur Villeneuve inszeniert keine Heldenerzählung. Der junge Paul Atreides entwickelt sich vom lernbereiten Neuankömmling in einer fremden Welt zunächst vom „Chosen One“ zum „White Saviour“ und dann zum Gewaltherrscher. Eine Daenerys-Targaryen-Entfaltung wie in Zeitraffer. Vielleneuve hält sich hier, im Gegensatz zu David Lynch in seiner 1984er-Verfilmung, an die „Never trust your leaders“-Moral Frank Herberts in seinem Roman.
Araber-Karikatur
Aber die interessantere Figur ist eben jener ihm treu ergebene Waffenmeister Halleck. Er besorgt die Nuklearsprengsätze und übergibt sie den indigenen Fremen, ein Wüstenvolk, das in Villeneuves Kinoversion von Frank Herberts Geschichte als naive, blind gehorsame und frömmelnde Araber-Karikatur dargestellt wird. Warum müssen Außerirdische – und nichts anderes als Außerirdische sind Menschen, die auf fremden Planeten geboren werden – mit arabischem Akzent reden? Weil sie als rückständig dargestellt werden?
Halleck besorgt den Fanatikern, die im Film als Fundamentalisten bezeichnet werden, also die Atomwaffen. Ein „Schreckensszenario“ auch in unserer Welt: Der von einer ehemaligen Großmacht losgelöste Militärexperte verschafft den mit ihm sympathisierenden, vormals fragmentierten Kämpfern eines Nicht-Staatenbunds den entscheidenden militärischen Vorteil gegenüber der verhassten, anderen, weiter prosperierenden Großmacht. Das ist die Angst, wie wir sie kennen seit dem Zerfall der Sowjetunion: Spezialistenwissen des Militärs gelangt in fremde Hände. Paul schickt die Fremen schließlich zur Schlacht „ins Paradies“. Hoffnungsdestination für Kämpfer, die wissen, dass sie sterben; und das sind solche meist, die ihren Geist vorher ausschalten.
Nun ist es so, dass die Harkonnen Tyrannen sind, die ganze Planeten unterjochen. Wahrscheinlich gut so, dass ihnen der Garaus gemacht wird. Davon leben solche Filme. Die „fundamentalistischen“ Fremen wollen einfach nur ihre Besatzer loswerden. Der letzte Atreides aber, Paul, befindet sich längst auf dem Weg zum Despoten. Auch, wenn er zur Wiederherstellung galaktischen Friedens die Tochter eines Imperators heiratet, Prinzessin Irulan (Florence Pugh). Vorher muss er noch den Neffen des Barons, Feyd-Rautha (Austin Butler), im archaischen Ritual des Messerkampfs ausschalten (dessen Heimatplanet Giedi Prime wurde in spektakulärem kontrastreichen Schwarz-Weiß gedreht, wie eine Hommage an Panos Cosmatos‘ „Beyond the Black Rainbow“ oder E. Elias Merhiges „Begotten“).
„I am your Father“
Den Baron Harkonnen begrüßte Paul zuvor mit „Großvater“, rammte ihm das Messer in den Hals und kommentierte das mit „nun stirbst Du wie ein Tier“. Villeneuve ist hier viel befreiter, viel radikaler als der Frank-Herbert-Epigone George Lucas, der seinen Luke Skywalker großes Mitleid mit seinem Vater Darth Vader empfinden ließ. Vorher erhielt Lady Jessica (Rebecca Ferguson) bereits ihren „I am your Father“-ähnlichen Moment, wenn auch nicht so wirksam wie im „Imperium schlägt zurück“.
Christopher Nolans „Oppenheimer“ und „Dune: Teil 2“ sind zwei der größten Blockbuster der vergangenen zwei Jahre. Was sagt das über unsere Angst vor einem Atomkrieg aus? Beide Werke teilen nicht nur die Gemeinsamkeit, dass sich ihr jeweiliger Protagonist im Laufe des Films Florence Pugh zuwendet. Sie sind auch Filme, in denen sich Machtverhältnisse zwischen Supermächten durch den Einsatz der Bombe entscheidend verändern.