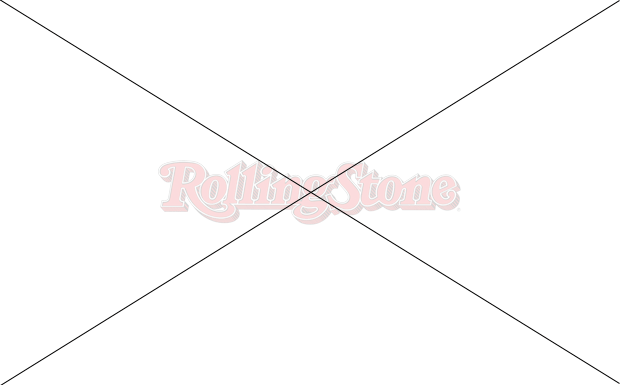Kaiser Chiefs: Bei fünf auf den Bäumen!
Der letzte Britpop-Boom brachte den Kaiser Chiefs fünf Platinplatten, haufenweise Awards und eine Tour mit U2. Ob sie es jetzt auch noch schaffen, den Verfall der westlichen Kultur zu stoppen?
Den wehleidigen Mist über das schwierige zweite Album, das ewige Zu-sich-selbst-Finden und die elefantesken Mengen an Zeit, die Musikmachen dauert, wenn man keine gescheiten Ideen hat – all das lassen wir heute weg. Wir behandeln die Kaiser Chiefs mal nicht wie die Rockband, die sie zweifellos sind, sondern wie ganz normale Menschen, die sie sicher gern sein mögen. Falls sie sich beklagen, sagen wir zu ihnen: „Stellt euch nicht an, ihr habt zwei Millionen Platten verkauft, seid froh!“
Ja, so viel haben sie gewonnen, allein in England fünf Platinplatten, drei Brit Awards, den Ivor Novello Award für gutes Songwriting. Das ist harte Währung, das einzige, was gegen die Vorwürfe schützt, man sei hochgejubelt worden. Und dann sagen die Kaiser Chiefs, die sowas von heilfroh sein könnten, sich so bravourös durchgeschlängelt zu haben, im Interview mit uns solche Sachen: „Alles ist so furchtbar mittel heutzutage. Wenn man nur mal die Welt anhalten und den Leuten sagen könnte: Hört euch das doch mal an! Das ist absoluter Durchschnitt! Ich nenne keine Namen, aber jeder kann sich denken, wen ich meine.“ (Sänger Ricky Wilson) „Anders als die Arctic Monkeys hatten wir das Glück, dass uns keiner kopiert hat. Weil das viel zu schwer gewesen wäre.“ (wieder Wilson, nicht lachend) „Wir haben für die erste Platte schon gute Besprechungen bekommen, aber keine hymnischen.“ (Bassist Simon Rix) „Bei den Brit Awards haben wir wieder nur eine einzige Garderobe für Band und Crew bekommen. James Blunt hatte zwei oder drei.“ (wieder Wilson) Und um noch einen draufzusetzen: „Das geht jetzt aber nicht gegen James Blunt, der ist eigentlich total nett!“ (wieder Wilson). Der Fall ist verzwickter, als wir dachten.
Vergangenen September hat Jon Bon Jovi -— ausgerechnet Bon Jovi! – in einem „GQ“-Interview gesagt, dass ihn erst die Ankunft der Kaiser Chiefs im Jahr 2005 davon überzeugt habe, dass die Rockmusik doch noch nicht am Ende sei. Er meinte den heißen, lustigen Sommer des dritten Britpop-Booms, in dem auch bei uns sehr viele Leute Kaiser Chiefs, Maximo Park, Bloc Party, Art Brut, Franz Ferdinand gesehen haben und im Nachhinein alle untereinander verwechseln und durcheinanderbringen.
Woran das liegen könnte: Die Welle war eine rein ästhetisch fixierte. Keine der Bands – Art Brut noch am ehesten – hatte über den Spaß hinaus irgendetwas Interessantes zu sagen, was zumindest bei den künstlerischen Vorbildern (Gang Of Four, Madness und so weiter) ganz anders gewesen war. So wurde „I Predict A Riot“ von den Kaisers schon wegen dem Wort „riot“ im Titel zum Schlachtlied für einen bewegungslose Bewegung. Und weil es ein tolles Lied war, auch wenn es nur um bizarre Szenen nach der Sperrstunde ging.
Unter genau dieser Inhaltsleere leidet Kaisers-Sänger Ricky Wilson offenbar, wenn er die Klage gegen den Verfall des Pop und der Kultur überhaupt führt, ungefragt: „Nimm die Architektur – heute ziehen ein paar junge Profis ein Gebäude hoch, um es fünf Jahre später wieder einreißen zu lassen, weil es nicht mehr schick ist. Vor 500 Jahren bauten die Leute noch Kirchen, für die sie 20 Jahre brauchten! Wer macht heute noch so was?“ Mindestens genauso übel finden Wilson und Bassist Rix, dass die Profitgier den jungen Bands nicht mehr erlaubt, sich zu entwickeln, dass es jeden Schock schon bei H&PM zu kaufen gibt und die Plattenfirmen das Risiko scheuen, ungewöhnliche Musik herauszubringen. „In dem Teufelskreis steckten wir auch“, sagt Wilson. „Keiner wollte das Risiko eingehen, uns einen Vertrag zu geben.“
Momentchen: die Kaiser Chiefs – zu schräg? Da haben wir was verpasst. Auch die zweite Platte „Tours Truly, Angry Mob“ zeichnet sich wieder durch extreme Gefällig- und Harmlosigkeit aus, ein rarer Fall, in dem gerade die unbedingte Eingängigkeit aller Lieder auf Dauer wahnsinnig öde wirkt. Die Kaiser Chiefs sind selbst die beste Evidenz für ihre Thesen zum Verfall, und der Erfolg gibt ihnen zusätzlich recht. „Wir waren schon geschmeichelt, als die Fans sich plötzlich so anzogen wie wir und es meine gestreiften Blazer bei H&?M gab“, sagt Wilson, „aber ein Gimmick zu sein, das verkürzt die Lebenszeit. Irgendwann muss man aus aus dem ,NME‘-Kosmos raus und eine Weltweit-Band werden.“ Die Kaisers waren schon im Vorprogramm von U2 und den Foo Fighters auf Tour, sollten sogar mit den Stones spielen. Sie seien dann doch froh gewesen, als das besagte Zagreb-Stones-Konzert abgesagt wurde, weil sie die Arbeit am irre wichtigen Album hätten unterbrechen müssen. Am 27. Januar 2007 schrieb Ricky Wilson im Band-Blog vom Promo-Trip aus dem kalten New York: „Jedes Mal, wenn ich aus der Limousine aussteige, bekomme ich einen kleinen Schock. Ja, ihr habt richtig gelesen, wir fahren in einer Limousine herum. Und ja, ich weiß, dass das ein bisschen doof ist und dass viele das blöd finden, aber wir selbst lachen uns tot darüber.“
Das ist die neue Gattung von Stars: nicht mehr die Prasser wie Led Zeppelin, nicht mehr die Bescheidenen wie Coldplay. Die Kaiser Chiefs bestehen darauf, wie Stars behandelt zu werden, tun nach außen hin aber ständig so, als ob sie es total lächerlich finden. Sie sind ein bisschen wie Stromberg.