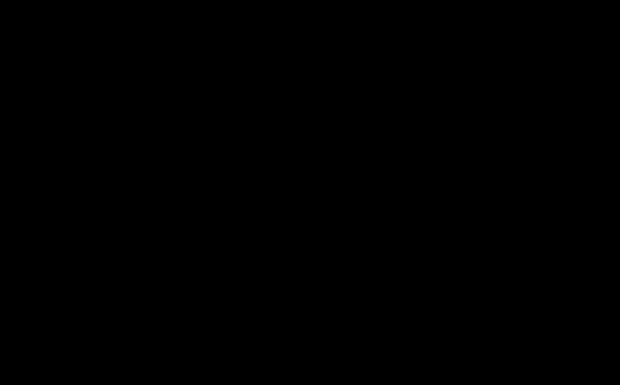Jim und ich

Am 3. Juli jährt sich der Todestag von Jim Morrison zum 40. Mal. Lebendig und wild bleibt dagegen das Geheimnis, das der Sängerpoet der Doors hinterlassen hat. Wer Jim kennenlernt, wird anders erwachsen – auch heute noch.
Es gibt nicht viel, was ich meinen Eltern vorzuwerfen habe, außer, dass sie mir als Kind den Rock’n’Roll verheimlichten. Ich hatte ja keine Ahnung, dass jenseits der schönen Künste, der klassischen Musik, der geblümten Gummizugröckchen und niedlichen Puffärmelblüschen eine verheißungsvolle Welt lag, die jede bisher gewohnte Ordnung von geistiger und körperlicher Gesundheit auf den Kopf stellte. Bis ich mich mit 16 Jahren von Hannovers Stadtrand in die Innenstadt zu einer Art Hippie-Clique aus Gymnasiasten vorgearbeitet hatte, die sich styletechnisch an den Outfits mir bis dahin vollkommen unbekannter Rocklegenden wie Frank Zappa, Axl Rose, Angus Young und Jimi Hendrix orientierten, war ich davon ausgegangen, der einzige Mensch weltweit zu sein, der sich während der Pubertät in undefinierbaren, seltsamen, psychisch total aufwühlenden Zuständen befand.
Bis ich eintrat in die große Zeit der inneren Umwälzungen, waren meine Jugendzimmerwände mit regenbogenfarbenen Einhorn-Schrägstrich-Friedenstauben-Postern dekoriert. Ich träumte davon, niemals mein Elternhaus zu verlassen, märchenhaft zu heiraten und Mutter von drei Kindern zu werden. Doch mit einem Mal meldete sich in mir eine destruktive Urgewalt, die mir völlig neu war und die meine DNA bis in alle Ewigkeit komplett umschrieb. Tagsüber lag ich depressiv bei zugezogenen Vorhängen und Vivaldi-Violinkonzerten auf meinem schwedischen Bettüberwurf und machte mir tiefe Gedanken über den Sinn des Lebens und die Zielsetzung des Universums. Ich analysierte die Aufgabe von uns Menschen auf der Erde und warum es wichtig war, den eigenen dramatischen Tod immer unmittelbar vor Augen zu haben. Ich verspürte den Drang, zum Zweck der Selbsterhöhung etwas von universeller Bedeutung zu schaffen. Ich durchlitt unsagbare Qualen aufgrund der Tatsache, dass ich mich von einem Tag auf den anderen so unglaublich missverstanden und abgetrennt von meinen Mitmenschen fühlte.
Wenn ich in der Schule in den kleinen Pausen zwischen Mathe und Englisch über die menschenverachtende Konsumgesellschaft philosophierte, wendete sich die Pierre-Cosso-Rick-Astley-Anhängerschaft kopfschüttelnd ab und blätterte ihre „Bravo“-Fotolovestory durch. Hilflos wälzte ich mich nachmittags auf meinem Bett hin und her, um diese nie gekannte Sehnsucht nach Expansion, nach Ausdruck und nach absoluter Selbstzerstörung einigermaßen in den Griff zu bekommen. Plötzlich schienen meine Kinderzimmerwände zusammenzurücken, ich sah mich als armseliges Opfer meiner beschränkten Umstände.
Live fast, die young. Diesen Spruch, von dem ich bis dahin nichts wusste, hatte dankenswerterweise jemand nachts mit roter Farbe auf unser Garagentor gesprüht. Als Faustregel schien mir das zumindest ein adäquater Ansatz. Ich begriff die Kernaussage intuitiv – und erfuhr erst Jahre später, dass diese Losung das Lebensmotto der Mitglieder des sogenannten Klub 27 widerspiegelte – jener Gruppe von Rock- und Bluesmusikern, die bereits im erschütternden Alter von 27 Jahren das Zeitliche gesegnet hatten und somit zu Ikonen eines individuellen und freigeistigen Lebens wurden. Jim Morrison war einer von ihnen.
Der Kinofilm „The Doors“ kam 1991 gerade rechtzeitig in die Kinos, um mir endlich mein dringend nötiges role model in Sachen Lebensführung zu liefern. Ich wurde augenblicklich zur uneingeschränkten Anhängerin, als ich Val Kilmer dabei zusah, wie er leichtfüßig Jim Morrison verkörperte. Dieser coole Gang in der gut sitzenden, braunen Glattlederhose. Sein breiter Gürtel, der sich um die schmale Taille schmiegte, dieses sauscharfe Wiegen in der Hüfte, die hängende Schulter, die schlackernden Arme. Sein lockiges Haar im diffusen Sonnenuntergangslicht am Venice Beach. Seine sinnlich-vollen Lippen, die auf Kommando dichten konnten: „Ich bin der Eidechsenkönig. Ich kann alles. Ich kann die Erde in ihrer Bahn anhalten. Ich ließ die blauen Autos verschwinden.“ Genauso sexy, so wild und größenwahnsinnig und frei, so intellektuell und selbstzerstörerisch wollte ich in mein eigenes Leben eintreten, das genau jetzt beginnen sollte. Ohne Rücksicht auf Verluste. Was hätte ich damals nur dafür gegeben, ein Junge zu sein.
Mit seinen romantisch-morbiden Gedichten sprach mir Jim Morrison, obwohl er bereits vor meiner Geburt gestorben war, direkt aus der Seele. Er sah, was ich sah. Er zeigte mir das gleißende Tor, über dem in leuchtenden Lettern „erwachsen werden“ prangte. Ich musste nur hindurch, in die-se unendliche Weite hinaustreten und meinem Lehrmeister folgen. Doch er blieb stehen. Denn Jim Morrison verkörperte die Schwelle zwischen der absoluten Freiheit und dem Wunsch, von seinen Mitmenschen gewürdigt, erkannt und in ihre Mitte aufgenommen zu werden. Und eben dieser Zwiespalt ließ ihn diese atemlosen, schweißtreibenden Musikstücke hervorbringen, die mich augenblicklich tanzen und meine Haare durch die Luft schleudern ließen.
Das Geheimnis von Jim Morrison war, dass er ein Mann war, der seine empfindsame Seite nicht versteckte, sondern sie geradezu vor sich hertrug, während er um sich schlug. Er war ein Priester, einer, der uns Suchenden zeigte, wie ein Leben jenseits jeglicher Konventionen zu führen war, ohne als Freak zu enden, sondern zur Ikone zu werden, die all jene Widersprüche, die man als Teenager in sich spürte, vereinte und zu etwas verschmolz, das bis heute seine Wirkung nicht verloren hat. Einer, der ohne mit der Wimper zu zucken sagen konnte: „Ich will Rosen in meinem Gartengemach, verstehst du?“ So einer konnte nur der leibhaftige Messias, der wiederauferstandene Jesus sein. Er verkörperte den Sex, die mutwillige Selbstzerstörung und die Erkenntnis, den notleidenden Menschen helfen zu müssen, den einzigen Weg zur Erlösung zu finden. Die erste Frage, die ich mir nach dem Kinobesuch stellte, war: Lebt Jim vielleicht doch noch? Und: Wenn ja, wo kann ich ihn finden?
Auf dem Pariser Ostfriedhof Père Lachaise.
Ich war nicht in ihn verliebt. Ich wollte nur so sein wie er, um sämtliche Facetten des Lebens kennenzulernen, um ja nichts zu verpassen. Die Jungs aus meiner Gymnasiasten-Hippie-Clique hatten wohl die gleiche Idee. Plötzlich schlenkerten sie alle mit halb leer getrunkenen Whiskeyflaschen herum, schrieben Gedichte, küssten auf der Straße wildfremde Mädchen auf den Mund, versuchten sich in exzessiven Petting-Orgien, gründeten eine Schülerrockband, rauchten Kette, liefen in abgelatschten Bikerboots herum, entdeckten ihr Faible für das Schamanentum und halluzinogene Drogen und erkannten, dass es zwar souverän war, eine Freundin zu haben, aber noch souveräner rüberkam, diese auf sogenannten Sit-ins oder Gigs zu betrügen.
Als Mädchen hatte ich es da wesentlich schwerer. Ich musste einsehen: Frauen können nicht zu Ikonen werden. Jungs übergeben sich sturzbetrunken in den nächstgelegenen Busch, Mädchen reichen Taschentücher. Jungs können, ausschließlich mit Halstüchern und Bikerboots bekleidet, nackt ums Lagerfeuer tanzen wie echte Indianer und mithilfe des Klappmessers Blutsbrüderschaft schließen, bis der Krankenwagen kommt. Mädchen wissen schon vorher, dass so eine Nummer in der Notaufnahme endet. Die Jungs bestimmten, welche Partys gecrasht wurden. Die Mädchen waren froh, wenn sie überhaupt gefragt wurden, ob sie mitkommen wollten. Die Mädchen folgten den Jungs. Jesus hatte seine Jünger. Das war schon immer so.
Trotzdem wollte ich nicht die Rolle des ewig eifersüchtigen Groupies, der armseligen Mitläuferin einnehmen, die in der Turnhalle am Bühnenrand steht und ihrem Freund, gemeinsam mit allen anderen Mädchen, zujubelt, der im Scheinwerferkegel vollkommen weggetreten gegen den Monitor tritt und grölend in die Zuschauermenge kippt. Ich musste notgedrungen umschwenken auf Jim Morrisons weibliches Pendant und versuchte mich als Janis-Joplin-Lookalike. Was ein ziemlich undankbares Unterfangen war. Ihre Stimme und ihren Style fand ich natürlich toll und innovativ, aber er war derart aufwendig, dass man gut und gerne den ganzen Tag damit beschäftigt sein konnte, sich bunte Tücher um die Gliedmaßen zu wickeln und in Läden nach indischen Samtschläppchen mit stinkender Teersohle zu suchen.
Außerdem empfand ich Janis‘ Leben eher als tragisch denn als cool. Schließlich hatte ich nicht vor, mich bedürftig den Männern zu unterwerfen und mir von ihnen ständig das Herz brechen zu lassen, nur weil ich auf ein bisschen zärtliche Liebe hoffte. Janis Joplin sang ausschließlich von schmerzhaften Erfahrungen im Beziehungssegment, und dass auch sie gerne mit einer halb leer getrunkenen Whiskeyflasche herumschlenkerte, machte sie irgendwie nicht attraktiver.
Das Ausmaß ihrer erschreckenden Suche nach Liebe und Geborgenheit machte ja der Film „The Rose“ mehr als deutlich, in dem Bette Midler eine Art zweite Janis Joplin verkörperte. Im Grunde schien sie nie den Kinderschuhen entwachsen zu sein, wie ein kleines Mädchen jammerte sie in der letzten Liedzeile von „Trust Me“: „You leave a lost girl.“ Die Antwort auf meine emanzipierte Identitätssuche konnte nur Jim Morrison sein.
Wir alle gingen irgendwann, als wir genug getanzt, geküsst und gesucht hatten, durch dieses gleißende Tor, das er uns gezeigt hatte, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wir ließen ihn zurück im pubertären Korridor, zwischen Kindheit und Verantwortung.
Ich bin nie zu seinem Grab gepilgert. Dafür pinnt über meinem Schreibtisch eine Schwarz-Weiß-Fotografie seines Grabsteins. In das eingemeißelte O von „Morrison“ hat ein Fan mit schwarzem Edding ein Peace-Zeichen gemalt, auf den Steinplatten davor liegt ein Bündel Margeriten, und oben auf dem ziemlich ramponierten Stein haben seine Jünger augenscheinlich ein Haschpfeifchen entleert. Dieses wunderschöne Stillleben erscheint mir wie ein Abbild seiner Vision – oder der, die wir ihm zugeschrieben haben: die Welt aus ihrem Schlaf zu erwecken und ihr die Schönheit, die uns umgibt, zu zeigen. Seine ungebrochene, ständig vor sich hergetragene Leidenschaft, sein außergewöhnlicher Wille, mit jedem Atemzug etwas Neues, noch nie Dagewesenes hervorzubringen, das Menschsein komplett zu erfassen, hat uns, die sich damals von ihm angesprochen fühlten, geprägt und uns eine unvergessliche Jugend beschert.
Mein achtjähriger Sohn leidet seit dem Auftauchen Justin Biebers enorm unter seiner Lockenpracht. Mithilfe des Glätteisens seiner großen Schwester versuchte er am Morgen verbissen, seine Haare glatt zu bügeln, in der Hoffnung, dadurch irgendwie cool auszusehen. Da habe ich mir gedacht, ich mache es anders als meine Eltern: Ich zeige ihm Ausschnitte aus dem „The Doors“-Film. Ganz harmlos. Nur ein paar Konzertszenen, mehr nicht. Einfach, um ihm zu zeigen, dass es da mal einen Mann mit Locken gab, der total unabhängig war. Es war sehr schwer für mich, meinen Sohn wieder vom Fernseher wegzubekommen. Ein paar Augenblicke haben gereicht, um in ihm etwas anzusprechen. Den Wunsch nach Expansion. Nach Ausdruck und Individualität.
Am nächsten Tag trug er mehrere Perlenarmbänder ums Handgelenk, ein offenes Hemd und die Haare zum ersten Mal lockig. Seitdem bemerkt er des Öfteren, er habe nie gewusst, dass er so schönes Haar hat. Schönes Haar wie dieser Sänger. Tag für Tag bettelt er, sich den Film ganz ansehen zu dürfen. Er scheint die Philosophie der Jugend, der Umwälzungen schon vor der Pubertät entdeckt zu haben, nach der ich so lange suchte.
Gerne hätte ich Jim Morrison als 17-Jährige gefragt, ob er je die Wahrheit gefunden hat, nach der er immer suchte. Es war unsere Zeit des Erwachens, der großen Veränderung, der Bewusstwerdung der eigenen inneren Kraft und Individualität. Seine Stimme, seine Texte, sein Ausdruck erinnern uns noch heute daran: an diesen einen endlosen Sommer. Wir waren es doch, die im Geiste Jim Morrisons loszogen, um die Wahrheit zu finden. Haben wir denn nicht damals auf den Liegewiesen im Wald, in den Turnhallen unserer Schulen, in den schrabbeligen Proberäumen ein Gelübde abgelegt, seine Vision in Ehren zu halten? Niemals wollten wir dieses aufgeregt pulsierende Herz vergessen, das der Rock’n’Roll uns beschert hat.
alexa hennig von lange, 38, moderierte in den Neunzigern eine TV-Kindersendung und schrieb Drehbücher für eine Soap-Opera. Bekannt wurde sie 1997 mit dem Roman „Relax“, der heute zum Kanon der sogenannten deutschen Popliteratur gehört. Über Jim Morrison schrieb sie exklusiv für den ROLLING STONE. Alexa Hennig von Langes neues Buch „Leichte Turbulenzen“ erscheint im September beim Verlag C. Bertelsmann.