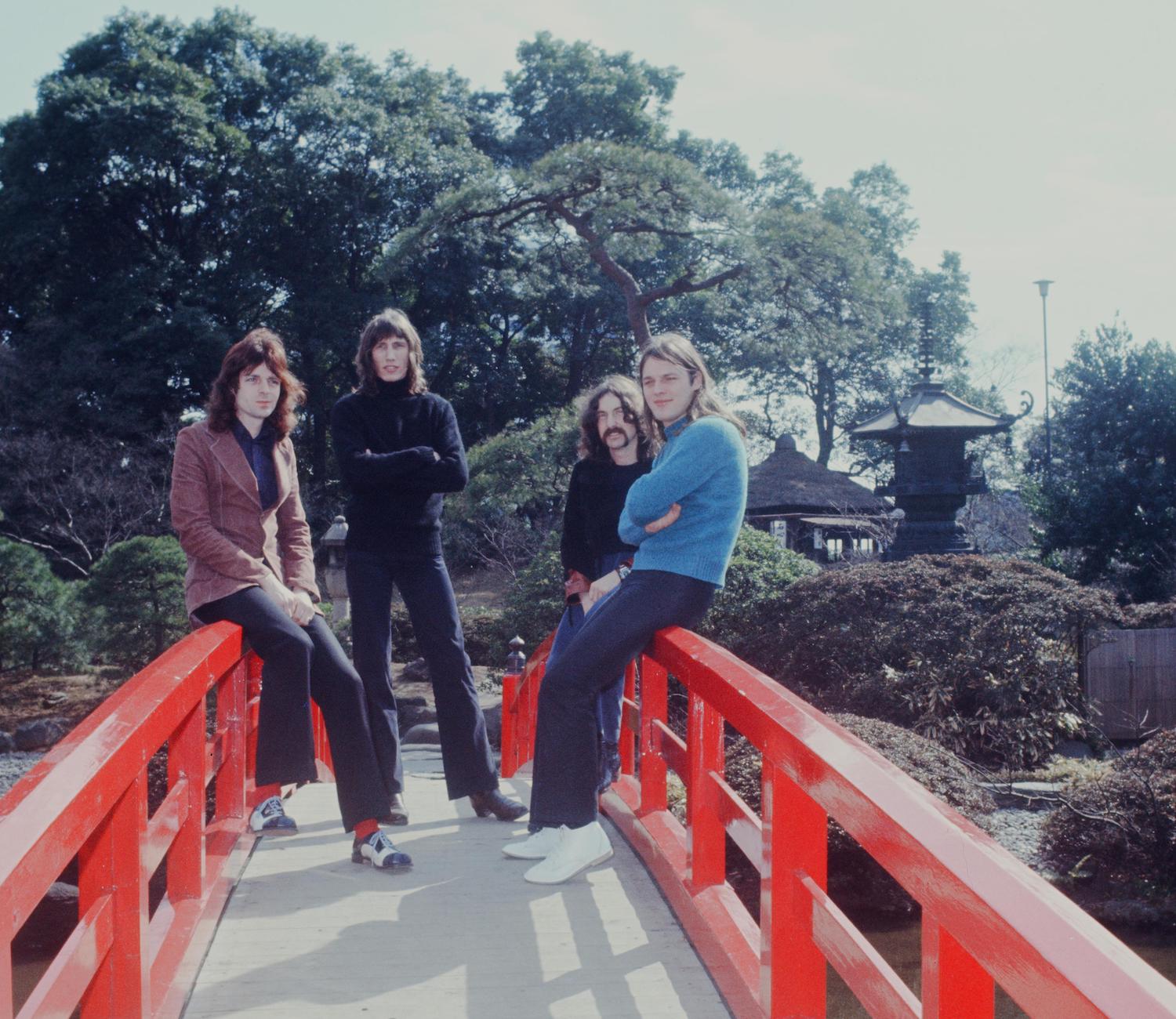In 7 Liedern um die Welt
ROLLING STONE-Autor*innen über Lieder, die ihr Fernweh wecken

„Hey Manhattan!“ von Prefab Sprout
Wer zum ersten Mal vom John F. Kennedy Airport kommend nach Manhattan fährt, vielleicht in einem Taxi und nicht wie Paddy McAloon, sein Bruder Martin und die wunderbare Wendy Smith in einem offenen Cabrio, ist überwältigt von der sich öffnenden Wolkenkratzerkulisse, auf die man in der Regel und am preiswertesten über die Queensborough Bridge, und nicht über die im Song erwähnte Brooklyn Bridge zugleitet. Es gibt kein überwältigenderes Entree in unserer Vorstellung von New York. Denn alles ist so, alles sieht so aus, wie Du Dir es immer vorgestellt hast. Nur noch viel besser.
Es gibt auch kein anderes Lied, das dieses Entree besser beschreiben könnte. Ein Lied, das klingt wie das kollektiv imaginierte Bild von Manhattan, und wie die tatsächliche Bewegung nach Manhattan hinein. Es beginnt mit „Guess what, summer‘s arrived, I feel the world‘s on my side“ und einem Cymbal-Flirren, mit einem sanft brummelnden Bass und den Horizont aufreißenden Streichern. „Hey Manhattan! Here I am!“ singt Paddy McAloon, Songwriter und heute alleiniger Inhaber der ehemaligen Band Prefab Sprout, die Mitte der 80er den herrlichsten, sophisticatedsten Pop gespielt hat, er singt es mit Wendy Smith im Chor, die damals seine Freundin war. Sie zählen auf, was Touristen abhaken würden, das Stromern über die 5th Avenue und „look, there‘s The Carlyle!“, fantasieren Sinatra und Kennedy herbei, fühlen sich, als gehörte ihnen dieser Ort, die Stadt, die Sehnsuchtsfantasie.
Der Song ist auf Prefab Sprouts drittem Album, „From Langley Park To Memphis“, das 1988 veröffentlicht wurde. Die Band war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, Stevie Wonder und Pete Townshend wirkten im Kleingedruckten mit, Thomas Dolby produzierte (etwas zu sehr), sie landeten ihren ersten und einzigen Top-Ten-Hit und das Hochgefühl eines guten Lebens, dass sie das Glück gefunden hatte, dass ihnen alles offen stand, schwingt in diesem Song mit. Es kam dann anders. Aber davon weiß „Hey Manhattan!“ nichts. Der Song ist die beste Eintrittskarte für jeden New-York-Novizen. Er ist ganz klingende Kulisse und, was ihn besonders macht, ein ganz große, offene Umarmung des Lebens. Über alles andere reden wir, wenn die Koffer ausgepackt sind.
„Letter Never Sent“ von R.E.M.
Es war 1984, und eigentlich schrieb Michael Stipe zu dieser Zeit selten Texte, die ganz klar und eindeutig waren. „Murmur“ hieß nicht umsonst so, und „Reckoning“ klang nicht viel anders – es waren Lieder, deren Zauber im Ungefähren lag, in der Andeutung, im Rätselhaften. Umso erstaunlicher der Song „Letter Never Sent“ auf dem zweiten R.E.M.-Album: „It’s been pretty simple so far/ Vacation in Athens is calling me”, singt Stipe zu Beginn, Peter Bucks Gitarre schrammelt sehnsüchtig, Bill Berrys Schlagzeug stolpert unverzagt voran, Mike Mills stimmt mit ein, und dann im Chorus die Behauptung: „Heaven is yours where I live!“
Wer würde das nicht sofort glauben? Zu der Zeit waren R.E.M. fast pausenlos auf Tournee, jahrelang, und natürlich hatten sie Heimweh. Vor allem aber ist Athens, Georgia seit den 80er-Jahren auch ein Sehnsuchtsort für alle, die R.E.M. lieben. Einmal das Kudzu sehen, dieses komische Gestrüpp, das auf dem Debüt-Cover abgebildet ist. Einmal die Eisenbahnbrücke von der Rückseite. Die Kirchen-Ruine, in der sie im April 1980 das erste Konzert gaben. Den 40 Watt Club. Und überhaupt: die rote Erde, den Oconee River, die Glühwürmchen, die liebenswerten Weirdos. Stipe hat uns in geheimnisvollen Bildern eine Welt gezeigt, die eindeutig in den Südstaaten verwurzelt ist und gleichzeitig weit darüber hinausweist. Wer all die konkreten Orte sehen will, findet sie in Athens tatsächlich. Wer die Augen schließt, entdeckt noch viel mehr. (Nicht nur das Pfeifen der Züge in der Ferne oder das Zirpen der Grillen.)
In „Letter Never Sent“ mischt sich die Sehnsucht nach dem Zuhause mit Orientierungslosigkeit: „When I’m moving too fast, where is my new address?” Heute wohnt Michael Stipe meistens in New York, doch Athens, Georgia wird immer eine verzauberte Adresse bleiben. Die größte Kleinstadt Amerikas.
„Copenhagen“ von Scott Walker
Er machte die schnellste Karriere eines Teenager-Idols: Sie dauerte von 1965 bis 1967, als die Walker Brothers sich trennten. Die Walker Brothers hießen nicht Walker und waren keine Brüder. Aber Noel Scott Engel nahm als Scott Walker seine Soloplatten auf. Neben anderen Balladen sang er Songs von Jacques Brel, die der Dichter Rod McKuen ins Englische übertragen hatte. Walkers dritte Platte, „Scott 3“, erschien 1969 – er hatte beinahe alle Songs (mit Ausnahme von drei Brel-Adaptionen) selbst geschrieben.
Walkers erstaunlicher Bariton ist noch immer in grandiose Orchester-Arrangements gebettet, aber jetzt fehlen die Refrains, und Walker führt seine Stimme an die Grenze ihres Vermögens ohne sie – anders als später – zu überschreiten. Das Pathos der Brel-Stücke ist einem poetischen Lakonismus gewichen, der immer als „Existentialisms“ bezeichnet wird.
„Copenhagen“ ist eine Allegorie auf die Liebe, wenn Walker singt: „Hope for me, I hope for you/ We’re snowdrops falling through the night/ We melt away before we land/ Two teardrops for somebody‘s hand.“ Dann aber spricht er nicht zu einer Geliebten, sondern zu der Stadt selbst: „Warmed my feet beneath cold sheets, dyed my hair with your sunny streets.“ Am Ende des zweieinhalbminütigen Songs wechselt er noch einmal scheinbar das Thema: „Children aren’t afraid to love and laugh when life amuses them/ And our life is an antique song/ For children’s carousels.“
Ausgerechnet in den „sonnigen Straßen“ von Kopenhagen wird das Haar des Erzählers gebleicht. Es stimmt also etwas nicht mit dem Lied. Oder es stimmt etwas nicht mit dem Sänger. Wie sich herausstellte, ist es der Sänger. Vielleicht sagt er mit diesem Lied aber auch, was der Kopenhagener Sören Kierkegaard schrieb: „Was ist Jugend? Ein Traum. Was ist Liebe? Des Traumes Inhalt.“ Wir erfahren nichts über Topografie in „Copenhagen“, aber wir erfahren etwas über eine Stimmung, nämlich die Melancholie des Tivoli, der Kirmes.
Am Ende der Platte singt er Brels tröstlichen Walzer „Sons Of“, den „Funeral Tango“ und „If You Go Away“. Das waren seine letzten Brel-Stücke. Im selben Jahr veröffentlichte Walker „Scott 4“, für das er sämtliche Songs selbst geschrieben hatte. Jetzt hatte er beinahe kein Publikum mehr.
„A Night in Tunisia“ vom Charlie Parker Septet
Der Trompeter Dizzy Gillespie nannte seine Komposition zuerst „Interlude“. Gerecht wurde er der nervösen Energie seines Bebop-Meisterstücks damit nicht: Die Akkorde wechseln im Halbton hin und her, schaffen eine Spannung, eine mysteriöse Stimmung, die sich nie ganz entlädt, selbst in den heftigen Soloausbrüchen nicht. Die Bläser beschwören ferne Orte herauf, reizvoll und ein wenig unheimlich, grooven über dem afro-kubanischen Rhythmus wie der Soundtrack eines Spionagefilms, ein Bond-Song avant la lettre. Der finale Name kam dann, so Gillespie, von „irgendeinem Genie“, das diesen ominösen, mitreißenden Vibe als „A Night in Tunisia“ bezeichnete.
Es gibt viele besondere Interpretationen dieses Standards – Gillespies, Lee Morgans –, die definitive ist die vom Charlie Parker Septet. Im März 1946 nahm Parker mit seinen Musikern, unter ihnen der 19-jährige Miles Davis, das Stück auf. Von den ersten Noten an, den Unisono-Läufen von Gitarre und Klavier, entfaltet es seine mysteriöse Stimmung; die dumpfen Trommeln, die schräge Trompetenfigur, die Ekstase, der Rausch.
Das Tunesien des Stücks ist ein Sehnsuchtsort, eine in Musik verwandelte Idee; Gillespie hatte nie eine Nacht in Tunesien verbracht. Natürlich wäre die Komposition auch als „Interlude“ ein fantastisches Stück Musik, aber einen kleinen Teil ihres Reizes hätte sie vielleicht doch verloren. „A Night in Tunisia“ wird so zum Versprechen, zum Abenteuer, einer reizvollen Reise – nicht zuletzt, wenn man das Lied im Berliner Winter hört.
„The Beehive State“ von Randy Newman
Auf Randy Newmans erster Platte von 1968 befindet sich neben hoffnungslosen Liebesliedern ein sehr kurzes Stück über den Bundesstaat Utah. Man hat von Utah gehört, da leben diese Mormonen, sie haben eine riesige Kathedrale in Salt Lake City gebaut. Es gibt Berge in Utah, auf denen Ski gefahren wird. Robert Redford wohnt in Utah und veranstaltet das Sundance Festival für unabhängige Filme. Alle großen Regisseure haben ihre ersten Filme in Utah vorgestellt. Redford spielte 1969 in dem Film „Butch Cassidy And The Sundance Kid“ – Paul Newman war Butch Cassidy, Redford war Sundance Kid.
1968 wohnte Redford noch nicht in Utah. Randy Newman erzählt in seinem Lied von einer Anhörung. Der Delegierte aus Kansas soll bitte sagen, was Kansas denkt und wofür es steht. „Well, Kansas is for the farmer/ We stand behind the little man/ And we need a firehouse in Topeka/ So help us if you can.“ Das also ist Kansas.
Nun sieht der Sprecher den Delegierten von Utah. „I see the delegate from Utah/ Our friendly Beehive State/ How can we help you, Utah? How can we make you great?“ Und der Delegierte spricht: „Well, we gotta irrigate our deserts/ So we can get some things to grow/ And we gotta tell the country about Utah/ Cause nobody seems to know.“
Das Wahrzeichen von Utah ist der Bienenkorb, so wie die Erdnuss das Wahrzeichen von Georgia ist. Robert Redford heiratete eine deutsche Malerin und lebt mit ihr glücklich in einem Holzhaus in den Bergen von Utah. Er gibt einen Katalog heraus, in dem handgefertigte Haushaltswaren beworben werden. Das wäre auch ein Lied wert.
„Breakfast in America“ von Supertramp
Angeblich wurde „Breakfast in America“ aus einer Träumerei heraus geschrieben. Der damals 19-jährige Roger Hodgson stellte sich vor, wie es wohl so sein musste in dem großen Land jenseits des Atlantiks. Eine Träumerei, die vor allem von Fernsehbildern und dem Siegeszug der Beatles 1964 inspiriert war. Auf jeden Fall sollte es dort, den Textzeilen des jungen Briten nach zu urteilen, Unmengen an texanischen Millionären und „California Girls“ geben.
Es dauerte zehn Jahre, bis das Lied schließlich 1979 seinen Weg auf eines der Supertramp-Alben fand und ihm auch den Titel gab. Dass Supertramp immer wieder vorgeworfen wurde, „Breakfast in America“ würde das titelgebende Land von Ost nach West komplett hopsnehmen, schien die Amerikaner selbst nicht zu stören – das Album wurde für Supertramp zum kommerziellen Megaerfolg und die Chartplatzierungen in den USA waren besser als in der Heimat der britischen Band.
Als mein Onkel mir letztes Weihnachten seine „Breakfast in America“-LP vermacht hat, rührte der gleichnamige Song ordentlich an meinem Fernweh. Zwar habe ich wie der Protagonist keine halbgare Freundin, von der ich mal etwas Abwechslung gebrauchen könnte, aber ich bin, wie er, auch noch nie in den USA gewesen. Braucht man überhaupt einen triftigen Grund, um sich in die weichen Arme von Libby, der von Kate Murdagh verkörperten Diner-Kellnerin auf dem Cover, fallenlassen zu wollen? Nein, es ist ganz einfach: „Take a jumbo across the water/ Like to see America.“ Und anders als der Protagonist in dem Lied, der die britischen „Kippers“ vermissen würde, geräucherter Hering mit Spiegelei und Gürkchen, werde ich mit Aussicht auf Pancake-Türme und literweise Ahornsirup mein deutsches Brötchen liegen lassen und in den nächsten Flieger steigen.
„Avalon Blues“ von Mississippi John Hurt
Die meisten denken wohl, wenn sie die Namen „Avalon“ hören und nicht sofort den gleichnamigen Roxy-Music-Song im Ohr haben, an die mythische Insel aus der Artussage, auf die der in der Schlacht von Camlann schwer verwundete König gebracht wurde. Aber das Avalon, das ich meine, gibt es wirklich. Ich kenne es aus einem Song. Geschrieben hat ihn ein 34-jähriger Landarbeiter namens John Hurt im Dezember 1928 in New York City. Wie er in die große Stadt kam, ist eine längere Geschichte:
Einige Monate zuvor hatte mitten in der Nacht sein Freund Willie Narmour, der den Schulbus fuhr und die Fiddle spielte, an die Tür seiner Shotgun Shack (so nannte man im Süden die kleinen schmalen Holzhütten, in denen vor allem schwarze Landarbeiter und Sharecropper lebten) geklopft. Als Hurt öffnete schaute er in die Scheinwerfer eines Automobils. Das gehörte zu zwei Männern, von denen der eine sich als Tommy Rockwell vom Plattenlabel OKeh Records vorstellte und fragte, ob er Mississippi John Hurt sei. Hurt nickte. Und der Fremde fuhr fort, er habe gehört, dass Hurt, sehr gut Gitarre spiele und schön singe. Ob er nicht Lust habe, in Memphis ein paar Lieder für eine Schallplattenveröffentlichung aufzunehmen. Hurt hatte Lust, fuhr im Februar 1928 mit der Bahn die 200 Kilometer gen Norden, um Rockwell und dem Toningenieur Bob Stephens (der zweite Mann, der ihn in Avalon aufgesucht hatte) in der Stadt am Mississippi acht Lieder vorzuspielen, fuhr wieder heim nach Avalon und hörte nichts mehr von dem rätselhaften Mann. Bis er im November einen Brief bekam, in dem Rockwell erklärte, die erste Single sei gut gelaufen, ob er nach New York kommen könne, um weitere Songs aufzunehmen. Hurt traf Rockwell am 19. oder 20. Dezember 1928 in Memphis auf dem Bahnhof. Der drückte ihm 49 Dollar für die Zugfahrt in die Hand und sagte, er könne leider nicht mitfahren. Also machte Hurt sich alleine auf in die riesige Stadt an der Ostküste. Dort angekommen schrieb er völlig überfordert von den vollen lauten Straßenschluchten aus Heimweh an das beschauliche Heimatstädtchen den „Avalon Blues“.
Man erfährt nicht viel über Avalon in diesem Stück. Nur dass es sich um eine kleine Stadt handelt und dass seine „pretty mama“ dort auf ihn wartet. Aber die Sehnsucht, die in Hurts Stimme liegt, hat in mir gleich beim ersten Hören vor fast drei Jahrzehnten den Wunsch ausgelöst, dieses Avalon mal zu besuchen. Ich habe seitdem viel über den Ort gelesen, in dem es mal eine Postation gegeben hat, eine Dorfschule und drei Gemischtwarenläden. 1920 lebten dort etwa 440 Menschen. Die meisten schwarze Landarbeiter, darunter auch Hurts Brüder Cleveland, Junious, Hennis und Jim und seine Schwestern Annie und Ella, aber auch Eisenbahner wie Walter Jackson, von dem Hurt den „Spike Driver Blues“ lernte, der norwegische Schmied C.S. Cristoferson und die Lehrerinnen Florence Liddell und Fannie Sabin. Es kommt mir fast vor, als würde ich sie alle persönlich kennen, obwohl ich nie dort war.
Als ich schließlich vor einigen Jahren im Kino saß und die Dokumentation „American Epic“ meines Freundes Bernard MacMahon schaute, sah ich auf der Leinwand grüne Bäume und Wiesen und staubige Straßen und plötzlich tauchte ein Schriftzug auf: „Avalon, Mississippi“. Zum vertrauten Picking von Mississippi John Hurt erzählte Robert Redford aus dem Off, dass dieser für mich so mythische Ort mittlerweile von der Zeit verschluckt worden war und nur noch ein „abandoned hamlet“ sei, ein verlassener Weiler. Doch die Hütte von John Hurt stand noch. Und davor stand seine Enkelin Mary Frances und erzählte: „Dieses Städtchen hat mal existiert, es war ein richtiger Ort, hier lebten richtige Familien.“ Dann führte sie uns in einen Wald, um den Ort zu zeigen, den ihr Großvater jeden Morgen in aller Frühe aufsuchte, um den Vögeln zu lauschen und die ersten durch die Baumkronen dringenden Sonnenstrahlen einzufangen. An einem Novembermorgen im Jahr 1966 brach er hier zusammen und starb wenig später im Krankenhaus in Grenada/Mississippi. Nun liegt er an seinem Lieblingsort unter den Bäumen begraben. Irgendwann werde ich ihn dort besuchen.