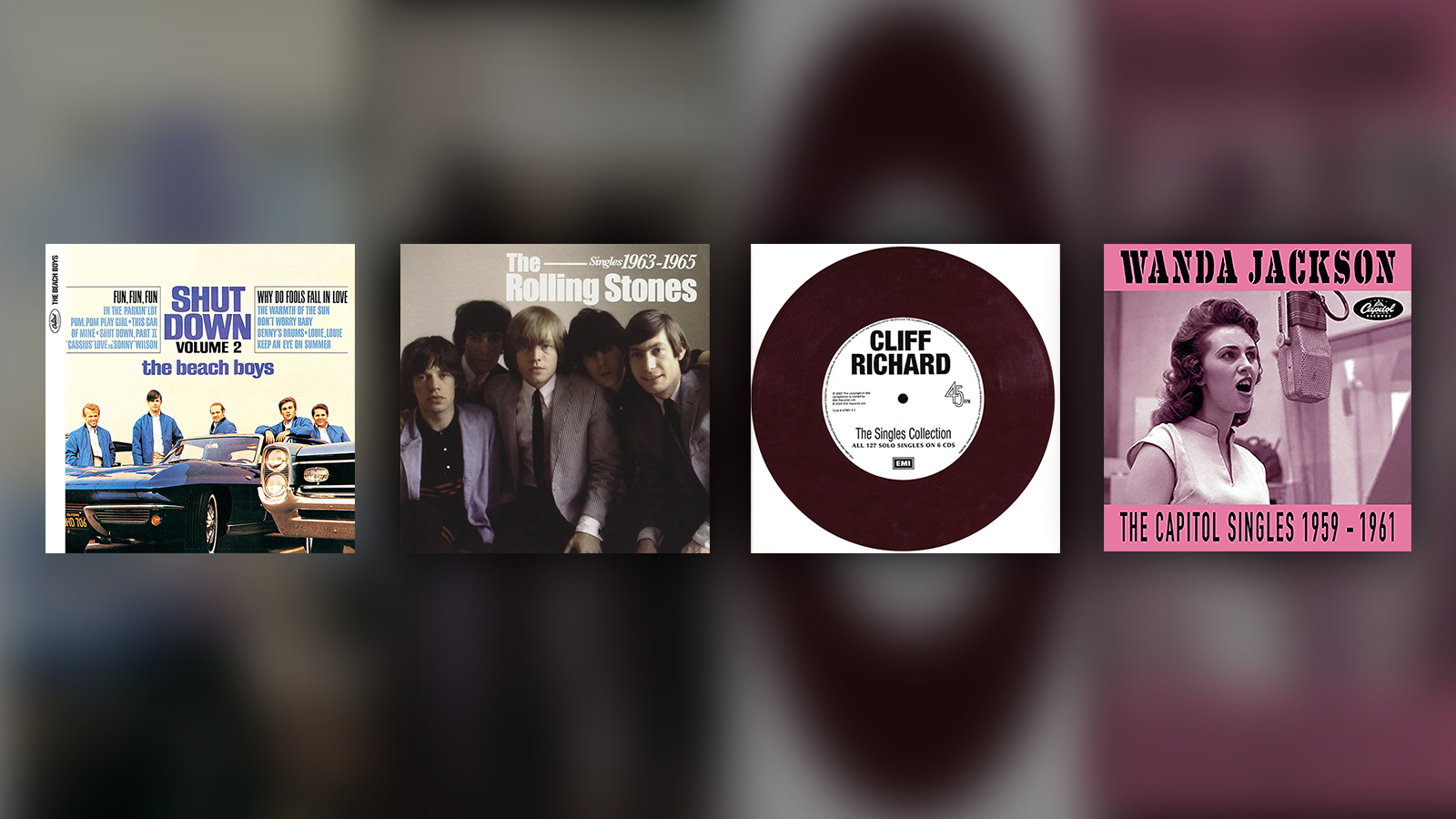„ich fühle mich wie kafka“

Er gilt als der große Verweigerer des Pop, seine Musik als dunkel, für manche gar als unhörbar. Doch Scott Walker fühlt sich missverstanden – und warum lacht denn keiner?
Natürlich trägt Scott Walker eine Schirmmütze. Tief ins Gesicht gezogen. Sie wird sich nach etwa einer halben Stunde langsam heben, sodass man ihm in die Augen schauen kann. So jedenfalls will es eine von vielen Legenden, die den Mann umranken, der einst mit den Walker Brothers als existenzialistischer Posterboy eine Teenie-Hysterie auslöste. Das liegt bald ein halbes Jahrhundert zurück. Eine Bühne hat Walker zuletzt betreten, als er 1995 in der BBC-Show „Later With Jools Holland“ das Klagelied „Rosary“ von seinem Album „Tilt“ zu den kargen Klängen seiner elektrischen Gitarre wimmerte. Halbwüchsige Mädchen haben da nicht mehr gekreischt. Aber die Zeugen dieses Auftrittes dürften vor dem Schlafengehen noch mal zitternd unters Bett geschaut haben.
Für die Musik, die Scott Walker in den letzten drei Jahrzehnten veröffentlicht hat, gilt, was Theodor W. Adorno in einem Essay über Ludwig van Beethoven schrieb: „Die Reife der Spätwerke bedeutender Künstler gleicht nicht der von Früchten. Sie sind gemeinhin nicht rund, sondern durchfurcht, gar zerrissen; sie pflegen der Süße zu entraten und weigern sich herb, stachlig dem bloßen Schmecken.“
Der 69-jährige Walker ist von einem versöhnlichen altersmilden Spätwerk so weit entfernt wie heute sonst nur Bob Dylan. Beide Songwriter haben mit fortgeschrittenem Alter die Katastrophe in den Mittelpunkt ihres Schaffens gestellt. Dylan, der gottesfürchtige Bewohner der amerikanischen Tradition, berichtet davon in der klassischen Form der Ballade. Der als Scott Engel im amerikanischen Westen aufgewachsene, im Londoner Exil lebende Agnostiker Walker dagegen sucht nach einer musikalischen Entsprechung des Schreckens und findet sie in Dissonanz und bruchstückhaftem Erzählen. So zu hören auf dem neuen Werk mit dem anspielungsreichen Titel „Bish Bosch“. Im Vergleich zum Vorgänger, „The Drift“ von 2006, ein fast helles und zudem sehr komisches Album.
Leichte Kost ist das natürlich trotzdem nicht. Die Texte sperren sich gegen eine Interpretation, und die Musik ist nicht weniger fremd. Harmonien und Melodien sucht man meist vergeblich; die Streicher kreischen wie aufgescheuchte Vögel, Fanfaren jubilieren, Macheten werden gewetzt, Antilopenhörner tönen und eine Formulierung aus der unvergessenen Besprechung zu „The Drift“ von Arne Willander („Der zweite Vers wurde doch feuchtes irisierendes Butterbrotpapier gefurzt“) findet tatsächlich eine klangliche Entsprechung.
Erst wenn man den Sound als eine Erweiterung der Wörter begreift, entwickeln sich Bilder und Geschichten: Ein Mann öffnet ein Ei aus dem Atomzeitalter und schaut hinein („Corps De Blah“), ein Barbar fährt gen Himmel („SDSS 1416+13B (Zercon, a Flagpole sitter)“), Widersprüche in der Bibel werden verhandelt („Tar“) und der Begriff des Schmerzes in den „Philosophischen Untersuchungen“ von Ludwig Wittgenstein („Phrasing“). Am Ende steht ein Weihnachtslied, das am 25. Dezember 1989 spielt; dem Tag, an dem der rumänische Diktator Nicolae Ceausescu und seine Frau Elena in Târgoviste hingerichtet wurden („The Day The Conducator Died“).
Man mag Walkers Faszination für Diktatoren und seltsame historische Koinzidenzen wunderlich finden und seine Musik abweisend, er selbst ist nichts von alldem; vielmehr sitze ich im Wohnzimmer seines Managers Charles Negus-Fancey in West-London einem höflichen und humorvollen Mann gegenüber, der um die verstörende Wirkung seiner Kunst weiß und sich zugleich wundert, wie ernst ihn alle nehmen. „Also, was wollen Sie wissen?“, fragt er und schaut mir in die Augen. Sein linker Schneidezahn steht irritierend schief und gibt ihm die Anmutung eines verschreckten Hasen. Auf dem Tisch liegt ein Buch von Albert Camus – „La Peste“.
Auf dem Cover Ihres Albums „Scott 4“ von 1969 steht ein Zitat von Albert Camus: „Das Leben eines Menschen ist ein einziger Versuch, über die Umwege der Kunst wieder die wenigen Minuten wach werden zu lassen …
… in denen sich sein Herz zum ersten Mal öffnete.“ Ja.
Trifft das immer noch zu für Sie?
Ich glaube schon. Das stimmt für jeden, der es ernst meint mit der Kunst.
Und, wie erfolgreich ist das Aufspüren solcher Momente?
Oh, manchmal blitzt so ein Moment auf. Wenn man total in der Arbeit versunken ist und einen der kreative Instinkt an Orte führt, von denen man nicht weiß, wie man jetzt dort hingekommen ist. Jeder, der mal einen längeren Text geschrieben hat, kennt dieses Gefühl. Man kann einfach nicht beschreiben, wie man an einen bestimmten Punkt gekommen ist, wie einem eine bestimmte Sache eingefallen ist. Aber es ist besser, nicht allzu viel darüber zu reden. Es ist unheimlich. Ich habe Angst davor, diesen Prozess zu sehr zu analysieren.
Ist Kunst für Sie ein Versuch, mit anderen Menschen zu kommunizieren?
Ja, klar. Ich möchte zu anderen Leuten Kontakt aufnehmen. Ich lebe nicht in einer hermetisch abgeschlossenen Welt.
Aber es gibt nicht wenige, die genau das über Sie behaupten.
Ich weiß. Die liegen völlig falsch. Sie hören nicht sorgfältig genug hin. Sie schreiben auch, dass all meine Platten von vorne bis hinten schrecklich dunkel und ernst sind. Natürlich gibt es Momente, die so sind, aber es gibt auch Humor und leichte, lyrische Momente. Sonst wäre es ja auch verdammt langweilig.
Der Humor scheint anscheinend nicht für alle gleich offensichtlich.
Das erinnert mich an Kafka, der seinen Freunden immer seine Geschichten vorgelesen hat, und wenn sie nicht gelacht haben, war er stinksauer. So fühle ich mich auch.
Gibt es noch Hoffnung, dass sich das ändert?
Ich glaube schon. Mit jeder Platte scheint die Aufmerksamkeit ein bisschen größer, und es steigt auch die Bereitschaft, sich auf die Musik einzulassen. Gott sei Dank. Wir haben hart dafür gearbeitet.
Werden Sie seit Stephen Kijaks Dokumentation „30 Century Man“, die zur gleichen Zeit wie „The Drift“ erschien, öfter mal auf der Straße erkannt?
Ein bisschen öfter vielleicht, ja. Aber nicht dramatisch. Ab und zu erkennt mich ein Student oder so und sagt mir, dass er meine Musik mag.
Und das war’s?
Manchmal wollen sie noch meine Hand schütteln. (hebt seine Rechte und lacht)
Als Sie vor sechs Jahren Ihr Album, „The Drift“, vorstellten, haben Sie versprochen, danach ein weniger komplexes Werk aufzunehmen, mit dem Sie auch auf Tour gehen können. Ihr neues Album „Bish Bosch“ können Sie da aber nicht gemeint haben, oder?
Um Gottes willen, nein! Aber ich fange jedes Mal mit der Absicht an, es etwas einfacher zu halten. Und dann setzt meine Imagination ein, und alles ist zu spät. Das Biest lässt sich dann nicht mehr in die Richtung zerren, in der ich es haben will – oder sollte ich besser sagen: in der sie es haben wollen?
Wer sind „sie“?
Alle eigentlich. Das Management, die Plattenfirma … Aber ich kann es nicht kontrollieren. Ich muss mich entscheiden: record or live.
Immerhin sind Sie sehr viel schneller geworden – dieses Mal haben Sie für ein neues Album nur sechs Jahre gebraucht, nicht elf wie beim letzten Mal. Ich musste sehr lachen, als ich den Albumtitel las. Das ist wirklich bish-bosh (dt. etwa ratzfatz).
(lacht) So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber das ist eine gute Erklärung des Albumtitels, die werde ich mir zu eigen machen. Für mich ging es dieses Mal tatsächlich in Lichtgeschwindigkeit voran. Ich hab das Album in etwas mehr als einem Jahr geschrieben. Das Problem kam erst, als ich es aufnehmen wollte. Es hätte acht Wochen dauern sollen, es wurden dann aber zwei Jahre. Erst konnten wir nicht alle Musiker bekommen, die wir wollten, dann starb der Vater meines Freundes und Co-Produzenten Pete Walsh, dann kam ein Auftrag des Royal Opera House für eine Ballettmusik, dann war das Studio nicht frei, und wir konnten immer nur zwei, drei Tage am Stück aufnehmen. Ich wäre fast verrückt geworden. War also ein bisschen ambitioniert, zu glauben, das ginge alles bish bosh.
Sie hören sich Ihre Platten ja nach der Fertigstellung nicht noch einmal an, da frage ich mich …
Wenn Sie so lange daran gearbeitet hätten wie ich (lacht, hustet), würden Sie sich’s auch nicht noch mal anhören. Schreiben, skizzieren, Sounds suchen, ins Studio gehen, alles erklären, die Musiker belästigen – das sind mehrere Jahre Arbeit. Danach braucht man eine Pause. Jahre später kann man vielleicht noch einmal zurückkehren, auch wenn ich das keinem raten würde – man findet nur Fehler. Sollen doch die anderen durch die Hölle gehen, ich bin vor ihnen gegangen.
Aus welchem Grund tun Sie sich das denn überhaupt alles an?
Ich liebe die Vorstellung, dass man etwas ausprobieren und seine Ideen umsetzen kann. Man setzt da etwas zusammen, das noch niemand vorher gehört hat. Das verschafft Befriedigung. Man weiß nicht, ob es am Ende gut ist, weil man in neues Gebiet vorgedrungen ist und der Einzige ist, der es beurteilen kann. Aber ab und zu kommt jemand vorbei, dem es auch gefällt.
Der Reiz des Neuen ist entscheidend?
Definitiv. Wenn ich etwas höre, das ich schon kenne, stört mich das. Ich hatte neulich eine Diskussion mit einem Freund, der sagte über einen Künstler – ich sage nicht, über wen: „Ich mag ihn. Er schreibt zwar ziemlich gewöhnliche Melodien, aber die Texte sind echt gut.“ Das funktioniert bei mir nicht. Selbst, wenn man nicht auf die Bedeutung hört, muss es interessant klingen. Die Texte sind bei mir zwar auch zentral, aber da ist hoffentlich auch auf musikalischer Ebene etwas, das überraschender ist als Da-Daaa-Dada (das ist das Riff von Muddy Waters‘ „Mannish Boy“, das Bob Dylan jüngst für seinen Song „The Early Roman Kings“ recycelte; auch im Interview muss man bei Walker Text und Ton zusammendenken, Anm. d. A.).
Das ist halt ein anderer Ansatz – aus der Tradition heraus zu singen.
Klar. Ich weiß natürlich, die Leute sagen: „Das ist seine Version des Songs“ und so weiter. Aber allmählich reicht es auch mal – immer dieselben verdammten Akkorde. Das gilt ja nicht nur für den Blues, sondern auch für Folk oder Country. Wenn man nur ein Leben hat, warum soll man verdammt noch mal immer so weitermachen? Vielleicht bin ich da ein bisschen hochnäsig.
Gibt es Künstler, denen Sie sich nahe fühlen?
Ich kenne niemanden, der einen ähnlichen Stil hat, aber es gibt Künstler, die ein ähnliches Gefühl vermitteln und ein ähnliches – ein doofes Wort – Bekenntnis zum Experiment abgeben. Complicité etwa, die Theatergruppe von Simon McBurney. Das anzuschauen ist für mich wie nach Hause kommen.
Complicité stehen für ein sehr körperliches Spiel. Der Körper steht seit einiger Zeit auch im Mittelpunkt Ihres Werkes – auf den letzten drei Alben und natürlich in Ihren Arbeiten fürs Ballett.
Richtig. Auch wenn Songs und Ballettmusik sich für mich nicht vermischen. Das sind verschiedene Dinge, aber die Arbeit fürs Ballett hat sicher Auswirkungen auf meine Technik als Songwriter. In der Ballettmusik interessiert mich, wie wir die Welt in unserer Wahrnehmung aufgrund der Form unserer Körper in Stücke schneiden – und die Bewegung von Körpern im Raum.
Der niederländische Maler Hieronymus Bosch, auf den der Albumtitel „Bish Bosch“ anspielt, hat sich auch viel mit der Darstellung des Körpers beschäftigt.
Stimmt, aber das ist Zufall. Ich habe den Namen Bosch tatsächlich nur verwendet, weil ich dieses Wortspiel mochte.
Ihre Musik wird allerdings sehr oft mit Gemälden verglichen. Mit denen von Francis Bacon zum Beispiel.
Es gibt sicher ein visuelles Element in meiner Kunst. Aber ich denke da eher an Film, ich inszeniere meine Musik filmisch, nicht wie ein Gemälde. Der Text ist wie ein Drehbuch, da steht bereits alles drin, ich muss nur noch die Sounds dafür finden.
Beim letzten Mal haben Sie ein Stück Schweinefleisch als Perkussionsinstrument benutzt, dieses Mal das Horn einer Kudu-Antilope.
Ich wollte einen ur- oder altertümlichen Sound für diesen Song haben. Mir ist erst später bewusst geworden, wie ich da auf dieses Horn, man nennt es Schofarhorn, kam. Jerry Goldsmith hat das in seiner Filmmusik für „Planet der Affen“ eingesetzt. Er hatte allerdings nur ein Horn, ich habe gleich sechs! (lacht) Sie tauchen immer auf, wenn der Protagonist in dem Song, eine Art Zeitreisender, an sein Leben im Altertum denkt.
Der Protagonist heißt Zercon, er ist ein maurischer, zwergenhafter Hofnarr am Hof von Attila, dem Hunnenkönig …
Genau. Ich hatte die Idee, dass er sich seine Flucht vorstellt. In diesem Fall ist es keine Flucht nach vorn, sondern eine in die Höhe. Zunächst stellt er sich vor, er wäre ein metaphysischer Vogel, dann der heilige Symeon Stylites, der auf eine Säule floh, um Askese zu üben, dann ein Pfahlsitzer auf einem Fahnenmast, wie sie in den USA der 30er-Jahre populär waren. Das war übrigens der erste Song, den ich für „Bish Bosch“ schrieb und ich wusste, wenn ich ihn fertig habe, ist der Rest des Albums kein Problem mehr. Aber mir fiel kein Ende ein. Und dann las ich in der Zeitung, dass Wissenschaftler den kältesten substellaren Himmelskörper entdeckt hatten, sie nannten ihn brown dwarf – brauner Zwerg, und ich dachte: Das ist es, das ist das Ende des Songs.
Eine Himmelfahrt. Space is the place.
Kann man so sagen. Aber nicht in einem theologischen Sinn. Zercon wird ein brauner Zwerg, er friert und stirbt. Eine missglückte Himmelfahrt sozusagen. Die meisten meiner Lieder enden ja im Versagen.
Gilles Deleuze hat mal über Francis Bacon geschrieben, der Sex und die Ausscheidungen in seinen Bildern seien der Versuch eines Körpers, durch seine eigenen Organe heraus zu fliehen und sich mit dem Feld der Materie zu vereinen. Das findet man in diesem und in anderen Stücken auf „Bish Bosch“ wieder. Da geht’s ja dauernd um Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen – um Verflüchtigungen sozusagen.
Wir sind alle auf eine Weise gefangen. Bresson beschreibt das in all seinen Filmen. Er ist allerdings ein religiöser Filmemacher. Zercon ist sich die ganze Zeit über seines Körpers bewusst, er will ihn nicht ablegen, er will nicht in den Himmel. Und ich bin auch kein religiöser Mensch. Auch wenn es etwa in einem Song wie „Tar“ um eine religiös motivierte Argumentation geht.
Um noch ein drittes Mal auf den Albumtitel zurückzukommen. „Bish“ ist ja das niederländische Wort für bitch – Schlampe, Hure. „Bish Bosch“, haben Sie gesagt, sei für Sie der Name einer mythologischen, allumfassenden Künstlerin -eine Schöpfergestalt sozusagen.
Ja, ich glaube, dass wir, wenn Frauen das Sagen hätten, nicht so viel Ärger hätten wie jetzt. Einfach, weil sie dem Schöpfungsprozess näherstehen.
Das klingt fast wie eine feministische Theorie von Antony Hegarty von Antony & The Johnsons …
Ja, wobei er da einen spirituellen Ansatz wählt, der mir vollkommen fremd ist. Ich bin ein Suchender, und ich habe noch nichts gefunden. (lacht)
Sie betonen ausdrücklich, Ihre Songs seien nicht autobiografisch. Erkennen Sie sich trotzdem darin wieder?
Natürlich offenbart sich auch bei Künstlern, die nicht explizit über ihr Leben schreiben, ihr Charakter im jeweiligen Stil. Das kann man über ihre ganze Karriere hinweg verfolgen.
Sehen Sie diese Kontinuität in Ihrem eigenen Werk auch?
Ich glaube, wir haben einen Stil entwickelt, aus dem heraus wir arbeiten. Das begann vermutlich mit dem letzten Album der Walkers Brothers, „Nite Flights“. Dort haben Pete (Walsh, seit „Climate Of Hunter“ von 1984 Walkers Co-Produzent) und ich dann ein Zuhause gefunden. Wenn ich diesen Stil oder diesen Sound beschreiben müsste, würde ich sagen, es ist das akustische Äquivalent zu den Zeichnungen, die HR Giger für „Alien“ gemacht hat. So klingt das für mich.
Jetzt haben Sie im Jahr 1978 angefangen. Was ist mit den Alben aus den späten Sechzigern?
Die meisten Leute hören einen radikalen Bruch zwischen den frühen und den späten Sachen. Es ist sogar so, dass die meisten Leute, die meine Musik aus den Sechzigern mögen, meine späteren Sachen hassen. Ich habe jetzt ein ganz anderes Publikum.
Aber Sie arbeiten eigentlich immer noch mit ähnlichen musikalischen Mitteln. Es scheint mir, als spielten Sie mit den Konventionen, derer Sie sich in den Sechzigern bedient haben. Es gibt einen Moment in „Zercon“, da singen Sie: „And if I’m melancholic/ And if I shed a tear …“ Das klingt wieder wie früher!
Wirklich? (überlegt) Ich fürchte, Sie haben recht. Aber das war unbewusst.
Da ist von Melancholie die Rede. Würden Sie Ihre Musik als melancholisch bezeichnen?
Heute? Nein, ich glaube nicht. Sie ist vielschichtig. Und Humor spielt eine wichtige Rolle. Aber ich würde nicht sagen, dass sie sentimental oder melancholisch ist. Als junger Mann habe ich anders gearbeitet als heute. Ich habe viel getrunken und dann Text und Melodie gleichzeitig geschrieben. Ziemlich schnell. Und durch das Trinken kam die Melancholie.
Ohne Alkohol gibt es also keine Melancholie. Dafür mehr Scott?
Wir kommen meinem Charakter immer näher. Man muss die richtigen Leute finden, um das musikalisch zu definieren und umzusetzen. Auf den letzten drei Alben ist das sehr gut gelungen. Und wir haben uns in diesem Stil eingerichtet. Es ist ein bisschen wie der Spätstil von Beckett – all seine Stücke haben im Grunde die gleiche Atmosphäre, es gibt nur noch minimale Veränderungen.
Juckt es Sie nie in den Fingern, mal wieder Lieder mit traditionellen Akkorden und Harmonien zu schreiben. So wie früher. Nur aus Spaß?
(entrüstet: ) Aus Spaß schreiben? (lacht sich kaputt) Ich schreibe nur aus Spaß. Spaß ist mein zweiter Vorname. Aber, nein, ehrlich: Es ist ein großer Spaß, wenn es gut läuft. Und ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt, etwas wie „Zercon“ zu schreiben. Das war große Unterhaltung für mich.
Scott 13
Chanson, Country, Kunstlied – der Weg zu „Bish Bosch“
Scott 1967 ★★★★1/2
Vor allem der Einfluss von Jacques Brel bestimmte diese melodramatischen Chansons. Walker coverte drei Songs seines Vorbilds und schuf selbst drei ebenbürtige Stücke.
Scott 2 1968 ★★★★
Das Konzept des Debüts wurde beibehalten und um eine Prise Sexyness ergänzt. Die eigenen Stücke sind nicht ganz so stark, dafür gibt es eine tolle Version von Bacharach/Davids „Windows Of The World“.
Scott 3 1969 ★★★★1/2
Die obligatorischen drei Brel-Songs gibt es dieses Mal als Nachklapp, davor zehn dunkle Walker-Originale. Die Arrangements sind sublimer als auf den Vorgängern, orientieren sich an Debussy und Satie.
… Sings Songs From His TV Series 1969 ★★★
Standards von Rodgers, Hammerstein, Kern, Jobim und Weill, die Walker in seiner sechsteiligen BBC-Serie „Scott“ interpretierte. Der Sänger war ein Top-Ten-Act, die Plattenfirma nutzte es aus.
Scott 4 1969 ★★★★★
Unter seinem bürgerlichen Namen Scott Engel veröffentlicht, kommerziell ein Flop, künstlerisch ein Triumph. Walker ist in diesen zehn intensiven Songs als Songwriter auf dem Gipfel seiner Kunst.
‚Til The Band Comes In 1970 ★★★
Nach dem Flop „Scott 4“ schrieb Walker die gefälligen Songs des Nachfolgers mit seinem Manager (!) Ady Semel. Ein Lied singt Esther Ofarim, am Ende gibt Walker den urbanen Countrysänger.
The Moviegoer 1972 ★★1/2
Walker covert Songs großer Filmkomponisten wie Michel Legrand, Henry Mancini, Nino Rota und Lalo Schifrin. Die Arrangements sind bieder, der Gesang ist eher halbherzig.
Any Day Now 1973 ★★
Ein weiteres Album, das Walker wohl nur aufnahm, um seine junge Familie zu ernähren. Middle-of-the-Road-Pop, uninspiriert vorgetragen. Caetano Velosos „Maria Bethania“ gerät besonders peinigend.
Stretch 1973 ★★★
Schon auf „‚Til The Band Comes In“ hatte Walker sich als Countrysänger versucht, nun covert der Wahllondoner Mickey Newbury, Tom T. Hall und Jimmy Webb und wirkt dabei recht überzeugend.
We Had It All 1974 ★★1/2
Country, die zweite, mit gleich vier Songs von Billy Joe Shaver, für die Walker sich tatsächlich einen Twang zulegt. Ein bisschen befremdlich, aber man kann ein letztes Mal mitpfeifen.
Climate Of Hunter 1984 ★★★★1/2
Walkers Beiträge zum letzten Walker-Brothers-Album „Nite Flights“ (1978) dienten als Blaupause für „Climate Of Hunter“. Die Songs sind abstrakter, der Bariton wirkt brüchig. Der lange Tag reist in die Nacht.
Tilt 1995 ★★★★★
Ab hier kommt man mit den Mitteln der Popkritik nicht mehr weiter. Ersetzen Sie die Sterne durch schwarze Löcher. „Tilt“ ist die Geburt des grotesk-monströsen Kunstliedes, ein Welttheater in neun Akten. The Drift 2006 ★★★★★
Einzig die an Angelo Badalamenti erinnernden Streicher bieten etwas Linderung in dieser expressionistischen Sinfonie des Grauens. Walker zwischen F. W. Murnau und David Lynch.