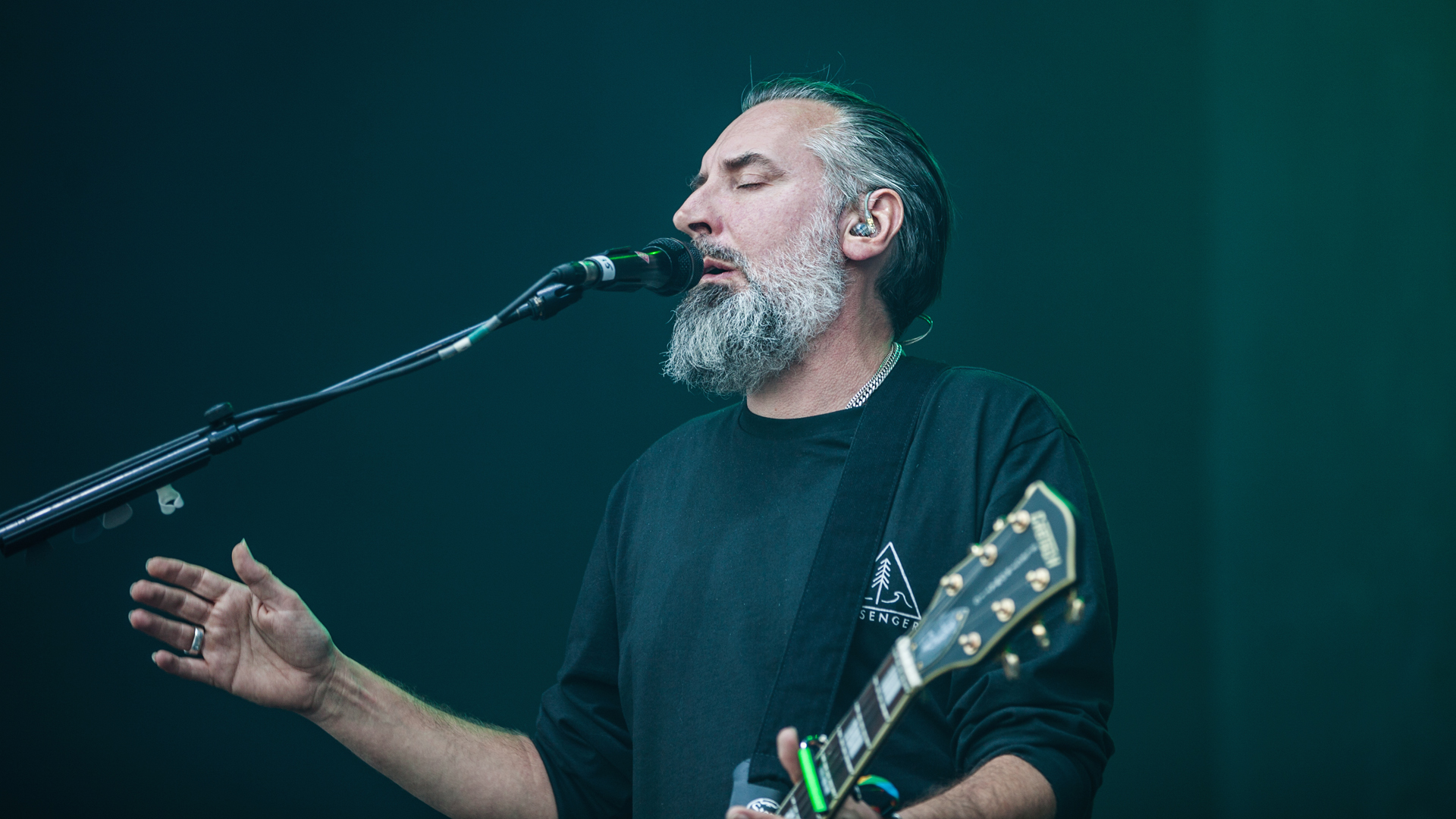Hurricane 2011: Schatzis im Regen. So war der Sonntag
Bei strahlend grauem Himmel, freundlich an den Knochen nagendem Wind und herzallerliebstem Dauerregen ging das Hurricane zu Ende. Daniel Koch berichtet nass und zufrieden vom letzten Tag.
Man muss dieses Wort einfach in die Welt schreiben – aber man muss es eigentlich auch mal aus dem Munde des Eels-Masterminds Mark Oliver Everett gehört haben: Wie er sich während des furiosen Blues-Rock-Sets (ja genau – die Eels sind wohl gerade in dieser Phase) seiner Band beim Publikum bedankte und wieder mal: „Danke, meine Schatzis“ rief – das wärmte einem trotz nasser Klamotten am Leib dann doch das Herz. Vor allem, weil andere Künstler ja zumeist ihr Publikum eher anschreien. Dave Grohl ist da bereits seit Jahren gut drin. „Do you wanna go home!“, kreischte Grohl zum Beispiel mit geschundener Stimme am Sonntag auf der Hauptbühne in Scheeßel – und die Menge brüllte zurück: „NOOOOOOO!“
Nur eine halbe Stunde später sah man dann allerdings auf den matschigen Wegen und Seitenstraßen, dass viele ab dem letzten Akkord ein lautes „Yes“ gebrüllt hätten.
„Yeah, now I know why they call this festival Hurricane“ – wieder Mark Oliver Everett. In der Tat: Der Sonntag dürfte vielerorts für einen verfrühten Festivalblues gesorgt haben. Der Tag wurde von fiesen Regenfällen und einem bissigen Wind geprägt, der sich dann pünktlich am Montagmorgen verzog. Als wollte Petrus all den Festivalschatzis noch mal kräftig in die Suppe spucken. Die beste Gegenwehr: Trotz. Als bei den Irish-Folk-Punks aus L.A. Flogging Molly ein reiner Wasserschwall vom Himmel fiel wurden die einzelnen Tanz- und Moshpits noch größer – könnte aber auch amschweißtreibenden „Requiem For A Dying Song“ gelegen haben. Zu dem Zeitpunkt reicht die Schlange zum vorderen Bühnenbereich der Green Stage übrigens schon vom Eingang bis zu einer Biertheke hinter dem FOH. Was ziemlich deutlich zeigte, wer an dem Abend der Platzhirsch war – die Foo Fighters nämlich.
Dave Grohl und seine Herren lieferten dann auch wieder einmal dass, was ihr Publikum erwartet: Obwohl die Foo Fighters ja geradezu kultisch verehrt werden, war Grohl hemdsärmelig, charmant und energiegeladen wie stets – was einem in Momenten des Zweifels die Frage aufkommen lässt, ob das denn auch überhaupt noch echt sein kann. Musikalisch stehen die Zeichen bei ihnen bekanntlich längst wieder auf „ROCK“ – spätestens seit „Wasting Light“ eine Offensichtlichkeit. Zu einer Lightshow, die auf riesige Richtscheinwerfer setzte, eröffnete Grohl das fast zweistündige Set mit der Zeile: „These are my famous last words!“ und dem wuchtigen „Bridge Burning“. Die Foo Fighters zeigten sich von Anfang bis Ende perfekt eingespielt, dann muss man feststellen, dass ihr virtuoses Spiel oft in gniedelnde Rumgemucke zerfasert – und man sich bei all den Solis fragt, ob da am Ende mal Progrock stehen wird. Aber auf ihre kraftvollsten Songs ist eben nach wie vor Verlass: Schön, wenn’s dann zwischendurch auch mal ruhiger wird und man mit „Everlong“ eine ganz andere, vielleicht für viele die beste Phase der Band, ausleuchten.
Nicht so leicht hatten es zuvor die Arctic Monkeys auf der Hauptbühne. Dabei waren sie mit grandioser Laune angereist. Alex Turner zeigte sich im Videointerview mit unserem Magazin gar lachend. Auch ihre Setlist war auf bespaßungswütiges Festivalpublikum gemünzt: „When The Sun Goes Down“, „Fluorescent Adolescent“ und „I Bet You Look Good On The Dancefloor“. Alte Songs und eigentlich sichere Bänke, die aber selten so zündeten, wie sie es verdient hätten. Auch ihr Abschluss war zwar gelungen von der Bühne gebracht und durchaus ungewöhnlich, passte aber nicht so recht für einen Auftritt dieser Art: Sie spielten, in Begleitung von Miles Kane, „505“ – vielleicht einer der besten, aber eben auch der ruhigsten Songs aus dem Bandoeuvre. Das Publikum dankte es kaum – wollte lieber von den Hives bespaßt werden, die seit Jahren ihre Festivalroutine abspulen und dabei immer recht entertaining sind. Auch wenn man oft denkt: „This joke ain’t funny anymore.“ Per Almqvists „Mir scheint die Sonne aus dem Hintern“-Attitüde bleibt dennoch ansteckend.
Aber wo man gerade von Miles Kane sprach: Der talentierte junge Herr, den man von seiner Zusammenarbeit mit Alex Turner bei The Last Shadow Puppets kennen sollte, hat es ja manchmal nicht so leicht: Erst wurde sein rundweg tolles Solodebüt, bei dem Noel Gallagher mitwirkte, von uns beinahe übersehen (was Kollege Willander mit einer kleinen Lobeshymne in seinem Videoblog wieder gut machte), dann ließ Petrus seinen Hurricane-Auftritt am frühen Nachmittag platzen. Da die Blue Stage aufgrund massiver Regenfälle nicht bespielbar war, griff sich Kane seine Akustikgitarre, schlenderte durch das Publikum bis zum FOH-Turm und spielte davor drei Lieder. Am Ende hatte er dort rund 80 johlende Fans um sich geschart, die soviel Nähe mit lautem Jubel quittierten. Die SMS einer Freundin traf die Sache ganz gut: „Komm ran zu DEM Festivalmoment: Miles Kane auf dem Soundturm zur Blue Stage!“ Auf selber Bühne sorgte später Clueso für einen eher poppigen Abschluss, während zuvor The Wombats und The Subways ihre Heimspiele zelebrierten. Man hat ja fast das Gefühl, beide Acts seien in Deutschland viel geschätzter als in ihrer Heimat – die Reaktionen an diesem Sonntag unterstrichen dies. Clueso dann mit perfekter Light-Show, riesiger Leinwand im Rücken, gut eingespielter Band – aber ein wenig selbstverliebt hier und da. Vor seinem eigenen Video zu spielen sollte man nur machen, wenn es wie im Falle von Arcade Fire ein Kurzfilm ist, in dem die Band nicht zu sehen ist. Wenn man wie Clueso im Clip von „Zu schnell vorbei“ sich selbst beim Durch-die-große-weite-Welt-Joggen filmen lässt und das dann auch noch beim Von-der-Bühne-spielen hinter sich projeziert – dann ist das vielleicht doch ein wenig too much. Man weiß doch inzwischen, dass ihn viele für einen Süßen halten. Reicht dann auch mal…
Das beste zuletzt: Bevor die Klaxons später am Abend einen unerwartet stattlichen Abschluss besorgten und nachdem Glatzenbart-Melancholiker Fitzsimmons auf Deutsch über die Größe seines „Schwanzes“ scherzte, sah man wieder mal auf der Red Stage die besten Konzerte des Tages: Als da wären The Kills, bei denen man mit jedem neuen Album erwartet, dass sich ihr Konzept, ihre Boy-Girl-Spannung, ihre minimalistisch aufgebauten oft schepprigen Songs abnutzen – und dann stehen Jamie Hince und Alison Mosshart gemeinsam auf der Bühne und knistern förmlich vor Energie. Wie Hince seine Gitarre bearbeitet, dabei immer wieder Mosshart anscharwenzelt und wie diese bebend, zuckend über die Bühne irrlichtert und so herrlich fucked-up und wunderschön ins Mikro zweifelt und wettert – das ist schon ganz schön „Wow“. Selbst die Songs von „Blood Pressures“ funktionieren: „Satellite“, „Heart Is A Beating Drum“, das rauchige „The Last Goodbye“ – die Live-Darbietungen und das elektrisierte Publikum beweisen, dass dieses Album tatsächlich so gut ist, wie alle schreiben. Die Darbietung von „Kissy Kissy“ hätte dann wohl jeder, der dort war, gerne auf Band. Hince und Mosshart spielen dabei beide auf der Gitarre, Hince anfangs von einer Verstärkerbox nach unten schauend, ganz als wisse er, wie hypnotisierend das klingt, was er da spielt. Und dann das Duett der beiden: „It’s been a long time coming / It’s been a long time coming
I’m gonna stab your kissy, kissy mouth / It’s been a long time coming“. Es braucht nicht mehr, als diese mantra-artig wiederholten Zeilen. Ein Bühnenbild für die Ewigkeit: Jamie Hince hällt die Gitarre wie ein Scharfschütze, „zielt“ auf Mossharts hübsches Gesicht – und die singt, trotzig, lasziv mit bohrendem Blick auf Hince: „I’m gonna stab your kissy kissy mouth.“ Zwei Dinge, die man dabei so denkt: „Ist das die Frau, die mir im Interview erzählte, sie hätte sich bei ihrem allerersten Bühnenauftritt hinter einer Box versteckt?“ Und: „Was denkt eigentlich Frau Moss, wenn sie so was sieht?“
Zum Schluss zurück zu den „Schatzis“, die sich vor den Eels versammelt hatten: Allzuviele waren es nicht, weil das Zelt nun mal nicht so viele Menschen fasst, aber so eine gute, überraschende Unterhaltung, die auf dem Hurricane eigentlich völlig fehl am Platze ist, hat vielleicht nicht jeder erwartet. Bei den Eels weiß man ja eh nie, was man kriegt, wenn man sie live sieht, aber eine Band, die drei Gitarren und zudem noch Saxofonist und Trompeter aufbietet hätte man vielleicht nicht erwartet. So schwelgte Everett diesmal in einem vollen, süffigen Sound aus Blues und Soul und gab „Flyswatter“, „Prizefighter“ und „My Beloved Monster“ schon wieder einen neuen Anstrich. Zwischendurch moderierte Mr. E die Songrevue mit seinen „Schatzis“ und mit unterhaltsamen Ansagen – zum Beispiel als er die Band vorstellte und sich dabei krude Fantasienamen ausdachte. Sein zweiter Gitarrist wurde dabei mit folgenden Worten vorgestellt: „Accordings to his Wikipedia page he has been playing with me and some other people.“ Heartbreaker of the day wurde „Fresh Feeling“, das einem schon in dem Moment das Herz brach, als die Bläser den Streicherpart des Originals intonierten: „Words can’t be that strong / My heart is reeling / This is that fresh / That fresh feeling.“ So ist es – und genauso fühlt man sich: Trotz Regen, wenig Schlaf, frühmorgendlicher Arbeit und dem Auftritt der grässlichen Sick Puppies: „This is that fresh feeling“. Der Festivalblues kann zuhause bleiben…
Weitere Artikel:
Übersichtsseite Hurricane 2011: Hier finden Sie alle Berichte, Blogs, Fotos, News, Interviews. Parallelgesellschaften: So war der Samstag. Beth Gibbons Lächeln: So war der Freitag.