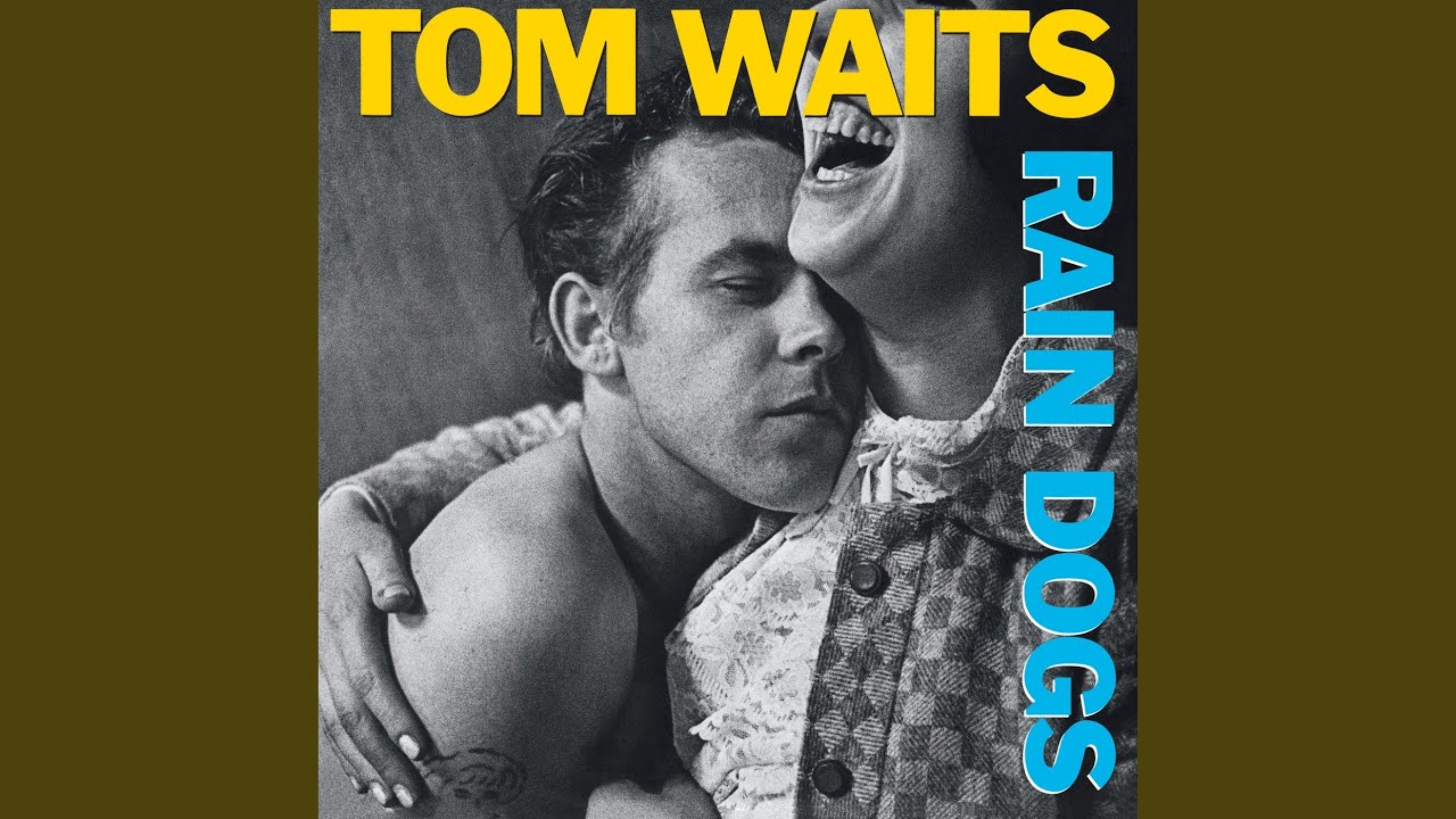Hinter der Bühne des Lebens
Der Verzicht auf das Piano ist nur eine kleine Veränderung im statischen Kosmos des Tom Waits - ein indirekter Kommentar zum Golfkrieg schon eine bedeutendere. Der Mann, der nun seit 30 Jahren stoisch über Einsamkeit- und Trunksucht und die zugigen Ecken nicht nur Amerikas singt, hat sich in seinem skurrilen kalifornischen Familien-Idyll gemütlich eingerichtet.

Stünde es nicht schon da, man hätte das „Little Amsterdam“ als Location für ein Interview mit Tom Waits bauen müssen. Quietschende Fensterläden, schäbiges Mobiliar, skurrile Gäste – die Bar im kalifornischen Niemandsland zwischen den Kleinstädten Petaluma und Santa Rosa ist genau die Kulisse, die man zumindest dem Klischee nach von Waits erwartet. Waits, dem Gossenpoet, Waits, dem Underdog, dem Freund von Freaks und Außenseitern. Zumal das „Little Amsterdam“ und sein Besitzer, der Holländer Evert Winkelmann, Geschichte haben: Vor 30Jahren baute Verpackungskünstler Christo aus Gründen der Kultur in dieser Gegend einen 40 Kilometer langen Zaun, der genau durch Everts Hintergarten führte. Christos Hubschrauber luden hier Bauteile und VIPs ab, und noch heute zeugt ein handsignierter Fotoband von dem glorreichen Moment Das Buch ist allerdings von Fettwasser ganz vergilbt, da Evert es seit Jahren direkt neben dem Nudeltopf aufbewahrt. Auch Evert ist im Moment in keinem guten Zustand – vor kurzer Zeit ist ihm die mexikanische Frau weggelaufen, weshalb er ihren Namen auf allen Visitenkarten dick durch gestrichen hat. Wie er da so steht, die Arme auf die Bar gestützt, mit Geschirrtuch über der Schulter und traurig zahnlosem Lächeln im Gesicht, das hat schon so eine universelle Tragik. Auch im besagten Hintergarten, mittlerweile ein Trailerpark für mexikanische Landarbeiter, vermutet man jene Charaktere und Geschichten, die Waits‘ Songs von Anfang an bevölkerten.
Doch wie so oft im Werk des Tom Waits ist die Wahl des Ortes nur scheinbar eine Inszenierung; Waits wohnt ganz in der Nähe und macht auf dem Weg nach Hause im „Little Amsterdam“ des Öfteren halt. Zwei hinter den Thekenspiegel gezwängte, wiederum handsignierte Pressefotos belegen das offenbar recht freundschaftliche Verhältnis zwischen Waits und dem Wirt.
Waits steht in der Tür, mürrisch palavernd mit zwei, drei Einheimischen, und man nimmt ihn zunächst gar nicht wahr. Mehr noch als die verwaschene schwarze Jeanskluft und der kleine Wuchs ist es die leicht kauernde Haltung, die Waits wie einen wirken lässt, der gern verschwinden würde. Was angesichts seiner Aufgabe – die Gespräche zum neuen Album „Real Gone“ – den Nagel wohl auf den Kopf trifft.
Das Gespräch ist zunächst entsprechend schwierig. Waits schnaubt und brummelt, nestelt an seiner Teetasse und beobachtet sein Gegenüber aus kleinen, gleichzeitig leicht misstrauisch und unsicher blickenden Augen. Man kennt das von anderen Chronisten: Tom Waits ist einer, der in unnatürlichen Situationen wieder des Interviews ein bisschen Anlauf braucht, bevor eine Verbindung gelingt. Und so beendet er das erste Abtasten bald mit einer Gegenfrage, sichtlich froh über die Eigeninitiative. Wie ich die neue Platte fände und wie man sie wohl einem anderen beschreiben könne, will er wissen. Ich versuch’s mal: roh, knöchern, ungehobelt, irgendwie archaisch. Ein bisschen „Bone Machine“. „Roh, ja so wollten wir es haben“, sagt Waits mit der düster knarrenden Stimme, die man sich erhofft, „alles, was du wissen willst, ist ja, ob du auf der Platte was eingefangen hast, was noch am Leben ist. Nicht so, als hätte man die Toten fotografiert. Folglich haben wir es so gemacht, dass du die Pfirsiche riechen kannst und das Benzin und das Popcorn und die Hunde. Etwas Wildes, Fleischliches.“
Dass Waits mit seiner jüngsten Platte auf die vorherigen reagieren und etwas moderat Neues versuchen würde, war abzusehen. So war es 1983 gewesen, als er – freilich radikaler – mit „Swordfishtrombones“ die zweite Ära seines Schaffens einläutete. Und 1992, als das Album „Bone Machine“ vorerst Schluss machte mit Theaterpose, Kirmesmusik und Weillscher Ästhetik. Als Waits nun im letzten Jahr die Arbeit an „Real Gone“ begann, hatte er wieder drei musikalisch nicht unähnliche Alben im Rücken, die obendrein allesamt in der für Waits unliebsamen, weil klinischen Atmosphäre eines herkömmlichen Tonstudios entstanden waren: „Mule Variations“ (1999) sowie die Theaternachlesen „Blood Money“ und „Alice“ (2002), beides Aufnahmen von Musik, die Waits im Lauf der Neunziger für zwei Theaterstücke von Robert Wilson komponiert hatte. „Ich mache immer dann eine neue Platte, wenn ich nirgendwo finde, was ich gerade hören will“, konstatiert Waits, „ich gehe zu meinem Plattenladen und frage: Hey, was hast du für mich? Irgendwas Neues?
Die neue Box von Muddy Waters?
Hab ich schon, Mann, hab ich doch schon.
Die Platte von den Yeah Yeah Yeahs?
Okay, die versuch ich mal. Irgendwann klappt das nicht mehr. Dann muss ich’s selbst machen. Das ist so, wie wenn man essen gehen will, aber alle Restaurants sind zu. Dann gehst du nach Hause und machst dir dein Abendbrot selber.
Das ist sowieso viel spannender; es gibt Dinge, die ich über die Küche weiß, andere weiß ich nicht Aber es ist sowieso egal, weil ich ja der Einzige bin, der’s am Ende essen muss.“
Seines Klaviers und seiner Akkorde überdrüssig, begann Waits, daheim im Badezimmer mit seiner Stimme zu experimentieren, nahm mit dem Mund Rhythmen auf und überließ es Gattin Kathleen Brennan, dazu Songs zu formen. Waits war begeistert von der brutalen, unmittelbaren Atmosphäre dieser Vokalmusik, die man in ihrer reinen Form noch beim hidden track des neuen Albums hören kann. Aber als er sich mit Larry Taylor, Marc Ribot und Brain Mantia in einem verlassenen Schulhaus im Sacramento Delta ein mobiles Studio eingerichtet hatte und die Badezimmer-Tapes umsetzen wollte, ging zunächst gar nichts.
„Ich wollte in Grundfarben arbeiten“, erinnert sich Waits, „Brot und Wasser. Dreibeinige Tische. Die Abwesenheit von Klang. Doch ich verlor plötzlich all die Oberflächen und die Tiefen, alles klang flach. Ich war drauf und dran, die Jungs nach Hause zu schicken.“ Erst als das hier schon lange beschäftigte Trio nicht anstelle, sondern zu Waits‘ Beat-Boxing-Tapes zu spielen begannen, nahmen die neuen Songs die gewünschte Form an. Auf allzu allgemeine Fragen reagiert Waits ausweichend, wohl misstrauisch, ob sein Gesprächspartner überhaupt vertraut ist mit seinem Werk. Keine gute Frage ist etwa die nach etwaigen Zielen, die sich Waits vor dem neuen Album womöglich gesteckt hatte.
„Ich lebe in einem Haus, das auf einem sehr steilen Hügel steht. Wenn du die Handbremse nicht anziehst, rollt dein Auto mit 40 km/h runter in den See“, holt Waits zu einer grundsätzlichen Allegorie aus, „auch im Haus selbst ist alles schief. Wenn ich einen Ball ins Badezimmer lege, rollt er runter bis ins Wohnzimmer. Wenn ich ins Bett will, muss ich bergauf gehen. Zuerst fand ich das ärgerlich; ich hatte ja viel Geld für das Haus bezahlt Aber dann dachte, nein, das passt ganz gut zu mir. Ich bin auch ein bisschen schief. Ich schieße Dosen vom Zaun. Ich habe einen Garten voller umgefallener Bäume. Und ich habe einen Büffel darin, weil mir das das richtige Tier für uns zu sein scheint“
Man kennt diese Geschichten – Geschichten, die wahr sein könnten, es aber doch wohl nicht sind. Wie die von seiner reichlich Beat-poetischen Geburt auf dem Rücksitz eines Taxis.
Oder die von Onkel Vernon, dessen grausam verzerrte Stimme (angeblich hat Waits sie sich von ihm abgeguckt) daher rührte, dass Arzte bei einer Operation eine kleine Schere in seinem Hals vergaßen. Oder die von einer geheimen Konferenz der westlichen Staatsoberhäupter, die sich während der ersten Bush-Ära in einem Schuppen in der Nähe von Waits‘ Haus getroffen haben sollen. Enge Freunde hielten besonders diese Geschichte immer für eine der Verlängerungen der Kunstfigur Tom Waits, eine weitere amüsante Stilisierung – bis eine Reportage samt verdeckt gefilmter Bilder das Gerücht bestätigte. Sagt man.
Wie auch immer – Tom Waits erwartet von seinem Gegenüber, sich auf seine Erzählungen einzulassen und die Symbole zu verstehen. Denn schließlich ist er ein Geschichtenerzähler, einer, der die Wahrheit am liebsten in Gleichnissen mitteilt. Im Gespräch ist das sehr faszinierend: Waits macht aus jeder Antwort eine jener Rezitationen, die spätestens seit „Bone Machine“ fest ins Repertoire gehören. Und ist trotz der selbst verordneten Farmer-Attitüde von einer wirklich beeindruckenden, sehr seltenen Aura umgeben. Entsprechend kommt er besonders in Fahrt, wenn das Gespräch in Bereiche führt, die dem immer wachen Poeten gute Vorlagen liefern. Songwriting.
Sie komponieren seit mehr als 2 0 Jahren mit ihrer Frau. Hat man sich da so etwas wie eine Arbeitsteilung angewöhnt?
Man kann am Ende nie genau sagen, wer was gemacht hat. Das ist so wie das Zünden von Feuerwerkskörpern: Manchmal muss ich die Rakete halten, und du zündest sie, manchmal anders herum. Manchmal Saat, und ich bewässere sie, manchmal anders herum. Alles passiert zugleich, alles landet in einem Topf.
Sind Songs in erster Linie Fleißarbeit?
Beefheart hat einmal gesagt: „Es ist komisch, dass die Leute mich für meine Songs bezahlen – ich habe sie ja umsonst gekriegt“ Er hat Recht Schließlich kaufe ich sie nicht beim Supermarkt unten an der Straße, der dann und wann eine neue Lieferung kriegt. Ich tu nur so, als ob – wie ein Kind, das einen Matschkuchen macht. Ein bisschen Matsch, ein paar Blumen, vielleicht eine Priese Kies, ein bisschen schütteln, fertig. Was da genau passiert? Keine Ahnung. Irgendwie treffen das Heilige und das Profane zusammen und – boom! – entsteht etwas Ewiges. Du weißt dann einfach, wenn es richtig ist.
Klingt ziemlich spirituell.
Es gibt ja diesen Glauben, dass Musik ganz technisch die Sprache Gottes zu den Menschen ist. Aber wenn du dir Grand Funk Railroad anhörst… Was um Himmels Willen hat er sich dabei gedacht? (grinst) Wenn man im Studio ist, will man ja eine Atmosphäre, als würde man allein tanzen. Aber wie macht man das, wenn andere zugucken? Man wartet auf eine Art Trance, Verzückung, auf Zungenrede. Das ist schon ein seltsamer Moment.
Kann man sich darauf verlassen, dass dieser Moment immer kommt?
Nein. Manche Musik will sich nicht aufnehmen lassen, sie entzieht sich dir. Aber Musik ist ja eigentlich auch nicht dazu gemacht, konserviert zu werden – sie entsteht im Moment, dann ist sie wieder weg. Hast du schon mal die Musik der Pygmäen gehört? Die stehen bis zur Hüfte im Wasser und machen diese seltsamen Geräusche (macht seltsame Geräusche), es klingt wie organisierte Vögel, total faszinierend. Sie kommunizieren, machen Platz für den anderen. Diesen Moment des Unbewussten versuche ich einzufangen. Deshalb belasse ich es im Studio meist bei first takes; ich mag Musik, die ein bisschen unfertig ist. Dann hat jeder noch was zu tun, und keiner ist eingeschüchtert von den perfekten Oberflächen. Perfekte Musik ist wie ein Haus ohne Türen und Fenster.
Es hieß, Sie würden jetzt mit lateinamerikanischen und afrikanischen Rhythmen experimentieren. Stecken Sie denn vor jeder neuen Platte ein Versuchsfeld ab?
Ich bin wie der Albino-Katzenweb hier (deutet hinter sich auf ein schmuddeliges Aquarium). Er schwimmt den ganzen Tag bloß hin und her. Aber für ihn ist es, als würde er jedesmal den Ozean durchqueren. Weil er bei jeder Wende alles vergisst – alles sieht für ihn immer ganz neu aus. So geht’s mir mit neuen Platten. Nichts ist bewusst, alles ist neu. Nach der Veröffentlichung von ‘Swordfishtrombones‘ sagte man mir, meine Musik würde nach Kurt Weill klingen, aber ich kannte ihn nicht. Und ich habe lange gezögert, mir seine Platten anzuhören, weil ich Angst hatte, mir dann zu viele Gedanken über meine eigenen zu machen. Deshalb finde ich Musik von Außenseitern, etwa in Nervenheilanstalten, so spannend. Ich würde es lieben, in meiner Musik so frei und offen zu sein. Aber das Leben ist nicht frei. Wir alle kämpfen, um uns von irgendwas zu befreien. Ich mache das mit Liedern, so werde ich damit fertig.
Wenn man es genau nimmt: Viel Neues gibt es aus dem Leben des Tom Waits eigentlich nicht zu berichten. Seit er in den Achtzigern mit Gattin Kathleen und den Kindern Kellesimone, Casey und Sullivan L.A. verließ um mit der großen Stadt auch den vorehelichen Tom Waits samt seiner wenig beziehungstauglichen Eigenschaften zurückzulassen, klaffen Klischee und Wirklichkeit immer weiter auseinander. Waits therapierte erfolgreich sein Alkoholproblem, ging kaum noch auf Tournee und entwickelte eine ausgesprochene Vorliebe für Land- und Familienleben. Im Zuge dieser Domestizierung wichen die Säufergeschichten, die Waits einst das Image des singenden Beatnik eingebracht hatten, sukzessive abstrakteren, tatsächlich viel eher Beat-poetischen Texten und Musiken, von dem Engagement in Theater und Film ganz zu schweigen. Andere Topoi bleiben indes wohl für immer: Auch auf „Real Gone“ gibt es gruselige cautionary tales, wird gemordet und das Zirkusleben skurril besungen. Aus der Ferne, versteht sich; selbst zu den schlimmsten Zeiten, als Waits im berüchtigten Tropicana lebte und die Grenzen gefährlich zu verschwimmen begannen, war er noch der ewige Beobachter, der das Leben in der Gosse aufsog und in Geschichten verwandelte – aber im Gegensatz zu seinen Protagonisten jederzeit aufstehen und weggehen konnte. „Ich habe mein Zuhause damals nicht vermisst, weil ich keins hatte“, erinnert sich Waits, „und ich wollte auch keins. Ich wollte in jedem Fall jede Bindung und Verantwortung vermeiden. Ich hatte höllische Angst, in einem Hundekorb zu enden. Aber als Kathleen und ich heirateten und unsere Kinder bekamen, änderte sich das. Heute mache ich alles, was ich tue, nur aus zwei Gründen: Liebe oder Geld. Dummerweise kommen die beiden nur selten zusammen im Auto.“
So sehr es also falsch ist, am romantisch verklärten Mythos von Waits, dem Säuferbarden, dem urban Hipster und Schutzheiligen der Taugenichtse festzuhalten, so sehr ist die gelegentliche Darstellung des jetzigen Tom Waits als biederer Familienvater, der sein eigenes Alter ego nur trefflich zu inszenieren weiß, ein Unsinn. Denn das Faszinierende dieses Mannes entsteht ja eben in der Spannung von poetisch-musikalischem Genie und besagter bodenständiger Attitüde. Das Mysterium, die Romantik, der harte Acker: Im Gespräch gestikuliert Waits, pflückt mit unfassbarem sprachlichen Reichtum immer neue Allegorien und lautmalernde Songs vom Ideenhimmel – redet dann aber genauso gern über das Wetter, sein Auto und die ganz banalen Schwierigkeiten der Kindererziehung. „Du kannst das ja nicht kontrollieren, was die Leute über dich erzählen“, hat Waits kein Problem mit den alten Klischees, „das ist so, als würdest du mit einem Haufen Hühner zum Strand fahren – was wirst du ihnen sagen, wenn du wieder los willst? Okay, Mädels, jetzt hopp, zurück in den Kofferraum?“
Als Symbol für den Tom Waits der Gegenwart taugt ein Lied auf „Real Gone“ ganz besonders. „Day After Tomorrow“, einer jener ergreifend simplen Songs, die vermutlich irgendwann ein böser Mensch zu einer Platte namens „Tom
Waits: The Ballads“ kompilieren wird, befasst sich mit bewusster Eindeutigkeit mit einem Gegenwartsthema – dem Krieg im Irak. Ein Soldat schreibt dar- in einen letzten Brief von der Front nach Hause, erzählt von den Gräueln des Krieges, von Zweifeln und Ängsten und der Hoffnung, übermorgen sicher nach Hause zurückzukehren. Waits stellte diesen Song für den Sampler „Future Soundtrack For America“ (Barsuk/moveon.org) zur Verfügung, der Geld sammeln und Meinung machen soll, um die amtierende US-amerikanische Regierung möglichst schnell aus dem Amt zu jagen. Ein klares Signal, leider auch ein überdeutlicher, ein wenig zu vorhersehbar imaginierter Song.
Es ist ungewöhnlich für Sie, bei einem politischen Thema so deutlich Stellung zu beziehen.
Oh, man muss. Wenn man nicht Stellung bezieht, hat man Stellung bezogen. Unsere Söhne sind jetzt in einem Alter, in dem sie eingezogen würden, wenn es zu einer Mobilmachung käme. Das ist ein unfassbarer Gedanke. Diese Platte soll Geld auftreiben, um Bush seine Krone wegzunehmen und seinen Thron und sein Zepter. Der Mann ist eine Zecke. (macht ein angewidertes Gesicht) Hast du schon mal eine Zecke gehabt? Erst saugt sie dich aus, dann geht sie in deinen Körper und wandert in Richtung deines Hirns. Du siehst nur noch diesen Blutklumpen, der sich in dir aufwärts bewegt.
Glauben Sie, dass die momentane Bewegung amerikanischer Künstler gegen die Bush-Regierung Einfluss haben kann?
Ich weiß nicht, was passieren wird, ich bin nicht naiv . Wir wollten nur einen Song machen über diese armen Jungs im Irak. Die sind doch bloß Munition. ‘Hey, wir brauchen mehr von diesen Kerlen‘, sagen die Generäle, ‘die anderen kann man nicht mehr gebrauchen.‘ Weil sie tot sind oder lahm oder blind oder weil ihnen jemand das Gesicht weggeschossen hat. Sie sind wie Obst – du wirfst die Äpfel und brauchst immer mehr davon. It’s ugly and a sparents we’re sick of it.
War es schwierig, sich dem Thema als Songwriter zu nähern? Hier kommt der arme Bursche ja mit einem Brief zu Wort.
Ich versuche immer, den Dingen ein menschliches Gesicht zu geben. Das ist, was ich am Besten kann. Man kann ja nicht ganz direkt über politische Themen singen, das ist zu trocken.
Das Thema Familie beschäftigte Waits bei den Aufnahmen zu „Real Game“ in noch einer anderen Weise: Sohn Casey, der schon auf„Mule Variations“ dabei war, hat seinem Papa recht umfangreich an Turntables, Schlagzeug und Perkussion geholfen. „Das läuft so ab“, erzählt Waits mit leicht frustriertem Grinsen: „Ich sage: ,Hey Casey, leg die Bassdrum auf die Seite, nimm einen Holzhammer und hau drauf.‘ Und er hört: ,Wann wirst du endlich den Müll rausbringen?‘ Oder ich sage: ,Hey Casey, nimm mal die Snare vom Ständer und spiel einfach so mit den Fingern.‘ Und er hört: ,Räum verdammt noch mal dein Zimmer auf.‘ Also, es ist schwierig, mit seinen Kindern zu arbeiten.“
Als sich eine Weile später der Nachmittag zu Ende neigt – ein guter, inspirierender, beeindruckender Nachmittag -, steht plötzlich Evert vor uns. Kathleen sei am Telefon, sagt er mit wissendem Grinsen, und sie sei sauer, weil Tom schon wieder einen Termin vergessen habe. Jetzt aber schnell.
„She’s gonna kill me“, sagt Waits mit leicht säuerlichem Blick – und sagt dann etwas, was den Titel„MuleVariations“ in einem amüsanten Licht erscheinen lässt: „Sie behauptet immer, sie habe keinen Mann geheiratet, sondern vielmehr einen echten Esel. Sie hat wohl Recht“ Spricht’s und fährt in seinem bullig-schwarzen, arg verstaubten Chevrolet Pick-up in Richtung Santa Rosa davon.
Schon morgen, wenn im „Little Amsterdam“ eine jener berüchtigten Mariachi-Parties steigt, bei der die mexikanischen Landarbeiter ihren kargen Lohn für gegrillte Austern, Tequila und holländisches Export-Bier durchbringen, wird Waits wieder da sein.