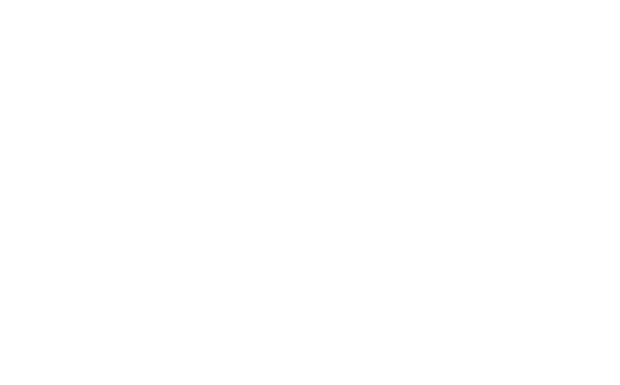GOOD TIMES

Es dauerte nicht lange, bis die belegschaft des Tokioter Bootleg-Geschäfts den silberhaarigen Kunden erkannt hatte. Kurz entschlossen schob ein Verkäufer eine von Hunderten in Japan legal erhältlichen, unautorisierten Led-Zeppelin-Live-CDs in den Player. „Das machen die immer, um mich zu ärgern“, sagt Jimmy Page. Es war der Moment, als der besessene Archivar seines eigenen Lebenswerks zum ersten Mal auf den Mitschnitt des Konzerts vom 10. Oktober 1969 im Pariser Olympia stieß. „Ich dachte mir:’Da sind doch glatt ein paar gute Sachen drauf.'“
Erst 2007 sagte Page vor einem britischen Gericht gegen einen Bootlegger aus, der darauf hin für 20 Monate ins Gefängnis ging. Wahrscheinlich legt er deshalb so viel Wert darauf, den legalen Ursprung dieser vom französischen Radiosender Europe 1 produzierten und ausgestrahlten Live-Aufnahme zu betonen: „Peter Grant (Led Zeppelins von Bootleggern gefürchteter Manager -Anm. d. Red.) wusste vielleicht was davon, ich aber sicher nicht. Wir erlaubten so was damals ja aus Prinzip nicht. Aber was den Mitschnitt aus dem Olympia aus heutiger Sicht auszeichnet, ist die unglaubliche Rolle, die das Publikum darin spielt. Wenn die Leute einmal derartig Stimmung machten, bekamen sie oft mehr von uns zurück, als wir selbst glaubten, geben zu können.“
Ein anderer Zeitzeuge wagt Pages Darstellung zu widersprechen:“Wenn ich das heute höre, wird mir klar, was für eine erstaunliche Sache doch der Enthusiasmus ist“, meint Robert Plant. „Ich kochte alles viel zu sehr auf. Ich hätte verdammt noch mal das Maul halten sollen, statt überall drüberzusingen. Ich hab immer viel gescattet.’Ummh. Ahhhh. Ahhh. Ahhh.‘ All dieses Zeug, wissen Sie …“
Kann es sein, Mister Plant, dass Sie der Einzige sind, der so abschätzig darüber urteilt?
„Vielleicht. Aber so für mich selber denke ich mir eben:’Shut the fuck up!'“
Ein grauer Londoner Regentag. Im gutsituierten Vorort Barnes stehen die Olympic Studios, Geburtsort so manchen Rock-Klassikers und heute, dem allgemeinen Studiosterben sei Dank, neu wiedergeboren als aufpoliertes, schniekes Programmkino. Was einmal das kleinere Studio 2 war, dient dieser Tage als Private Members Bar zur Verköstigung besonders wichtiger Gäste. Anstelle der alten Monitor-Boxen hängen zwei Gemälde von Ronnie Wood an der Backsteinwand: Gelb grundierte Leinwände, auf die der Rolling Stone und Nebenerwerbsmaler jeweils ein paar kleinere und größere silberne Kringel und darüber zur Erklärung das Wort „Speaker“ gepinselt hat – ein Sinnbild für die Rock-Kultur des Jahres 2014, deren größtes Kapital schon lange nicht mehr im Produzieren neuer Musik, sondern im feierlichen Auftischen ihres Erbteils liegt.
An diesem besonderen Tag sind die schwarzen Papierservietten mit silbernen Led-Zeppelin-Schriftzügen bedruckt. Schließlich findet nebenan im neuerdings zu seinem Vorkriegszweck als Kinosaal zurückgekehrten Studio 1 eine Präsentation zur Neuauflage der ersten drei Led-Zeppelin-Alben statt.
Jimmy Page, der diese Remasters-Ausgabe – wie alle anderen zuvor -persönlich betreut hat, stellt sich breitbeinig auf die Bühne, halb entspannter Rentner, halb Rockstar in schwarzem, halblangem Velours-Mantel und leichten Turnschuhen, und spricht ein paar einleitende Worte zu Sinn und Herkunft der „Companion Discs“, die jedes der drei Alben begleiten. Dann werden die Lichter gedämpft und die wiederentdeckten Bänder aus dem Pariser Olympia machen den Anfang der Präsentation. „Communication Breakdown“ klingt in diesem großzügigen Raum schlichtweg monströs, die Begeisterung der aufgeputschten Pariser vor 45 Jahren wird in voller Lautstärke physisch nachfühlbar. Doch der wahre Schock kommt ein paar Cuts später in Form einer Version von „Whole Lotta Love“ aus der Companion Disc zu „Led Zeppelin II“: Das sich anpirschende Trademark-Riff, darüber die Stimme Robert Plants: „Way down inside, you need love“, beschwört der Sänger sein Baby. Aber statt dem erwarteten Höhepunkt in Form der Titelzeile, begleitet von einem den ganzen langen Gitarrenhals herunterschlitternden Akkord -einer der eindeutigsten sexuellen Metaphern der Rockgeschichte – kommt da gar nichts außer unerlöster Spannung.
„Ich wusste genau, wie sich das anfühlen würde“, sagt Page zwei Tage später bei unserem Interview im Hinterzimmer eines gediegenen Hotels in Kensington. „Ich wusste, wie tief die Leute das verunsichern würde. Aber darunter bebt dieser Voodoo-Rhythmus. Es ist intensiv und nimmt einen ganz anderen Charakter an. Und dann, wenn der Mittelteil kommt, kann man sehr genau sehen, dass der von Anfang an ein Konzept hatte. Das war nicht irgendwas, das im Nachhinein zusammengebastelt und in die Mitte des Songs gekleistert wurde. Nein!“, faucht Jimmy Page und lehnt sich dabei vor, bis die grüne Chesterfield-Couch unter ihm eingeschüchtert knautscht.
„Nein! Für diesen Song gab es einen Masterplan!“
Die ur-version von „Whole Lotta Love“ entblößt allerdings auch, wie stark Robert Plants Anteil an diesem Plan auf Steve Marriotts früherer Interpretation eines von Muddy Waters popularisierten alten Willie-Dixon-Songs namens „You Need Love“ beruhte. Direkt auf diese als „You Need Lovin'“ 1966 von den Small Faces veröffentlichte Vorlage angesprochen, behauptet Jimmy Page auch heute noch, er habe sie nie gehört. Davon abgesehen, und jetzt beginnen die schwarzen Knopfaugen unter den schalkhaft hochgezogenen Augenbrauen des 70-Jährigen kampflustig zu glitzern: „Die hatten nicht dieses Riff. Ich weiß genau, was für eine Kraft dieses Riff hat.“
Jimmy Page, seit 2005 ein Offi cer of the Order of the British Empire, diesmal gekleidet in eine schwarze Lederjacke, schwarzen Seidenschal und ein schwarzes Hemd, ist sichtlich in Form. Seine Mission hinter der neuesten Remaster-Kampagne geht über den Verkauf von ein paar Millionen Platten weit hinaus: Die Musik, nicht der Mythos der großen Ausschweifungen soll diesmal im Mittelpunkt stehen. Gewisse alte Geschichten aus dem Sagenschatz der amourösen Abenteuer klingen heutzutage auch gar nicht mehr so lustig -gerade in Zeiten, wo scheinbar jede Woche eine neue Persönlichkeit der britischen Medien-und Musikszene der Siebziger (darunter auch Led Zeppelins alter Weggefährte Roy Harper) unter Anschuldigungen historischer sexueller Missetaten mit Minderjährigen vor Gericht gestellt wird.
Die Periode der ersten drei Alben umfasst dagegen jene zwei vergleichsweise unschuldigen Jahre an der Kippe zu den 70er-Jahren, also noch vor den Orgien an Bord des „Starship“, der koks-und heroinverseuchten Dekadenz des Riot House am Sunset Strip, Jimmy Pages okkultistischen Obsessionen und gewalttätigen Gangstern in der Entourage der Band, endend mit der tragischen Geschichte eines im Alkoholrausch an seinem eigenen Erbrochenen erstickten Drummers. Die Phase also, da Led Zeppelin noch keine satten Despoten waren, sondern ein nach Anerkennung hungerndes Team aus zwei Londoner Sessionprofis (John Paul Jones und Page) und zwei hypertalentierten Semi-Amateuren aus dem Black Country (Plant und John Bonham), die im Studio nüchtern und konzentriert einen präzisen Take nach dem anderen einspielten -mit dem Gitarristen in der Rolle des Produzenten, der endlich jene persönliche Vision verwirklichte, an der er jahrelang gebrütet hatte.
Deren Ursprung führt Jimmy Page ganz spezifisch auf jenen Moment zurück, als er mit zwölf zu Hause im Londoner Pendlervorort Epsom zum ersten Mal die pure, sexuell aufgeladene Rockabilly-Dreistigkeit von „Train Kept A-Rollin'“ von Johnny Burnette and The Rock ’n Roll Trio hörte: „Das drang tief bis in mein Innerstes vor. Vom Klang der Aufnahme bis zu der Art, wie die Musiker aufeinander eingingen, war alles daran völlig außergewöhnlich.“
In seiner ersten ernsthaften Band Neil Christian &The Crusaders stieß er sich schon als Teenager an dieser Nummer die Hörner ab. Mitte der Sechziger, als Page bereits die ruhige Kugel eines begehrten Studiogitarristen schob, schlug er ein erstes Angebot der Yardbirds aus, Eric Clapton als deren Lead-Gitarrist nachzufolgen. Stattdessen empfahl er seinen Jugendfreund Jeff Beck und musste prompt zusehen, wie die Band jenen Song, auf dem seine eigene Rock-Utopie auf baute, zu einer Hauptattraktion ihres Live-Sets ausbaute: „Als ich schließlich selbst Teil der Band wurde, war ich richtig glücklich,’Train Kept A-Rollin“ spielen zu können. So oft wie möglich.“ Eine in „Stroll On“ umbenannte Yardbirds-Version des Songs mit Page und Beck an den Gitarren verewigte Regisseur Michelangelo Antonioni 1966 in seinem Film „Blow-Up“.
Nach dem Abgang Jeff Becks ein Jahr später mutierten die Yardbirds zunehmend zum Versuchslabor für Pages künftige Karriere, man höre nur sein von Folk-Gitarren-Genie Davey Graham abgekupfertes, virtuoses Akustikgitarrensolo „White Summer“ auf ihrem letzten Album „Little Games“ oder erste, unrunde Versuche an einem Jake-Holmes-Song namens „Dazed And Confused“.
„Die Passagen mit dem Violinbogen, die Spielerei mit dem Volume-Pedal (singt das Riff), das war alles genau so vorgesehen“, erzählt Page. „Nachdem wir mit den Yardbirds diesen Ablauf festgelegt hatten, wusste ich genau, dass das eine Killer-Nummer war, mit der die neue Band die Leute in Angst und Schrecken versetzen würde.“
Nach dem zerfall der Yardbirds holte Page sich Verstärkung in Gestalt von Peter Grant, dem frustrierten Juniorpartner des Pop-Svengalis Mickie Most, um gemeinsam die perfekte Retorten-Rock-Band zu kreieren. Ein paar große Namen hatten ihnen auf ihrer Suche nach einem geeigneten Frontmann bereits abgesagt, darunter der damals angesagte australische Rock-Shouter Terry Reid, der stattdessen ein 19-jähriges Talent aus den Midlands namens Robert Plant empfahl.
„Ich begann Robert zu erklären, was ich mit diesem Projekt vorhatte“, erinnert sich Page an Plants ersten Besuch in seinem Haus an der Themse. „Ich spielte ihm die Yardbirds-Version von ‚Dazed And Confused‘ vor. Auch ‚Babe I’m Gonna Leave You‘ und ‚Communication Breakdown‘, all diese Sachen.“
So überzeugt war Page von der durchschlagenden Wirkung seines Konzepts, dass er sein Material bei der ersten Session mit dem komplett neuen Line-up im August ’68 in einem Keller in Soho sicherheitshalber noch bedeckt hielt. Stattdessen griff er wieder auf „Train Kept A-Rollin'“ zurück, um das Zusammenspiel mit seinem alten Sessionmusikerkollegen John Paul Jones am Bass und Robert Plants trommelndem Freund und Ex-Bandkollegen John „Bonzo“ Bonham auszutesten. „Ich dachte mir:’Das wäre eine interessante Nummer, um herauszufinden, wie flink diese Leute drauf sind'“, erzählt Page. „Ich war sicher, dass John Paul Jones den Song nie gehört hatte, und John Bonham war er wahrschein-
lich auch nie zuvor untergekommen. Also schaute ich mir einmal an, wie die sich damit zurechtfinden konnten. Sobald wir mit dem Song fertig waren, sahen wir einander an und sagten nur:’Wow!‘ Aber ehrlich gesagt hätten wir alles spielen können und uns dabei gegenseitig aus den Socken gehauen. Das lag nicht am Song, sondern an der Einstellung der Leute, die ihn spielten.“
In Jimmy Pages Haus bereitete sich die neue Band gleichzeitig auf die letzte Yardbirds-Tour und ihre neue Studioinkarnation als Led Zeppelin vor. „Ich erinnere mich mit großer Klarheit daran, wie wir sowohl ein Live-Set als auch all das Material probten, das unser neues Album ausmachen sollte“, behauptet Page. „Wir hatten die neuen Songs bereits gemeistert, als wir unter dem Namen New Yardbirds die letzten Dates in Skandinavien spielten. Das waren nicht einmal zwei Handvoll Konzerte, aber genug, um sozusagen unter dem Mantel der Anonymität an diesen Nummern zu arbeiten und herauszufinden, wo sich die Leidenschaft hineinpacken lässt, wo man den Beat pushen kann und wo nicht, all diese subtilen Dinge, die eine Performance ausmachen, und die man dann im Studio aus dem Hut zaubern kann.“
Page buchte auf eigene Kosten 30 Stunden Studiozeit, damals eine höchst ungewöhnliche Vorgehensweise, weil unerhört teuer (1.782 Pfund waren in den Sechzigern ein kleines Vermögen), aber seine Investition sollte sich schnell amortisieren. Nachdem sämtliche britischen Labels die New Yardbirds ungehört als alten Hut abgetan hatten, fuhr Peter Grant einfach mit den Bändern nach New York. Dort lieh ihnen Jerry Wexler, die Soul-Legende bei Atlantic Records, ein offenes Ohr und empfahl sie seinem Chef Ahmet Ertegün weiter. Ende November kam Grant mit einem nie da gewesenen Vorschuss von 200.000 Dollar in der Tasche nach London zurück. Nur anderthalb Jahre später sollten Led Zeppelin dank seines schonungslosen Verhandlungsstils bereits für jeden einzelnen ihrer US-Auftritte die Hälfte dieser Summe kassieren.
„Peter Grants Rolle war essenziell“, sagt Page heute, „denn ich kannte mich in diesem Business nicht aus. Ich verstehe bis heute noch nichts davon. Es ist eine andere Art von Kunstform. Vielleicht eine schwarze Kunst, aber doch eine Kunstform. Was den kreativen Prozess angeht, aus dem Nichts etwas zu machen, das man auf eine Platte pressen kann – davon verstand ich alles.“
Big Jim und Little Jimmy
Als Jimmy Page 1968 Led Zeppelin formierte, hatte er nicht bloß die Yardbirds, sondern auch eine intensive Kurzkarriere als einer von Londons gefragtesten Sessiongitarristen hinter sich
Es war das Pfeiffersche Drüsenfieber, das die beginnende Bühnenkarriere des James Patrick Page Anfang der Sechziger vorläufig beendete. Also widmete der kränkelnde Teenager sich erst einmal der Kunstschule und mischte an Wochenenden in den Bluesbands von Cyril Davies und Alexis Korner mit. Von der Bühne weg rekrutierte ihn John Gibb von der Band The Silhouettes in den auserwählten Zirkel der Londoner Studiomusiker. Ein anderer Musiker namens Glyn Johns aus demselben Vorort wie Jimmy (Epsom, Surrey) hatte kurz zuvor eine Laufbahn als Tontechniker eingeschlagen. Für seinen Kumpel Jimmy fädelte er eine Session mit Jet Harris und Tony Meehan von den Shadows ein, aus der der Nummer-eins-Hit „Diamonds“ hervorging. Neben dem etablierten Lead-Gitarristen „Big“ Jim Sullivan spielte „Little“ Jimmy Page von nun an Rhythmusgitarre auf Hunderten Hits, von Shirley Basseys „Goldfinger“ über Petula Clarks „Downtown“ bis zu Dave Berrys „The Crying Game“, danach bald auch als einziger Gitarrist auf „The Last Waltz“ von Engelbert Humperdinck, „Baby Please Don’t Go“ von Them oder „With A Little Help From My Friends“ von Joe Cocker.
Glyn Johns (der später Led Zeppelins erstes Album aufnehmen sollte) war inzwischen zum Stammtechniker des Who-und Kinks-Produzenten Shel Talmy aufgestiegen. Auch dort verschaffte er seinem Kumpel Jimmy einige Sessions, was im Nachhinein zu Spekulationen, insbesondere über Pages Beitrag zum Who-Klassiker „I Can’t Explain“ führte. „Man kann mich auf der Platte fast nicht hören, ich spielte bloß das Riff im Hintergrund“, sagt Jimmy Page heute, „Pete Townshends Gitarre brauste nur so dahin. Aber können Sie sich vorstellen, wie sich das anfühlte, in diesem Raum zu stehen? Es war einfach fan-tas-tisch! Diese Energie!“
Knapp zwei Jahre später heckten Page und Jeff Beck mit Keith Moon und John Entwistle von The Who ein gemeinsames Projekt aus. Je nach Version der Anekdote war es Moon oder Entwistle, der meinte: „Das würde einschlagen wie ein Blei-Zeppelin!“ Die Supergroup kam nie zustande. Aber Jimmy Page merkte sich die Pointe.
Zeppelins Stil
Ob Stierkämpferjäckchen, Pseudo-SS-Mütze oder einfach nur „rocket in the pocket“ – Led Zeppelin wagten in den Siebzigern nicht nur musikalisch, sondern auch kleidungstechnisch so einiges
Mitte der Sechziger, zur Zeit seiner Romanze mit der singenden Songschreiberin Jackie DeShannon, war Jimmy Page bereits ein bekannter Beau auf Londons Straßen. „I love it when he wears his coat of leather“, sang DeShannon in ihrem gemeinsam mit Jimmy aufgenommenen Hit „Dream Boy“. Das mit dem Ledermantel klingt stimmig, denn ein Mod war Page -langes Haar, Lieblingsfarbe Schwarz -wohl nie. In alten Publicity-Shots der Yardbirds fallen sein mit Metall-Knöpfen besetzter alter Marine-Mantel und seine frühe Neigung zu Schlaghosen dementsprechend aus der Reihe. Bei Led Zeppelin versuchte Page sich an der Wende zu den Siebzigern im unter Rockstars kurzfristig angesagten Dress-Down-Look. Die ärmellose, braun-blau-weiße Karo-Weste des Royal-Albert-Hall-Gigs 1970 ging aber eindeutig zu weit, ebenso wie der schwer verfilzte Mantel-Hut-und-Vollbart-Look beim Bath Festival im selben Jahr. 1972 reflektierte ein direkt über der haarlosen Brust getragener, glitzernder Mond-und Sterne-Zweiteiler aus Samt und Strass Pages Faible für Astrologie. Im Jahr darauf begann er ein mit Rosen besticktes Stierkämpferjäckchen zu tragen, gefolgt vom berühmten „Dragon Suit“ aus schwarzem Satin mit in Rot und Gold applizierten, orientalischen Drachenmotiven. Seinem wachsenden Appetit für Narkotika entsprechend, war Pages nächster Bühnenanzug auf der von Drogenund Gewaltexzessen begleiteten US-Tour 1977 weiß wie Pulver mit großen roten Mohnblüten drauf, abgelöst vom dubiosen „Stormtrooper“-Outfit aus schwarzen Kniehosen, Schaftstiefeln, Pseudo-SS-Mütze und dunkler Pilotenbrille. Dazu passend kleidete sich Drummer John Bonham zu jener Zeit nach dem Vorbild des ultra-brutalen Alex aus „A Clockwork Orange“ in einen weißen Overall und Bowler-Hut.
Sänger Robert Plant verließ sich dagegen die ganzen Siebziger hindurch auf die Strahlkraft seines blonden Lockenhaupts, seiner offenen Paisley-oder Hippie-Blusen, der endlos langen Armfransen und nicht zuletzt der prononcierten Beule links neben dem Reißverschluss seiner Jeans, volkstümlich bekannt als „rocket in the pocket“.
Zu Weihnachten ’68 gingen Led Zeppelin bereits auf ihre erste US-Tournee, und bei Erscheinen ihres Debütalbums am 12. Januar 1969 hatten sie gerade ihren letzten von vier triumphalen Gigs im Fillmore West in San Francisco gespielt. „Als wir in San Francisco ankamen, veränderte das den Lauf der Musik, die von diesem Punkt an gemacht wurde“, sagt Page ohne jede falsche Bescheidenheit. „Im Ernst. Die Leute hatten so was noch nie gesehen.“
Aber wo kam das unbegrenzte Selbstvertrauen her, das Sie dafür benötigten?
„Wo kam es her? Ich weiß nicht. Wir waren furchtlos. Es war so aufregend, in dieser Band zu sein. Alle waren einander musikalisch ebenbürtig, und ich konnte endlich zeigen, was ich auf Lager hatte. Diese Musiker konnte man mit allem herausfordern, was einem einfiel. Wir brauchten keine Gastmusiker oder Gastsänger. Alles war da.“
9. Januar 1970,26. Geburtstag des Bandleaders Jimmy Page: Nach zwei sensationell gut verkauften Alben befinden sich Led Zeppelin auf einer Konzertreise durch England, die ihren Ruf in Großbritannien endlich auf gleiche Höhe mit ihrem phänomenalen Erfolg in den USA bringen soll. Heute Abend steigt die prestigeträchtigste Show der Tour in der Londoner Royal Albert Hall. Vergangenen Sommer bei den „Pop Proms“ hat die Band hier bereits die Konkurrenz hinweggefegt, aber heute steigt ihr eigener Headliner-Gig. Peter Grant hat die Filmemacher Peter Whitehead und Stanley Dorfman engagiert, um den Augenblick des Triumphs zu verewigen. Auf der Gästeliste stehen Namen wie Roger Daltrey, Jeff Beck, Eric Clapton und John Lennon. Doch in der Garderobe herrscht dicke Luft. Der Sänger, der vor anderthalb Jahren noch in den Hinterzimmern der Pubs von Birmingham den Blues gesungen hat, bringt keinen Ton heraus. Seine Stimme ist völlig futsch.
„Also hat man Doctor Robert gerufen“, erzählt ein launiger Robert Plant 44 Jahre später in seinem Stammpub in Primrose Hill, wo wir ihn eine Stunde nach unserem Gespräch mit Jimmy Page, sozusagen auf seinem eigenen Territorium treffen. „Den berühmten Doctor Robert. (Er muss wohl den von den Beatles im gleichnamigen Song verewigten, doping-freundlichen New Yorker Promi-Arzt Dr. Robert Freymann meinen -Red.) Er gab mir einen Schuss in den Arm, und ich rutschte die Wand hinab. Alle waren in unserer Garderobe, Familienmitglieder inklusive, und ich sank vor den Augen der versammelten Gesellschaft zu Boden. Dann rappelte ich mich wieder auf, und sobald ich stehen konnte, war meine Stimme wieder da. Er muss mich mit seiner Injektion tief in meinem Bewusstsein getroffen haben. Ich war auf mein Versagen eingestellt, und was er mir spritzte, hätte genauso gut gar nichts gewesen sein können. Aber es entspannte die Muskeln rund um meine Stimmbänder, und ich ging da raus und sang ‚We’re Gonna Groove‘ wie ein Motherfucker.“
In seiner konzertkritik für den „NME“ schrieb Nick Logan, dass Plant „mit Arroganz über die Bühne stolziert“ sei, aber all das suggestive Gockel-Gehabe war bloß Schau. „Ich war ziemlich unsicher“, sagt Plant heute. „Ich sah mich oft als eine Art Nebendarsteller. Einer, der sich in die Arbeit anderer Leute einreiht, sie dann wieder verlässt und auf Einsatz wieder zu den anderen hinzustößt. Es kam nicht selten vor, dass ich mich umdrehte und sah, wie Jonesy und Page sich förmlich ins Schlagzeug hineinlehnten und die nächste Links-oder Rechtskurve ausheckten, die die Musik nehmen sollte. Diese Typen waren drei der besten Musiker ihrer Zeit, zwischen denen sprühten die Funken. Ich für meinen Teil versuchte, mit meiner Stimme Polyrhythmen zu erzeugen, wie man sie in Marokko zu hören kriegt, aber die anderen ignorierten mich meistens und spielten weiter ihr Ding. Völlig zu Recht, haha.“
Bei aller strategischer Selbstbescheidung macht Robert Plant immer noch eine imposante Figur. Wie Page trägt er eine schwere Lederjacke, allerdings in Braun, so wie seine authentisch abgewetzten Cowboy-Boots. Sein Bart ist grau, die zerfurchten Gesichtszüge und die wasserblauen Augen haben sich über die Jahre zu einer übertriebenen Version seines jüngeren Antlitzes ausgewachsen, aber die zum Rossschwanz gebändigte Löwenmähne ist immer noch dicht und kräftig.
Während unseres Interviews wird Plant kein negatives Wort über Jimmy Page verlieren. Trotzdem ist eindeutig klar, warum die beiden ihre Interviews an verschiedenen Orten derselben Stadt geben. Plant steht zwar voll hinter dem von Page für die „Companion Discs“ ausgewählten Material, seine Motive sind aber deutlich andere, nämlich die von ihm seit Beginn seiner Solokarriere in den Achtzigern beharrlich betriebene Distanzierung von seinem Image als Led Zeppelins „goldener Gott“(wie er sich selbst 1975 gegenüber Cameron Crowe, dem damals 15-jährigen Reporter des ROLLING STONE, nannte):“Ich war ziemlich naiv und probierte dauernd Dinge aus. Ich hatte keine Erfahrungen in der Welt da draußen gesammelt, aber ich nahm so schnell und so viel wie möglich in mich auf, und dann musste ich das alles erst entwirren und herausfinden, wo ich meinen Platz in all dem finden konnte. Die Route, die ich dabei wählte, durch all die Optionen und Alternativen, führte mich da hin, wo ich heute stehe.“
In anderen worten: es gibt kein Zurück. Und so folgt auf jede Anekdote darüber, wie er bei Led Zeppelin vor lauter Stress und Erschöpfung ständig die Stimme verlor, der Vergleich mit der befreiten Kehle seiner Duette mit Alison Krauss. Ebenso führt die Beschreibung der Echo-Experimente, die er mit Led Zeppelin live und im Studio betrieb, logisch zu seiner heutigen Band: „Bei Zeppelin hatte ich einen Typen, der nur für mich vorne an der Bühne saß und mit Echos und Effekten spielte. Bei meiner jetzigen Band (The Sensational Space Shifters) habe ich einen eigenen Effektkanal, ich kann die Stimme kreiseln lassen, ich kann sie quer durchs Stereobild schicken und durch alle möglichen Effekte schleusen. Ich haben diesen westafrikanischen Typen auf der einsaitigen Fiedel (Juldeh Camara aus Gambia mit seiner Riti), die Typen von Massive Attack (Keyboarder John Baggott, Bassist Billy Fuller), all diese trippigen Loops und so weiter, da muss ich auch mithalten können.“
Man könnte meinen, Robert Plant will, wie die Briten so schön sagen, den Kuchen sowohl behalten als auch essen: Vom Erbe Led Zeppelins profitieren, aber sich gleichzeitig selbst ein wenig drüber stellen. Wohlwollender ausgelegt, hat sein Bestreben, den Ruf der Band als Überväter des Heavy Rock und Metal zu relativieren, aber durchaus Berechtigung. Bei Atlantic Records befanden Led Zeppelin sich Ende der Sechziger schließlich in Gesellschaft von Soulund R&B-Acts wie Aretha Franklin, Don Covay, Wilson Pickett und Roberta Flack. Dass die Rockmusik sich in weiterer Folge zu einem vom Soul-Universum getrennten, rein weißen Genre entwickeln sollte, war zu jener Zeit noch lange nicht in Stein gemeißelt.
„Das ist ein sehr guter Punkt. Einer der besten, die ich gehört habe“, frohlockt Plant, „wenn man an Leute wie
Your Time Is Gonna Come
Led Zeppelin haben zwar seit 35 Jahren keine neue Musik mehr hervorgebracht, aber ihr Werk fand in dieser Zeit immer neue, gelehrige Schüler – von Guns N’Roses, Jeff Buckley, Dave Grohl und Jack White bis zu den Arctic Monkeys
Wie viele Genrewelten Led Zeppelin in ihrer zehnjährigen Studiokarriere auch durchstreiften, ihre offensichtlichsten Epigonen wie Def Leppard, Aerosmith, Black Crowes oder Guns N’Roses hielten sich vornehmlich an den Hardrock-Aspekt ihres Werks. Bis heute bewandern Bands wie Wolfmother denselben ausgelatschten Trampelpfad. In den Achtzigern fanden dagegen britische Bands wie The Cult oder The Mission (deren zweites Album „Children“ John Paul Jones produzierte) unter Zeppelins Einfluss vom rockigen Ende des Post Punk zum Goth Rock. Auch die Grunge-Szene der Neunziger gehörte geschlossen zum Fanclub: Soundgarden, Pearl Jam und die Stone Temple Pilots spielten allesamt Led-Zeppelin-Covers, nicht zu vergessen jenes Heimvideo aus dem Jahr 1988, in dem Nirvana beim Proben in Mama Novoselic‘ Haus beherzt den „Immigrant Song“ herunterdreschen. Für Dave Grohl sollte dieser Weg schließlich bis nach Wembley führen, wo er und Taylor Hawkins am Ende ihres Foo-Fighters-Gigs 2008 gemeinsam mit John Paul Jones und Jimmy Page Versionen von „Rock’n’Roll“ und „Ramble On“ zum Besten gaben. Ein Jahr später gründete Grohl mit Jones und Josh Homme von Queens Of The Stone Age die Supergroup Them Crooked Vultures. Als Produzent hatte Homme damals gerade die Arctic Monkeys mit einer strikten Diät alter Zeppelin-Platten von der Indie-Band zum Arena-Rock-Act hochgepäppelt. Voriges Jahr bei ihrer großen Show im Londoner Earls Court – Schauplatz früherer Zep-Triumphe -saß übrigens Jimmy Page im Publikum.
Ein weiterer bekennender Adept ist Jack White („Ich vertraue niemandem, der Led Zeppelin nicht mag“), der neben Page und The Edge von U2 eine der Hauptrollen in Davis Guggenheims Gitarristen-Doku „It Might Get Loud“ spielte. Beispiele dafür, wie man Led Zeppelin auch subtiler verehren kann, sind Superfan Tori Amos und der selige Jeff Buckley. In letzterem Fall war die Liebe sogar gegenseitig. Wie Chris Dowd von Fishbone voriges Jahr enthüllte, brachen Page und Buckley, als sie einander zum ersten Mal trafen, vor lauter Hochachtung füreinander in Tränen aus.
Die CD-Edition
Jimmy Page nennt die „Companion Discs“ zu den ersten drei Led-Zeppelin-Alben „eine Pforte in die Zeit, als sie aufgenommenen wurden“
Eine ihrer folgenreichsten Pioniertaten, die die Welt des Rock ’n’Roll für immer verändern sollten, vollzogen Led Zeppelin erst zehn Jahre nach ihrer Auflösung. Die von Jimmy Page persönlich zusammengestellte Remasters-Box des Jahres 1990 mit ihren berühmten, vom Schatten eines Zeppelins verdunkelten Kornkreisen auf dem Cover, revolutionierte den Neuauflagenmarkt: Mit dem Versprechen eines verbesserten Sounds und einer schönen Schachtel dazu ließ sich altes Material auch an Leute verkaufen, die es bereits auf LP oder CD besaßen. Man ahnte es damals nicht, aber diese Remasters waren der Auslöser einer seither bestehenden Ära der Reissues, die in Folge auch den anhaltenden Boom an Live-Reunions nach sich ziehen sollte.
Wie schon die 2007 rund um Led Zeppelins kurzlebige Wiedervereinigung erschienene Compilation „Mothership“ unüberhörbar demonstrierte, hat sich in den Jahrzehnten seit Erscheinen der Remasters-Box technologisch genug getan, um die jetzt mit den ersten drei Alben eingeleitete neue Generation von Reissues zu rechtfertigen. Trotzdem hat sich Jimmy Page einen zusätzlichen Kaufanreiz in Form einer „Companion Disc“ mit unveröffentlichten Tracks zu jedem Album überlegt. Da es vom Debüt nicht genug Stoff für Outtakes gibt, beginnt die Reihe gleich mit dem bereits wohlbekannten Live-Mitschnitt aus dem Pariser Olympia. Nichtsdestotrotz ein spannendes Dokument aus einer Zeit, als Rockbands auf der Bühne mangels Monitorboxen noch spontan mit dem aus der Halle zurückkommenden Raumklang kommunizierten. Siehe etwa Robert Plants Performance in „You Shook Me“, die veranschaulicht, wo die Inspiration zu den radikalen Echo-Experimenten auf „Led Zeppelin II“ herkam.
Für die „Companion Discs“ der Alben „II“ und „III“ hat Page, sofern vorhanden, die besten alternativen Takes zu den jeweiligen Songs der Originalalben ausgewählt. Auf „II“ gibt es eine unveröffentlichte Skizze von John Paul Jones namens „La La“ zu entdecken, die „Companion Disc“ zu „III“ wiederum enthält statt „Hats Off To (Roy) Harper“ den akustischen Blues-Jam „Keys To The Highway/Trouble In Mind“. Im Grunde sind die „Companion“-Tracks erste Mix-Downs von Takes, die vor der Overdub-Phase verworfen wurden. Nicht selten klingen sie knackiger und kompakter als die aufgeputzten Versionen, die man bisher kannte. Ein ketzerischer Gedanke: Was, wenn Page damals das Overdubbing hätte bleiben lassen? Hätte das ganze Genre vielleicht eine 30-Jahre-Abkürzung am Punk vorbei bis zu den White Stripes nehmen können? Rund um dieses schlanke Schwesternschiff zu Led Zeppelins Studiowerk ließe sich eine ganze Alternative Rock History schreiben. Und vielleicht wäre Led Zeps erstes Album im ROLLING STONE nicht verrissen worden wie im legendären Review von 1970 (siehe Ausriss oben).
Sly &The Family Stone denkt, das war ein kulturübergreifendes Amalgam. Oder Buddy Miles, der mit Hendrix spielte. Er war ein diagonaler Katalysator zwischen weißem und schwarzem Zugang zur Musik. Und wenn man mit einem interessanten Menschen wie Steve Cropper spricht, hört man Geschichten der frühen Volt-und Stax-Aufnahmen als erstaunliche Kollisionen zwischen schwarz und weiß. Ich weiß nicht, was seither mit dem angelsächsischen, kaukasischen Rock passiert ist. Er hat sich verrannt. Ich habe ehrlich gesagt einfach das Interesse daran verloren.“
L aut plant reichte das musikalische Universum von Led Zeppelin immer schon wesentlich weiter als das ihrer Fans und Nachahmer: „Jonesy und Bonzo hörten sich sehr genau die Band von James Brown an, die ganze Idee einer Rhythmusgruppe, die wie der Schlüssel ins Schloss fährt und einen in den Arsch tritt. Wir sind nur selten zu Rockkonzerten gegangen, aber zur James Brown Band pilgerten wir alle wie ein Haufen Groupies. Später hat uns das dann zu Tracks wie ‚The Crunge‘ hingeführt, zu diesen wirklich tighten Nummern.“
Das mag wohl stimmen, aber jener Ausschnitt der Bandkarriere, den die ersten drei Alben umfassen, führt erst einmal in eine andere Richtung. Genauer gesagt, in das kleine primitive Cottage Bron-Yr-Aur in der walisischen Wildnis, in das Page und Plant sich 1970 zurückzogen, um dort die akustische, folkige Seele der Band zu entdecken. Das daraus folgende Album „Led Zeppelin III“ wurde bei seinem Erscheinen als Leichtgewicht missverstanden. Dabei war dies der Punkt, wo Plant sich als Texter weitgehend von seinem geborgten Blues-Machismo befreite. Neben einem lyrischen Ausleben seiner spätpubertären Tolkien-Phase ließ er nun auch ökologisches Bewusstsein suggerierende Sprachbilder in seine Beziehungsgeschichten einfließen. „Ich war verheiratet und hatte ein Kind“, sagt Plant. „Ich molk meine Ziegen, fütterte meine Hühner und machte mir Sorgen um die Welt und die Zukunft meiner Kinder. Ich war erwachsen geworden.“
Und zwar sehr schnell. „Ja“, lacht Plant, „So ist das beim Geschlechtsverkehr. Der dauert eben nicht lange. Ups, der erste Witz des Tages „
Wo das Eis schon einmal gebrochen ist, wird es Zeit, das unvermeidliche Thema anzusprechen: Plants beständige Verweigerung einer Led-Zeppelin-Reunion, während andere sogenannte Heritage Acts wie die Stones, The Who oder Paul McCartney die Hauptbühnen der großen Festivals monopolisieren. „Heritage Acts, das ist ein Name für Bands, die einen Nachmittagsschlaf brauchen, oder?“
Solange sie dann so aufregende Konzerte hinlegen wie Led Zeppelin 2007 im Londoner O2 Centre, geht das wohl in Ordnung. „Okay, das war wirklich gut. Sehr, sehr gut. Aber versuchen Sie dasselbe dreimal die Woche, mit einem Haufen Vollidioten rundherum. Alles, was schön daran war, würde sich zerstreuen, und wir wären verdammt zu einer Art Hölle.“ Plant spricht nicht etwa von der drogeninduzierten Hölle der exzessiven Gewalt, wie sie etwa die letzte US-Tournee von Led Zeppelin 1977 begleitete, sondern von der „Richtung, in die sich diese ganze Branche entwickelt hat. Große Konzerne kaufen ganze Tourneen auf, bevor die Künstler überhaupt noch gefurzt haben. All die großen Namen, die wir kennen, sind gerade in Panik darüber, ob sie einen Hit haben werden, weil sie ein gewisses Alter erreicht haben. Warum so was überhaupt in Betracht ziehen? Wir fingen damals nicht mit der Musik an, um so zu enden. Wieso sollten wir uns an etwas klammern, wo wir nie hinwollten? Nur aus irgendeinem neurotischen Bedürfnis, von den Massen geliebt zu werden?“
Led-Zeppelin-Fans, die sich von Plants Aussagen, dass er 2014 freie Zeit haben werde, Hoffnung machen ließen, dürfen das getrost als ein „Nein“ werten. Ihnen geht es wie Jimmy Page. Die ewige Ironie im Leben des Mannes mit dem Masterplan ist, dass er spätestens seit John Bonhams Tod 1980 von der Gnade jenes Mannes abhängig ist, den er einst aus der Obskurität zerrte. „Natürlich haben mir die Leute die ganze Zeit Fragen dazu gestellt“, sagt Page mit einem Lächeln und zur Geste fatalistischer Resignation ausgebreiteten Armen. „Es wurde gesagt, dass Termine freigehalten werden, und dass wir 2014 auf Tour gehen würden. Aber ich sehe mir auch die Realität an, und die besagt: 2007 – das Konzert im O2 Centre. 2014, das ist heute. Haben Sie irgendwelche Led-Zeppelin-Konzerte dazwischen gesehen?(vielsagende Pause) Ich hätte gerne ein paar gesehen.“
Als der ROLLING STONE sich von Jimmy Page verabschiedet, kommt der 70-Jährige noch einmal auf die einsame Sternstunde vor sieben Jahren zurück: „Alle waren inspiriert davon. Alle. Nur scheinbar unser guter alter Robert nicht.“