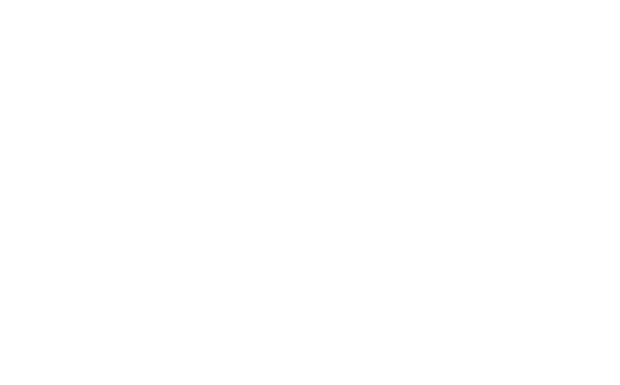Gipfeltreffen auf dem Sofa
Der Dokumentarfilm "It Might Get Loud" widmet sich drei berühmten Gitarristen und ihren Instrumenten.

Nur ein paar Kühe schauen zu, wie sich Jack White vor einer Holzhütte mit wenigen Handgriffen aus einem Brett, Draht, Nägeln, einer Magnetspule und einer leeren Coke-Flasche etwas zimmert, das nicht aussieht wie eine elektrische Gitarre, aber ebenso jault. „Who says you need to buy a guitar?“, fragt er grinsend und überlässt es seinem Werkstück, mit wütendem Fauchen zu antworten. Überhaupt sei es ratsam, so White, als Gitarrist jeder Versuchung zu widerstehen, mittels technischer Apparaturen Zeit zu sparen oder auch nur bequemer zu arbeiten.
The Edge stellt die Gegenthese auf. Es sei gerade der technologische Fortschritt, der Entwicklung in die Musik bringe. Im übrigen reize es ihn, nach neuen Sounds zu suchen. Der U2-Gitarrist, das wundert nicht, benötigt seinen blinkenden Gerätepark, die unzähligen Knöpfe, Schalter und Regler. Für beinahe jeden Song habe er ein anderes Effektgerät, erzählt er nicht ohne Stolz, während er mit seinem Techniker die Anlagen prüft und justiert, Kabel verlegt und Batterien von Fußpedalen so arrangiert, dass es im Konzertablauf nicht zu Verwechslungen kommen kann.
Ein freundlicher und bisweilen etwas verlegen dreinblickender Jimmy Page führt durch Headley Grange, jenes legendäre Anwesen in Hampshire, wo Led Zeppelins viertes und wohl bestes Album entstand. Dort, so der weißhaarige Virtuose, stand Bonzos Schlagzeug für die Aufnahmen von „When The Levee Breaks . Und von dort oben kam das Echo, und dort hinten hingen die Mikrofone. So war das. Faszinierende Einblicke gewiss für jeden, der „Stairway To Heaven“ für ein Meisterwerk hält oder doch zumindest ohne Grausen hören kann.
Doch auch dem Nicht-Fan bietet „It Might Get Loud“ (Kinostart am 27. August) genügend Erhellendes und Erheiterndes für einen reuelosen Kinobesuch. Ein „Rockumentary“ nennt Regisseur Davis Guggenheim seinen Film „über die Evolution der Rock-Gitarre am Beispiel dreier Rockstars, die drei Generationen von Gitarristen repräsentieren“. Guggenheim ist Fan dieser drei, lässt das Wort „Rockstar“ in jedem zweiten Satz fallen und hält, obwohl er für den aufsehenerregenden Streifen „An Inconvenient Truth“ einen Oscar einheimste, seine neueste Arbeit für die befriedigendere, weil schwierigere. „Das Problem war, den kreativen Kosmos dieser Rockstars auszuleuchten, ohne sich in biografischen Details zu verlieren. Wir versuchten das Dilemma zu lösen, indem wir Impressionen und die Erinnerungen der Musiker so anordneten, dass sie eine Erzählstruktur ergeben.“
Tatsächlich sind die dokumentarischen Schnipsel von einst nur Schlaglichter, die für Kurzweil sorgen zwischen den inszenierten Selbstdarstellungen der Protagonisten. Jack White als Dandy und nobler Wilder, der sich selbst in Person eines kleinen Jungen beibringt, wie man zünftig einen Pianohocker zerlegt und derart auf ein Fretboard tritt, dass die Gitarre stöhnt und röchelt. The Edge beim Rundgang durch die Schule in Dublin, wo alles angefangen hatte. Und Jimmy Page, der seine besten Szenen hat, wenn er nichts sagt. Tut er es doch, dann etwa mit dem originellen Vergleich der Rundungen einer Gitarre mit dem Körper einer schönen Frau. Und, das versteht sich von selbst: Beide wollen sie liebkost sein.
Freilich ist es auch Page, der das genuine Highlight des Films setzt, in seinem Haus bei London, genauer: inmitten seiner Plattensammlung. Er blättert in einer Kiste alter Singles, zieht vorsichtig ein London-Sleeve heraus und legt dessen Inhalt auf den Plattenteller. Link Wrays „Rumble“ füllt den Raum und zaubert ein jungenhaft seliges Lächeln auf das Antlitz des Mannes, der mit monumentalem Hardrock reüssiert und den Okkultisten und Satanisten Aleister Crowley verehrt hatte. Page schließt die Augen und dann spielt er Luftgitarre, samt fraglos korrekter Griffe und punktgenauer Breaks, eine Minute nur und doch weggetreten wie im Traum.
The Edge zieht es für solche Momente der Transzendenz hinaus an den irischen Strand, wo er riesige Lautsprecher aufbaut und gegen das Brausen des Meeres anspielt, ganz allein. Jack White zieht sich mit einer Platte seines Vorbilds Son House zurück und braucht für die innere Einkehr darüberhinaus nur einen Plattenspieler, ein vorsintflutliches Bandgerät und natürlich eine Gitarre. „Bei Jack musste alles strikt analog sein“, erklärt Guggenheim, „wir mussten ihm garantieren, nirgendwo digitale Geräte zu verwenden.“ Auch nicht bei der Schluss-Sequenz, „dem Gipfeltreffen“ in einer Lagerhalle in Los Angeles. Wo die Saitenkünstler sich verbal austauschten, „Whole Lotta Love“ anstimmten sowie andere gemeinsame Favoriten und zum Finale, auf einem Sofa, „The Weight“.
Die eigentliche Verheißung des Filmtitels blieb indes unerfüllt, so richtig laut wurde es nie.