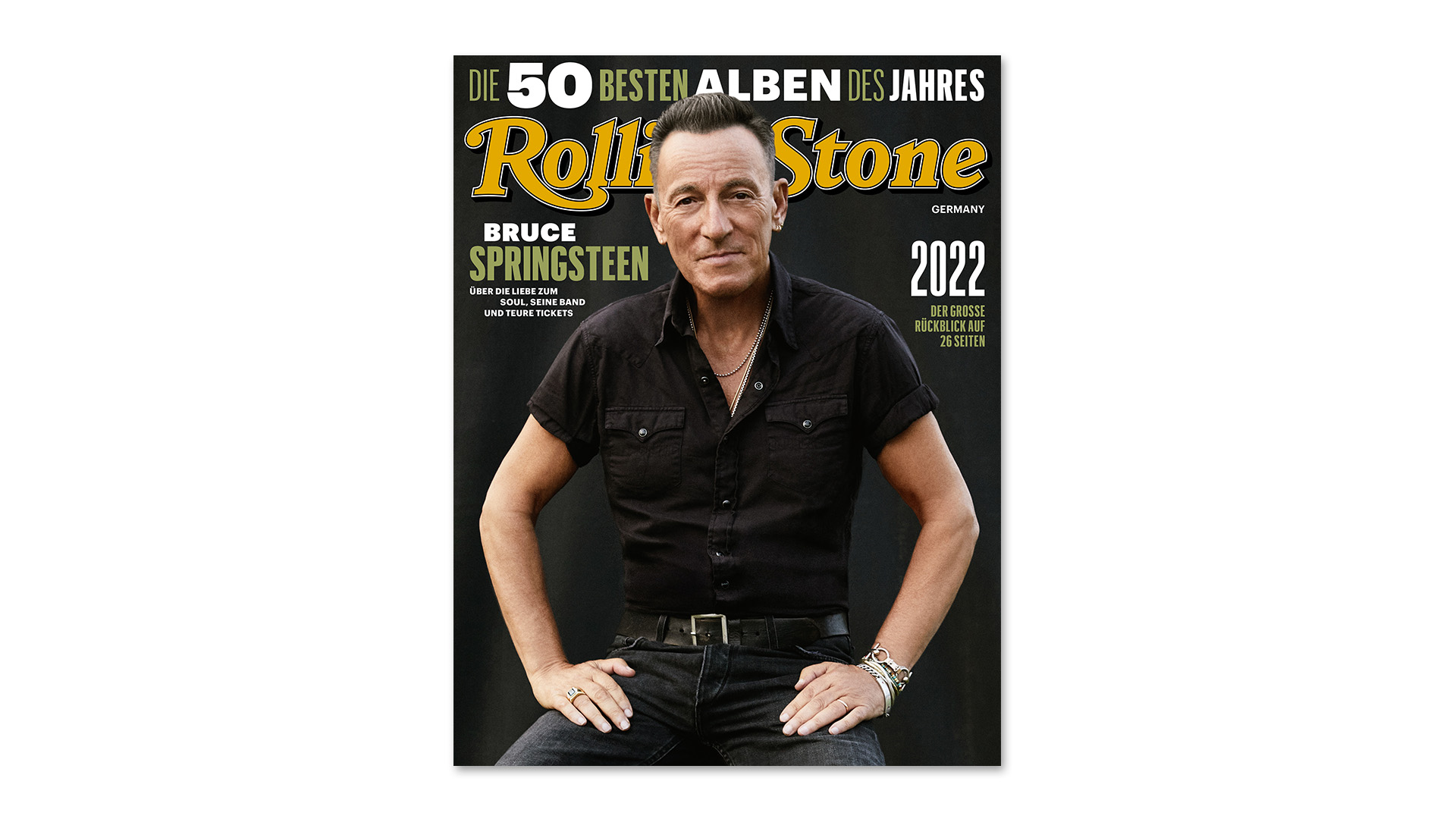Gaz Coombes im Interview: „Indie-Rock hat ein paar Probleme“
Mit „World's Strongest Man“ veröffentlicht Gaz Coombes sein neues Album. Wir sprachen mit dem Ex-Supergrass-Sänger über Männlichkeit, Science Fiction und rechte Psychos.

ROLLING STONE: Auf neuen Songs wie „Oxygen Mask“ singen Sie über Ihre Zukunftsskepsis: fahrerlose Autos.
Gaz Coombes: Ich bin kein großer Sci-Fi-Fan. „Star Wars“ ist nichts für mich. Wenn schon Sci-Fi, dann die Werke mit den kalten und langsamen Prognosen. Mich interessiert, wie Science Fiction unseren Alltag verändert, in kleinen Schritten. Wie Kubricks „2001“, mit seinen Videotelefonen oder den Tablets. Dieser Retrofuturismus ist interessant, aber auch, wie wir die Zukunft heute sehen. Die „What ifs?“. Spielbergs „Minority Report“, das Swiping der Bildschirminhalte, was Wirklichkeit wurde. Die Sache ist: Ich sehe mir das also gerne in Filmen an. Aber ich sehe keinen Nutzen in dieser Scheiße. Schon gar nicht für mein Leben. Auch, wenn in uns Menschen die Sehnsucht nach stetem Fortschritt steckt.
Sie arbeiten also nur mit analogen Geräten?
„Alexa! Wie bereite ich Spaghetti zu?“ Wer will so solche Fragen in einen leeren Raum hineinrufen? Kommt für mich nicht infrage. Man schafft sich Bequemlichkeiten, aber mit Fortschritt hat Alexa nichts zu tun. Meine Musik nehme ich natürlich auch digital auf, ich mag Software …oh Mann, Fucking driverless cars. Die ändern nichts an meinem Leben! Meinetwegen kann es selbstfahrende Trucks geben, die Fracht hin und her bringen … aber dann verlieren doch auch nur die Trucker ihren Job. Meine Güte, das ganze Bohei um die selbstfahrenden Autos, es ist nicht nur kompliziert, ich kann es gar nicht nachvollziehen!
Wofür steht dann die „Oxygen Mask“?
Die Sauerstoffmaske soll Teil eines Survival Kits für meine beiden Töchter sein. Für schlechte Zeiten. Wenn der Druck abfällt im Flugzeug, erst die eigene Maske aufzusetzen, sich dann aber gleich um die anderen Leute zu kümmern. Die Sauerstoffmaske steht außerdem für den Rat, erstmal Luft zu holen, bevor man rumpöbelt. Wegen Social Media schreien sich alle nur an. Ordentlich Sauerstoff zu sich nehmen, durchatmen. Dann in Ruhe reden. Sich selbst in Ordnung bringen.
Kiss-Bassist Gene Simmons fiel mit einer Fehlinterpretation auf. Für ihn steht die Verhaltensfolge im Flugzeug, Sauerstoffmaske erst sich selbst, dann anderen aufsetzen, für die Notwendigkeit egoistischen Verhaltens.
Quatsch. Man kann niemandem helfen, wenn das eigene Haus nicht vernünftig aufgeräumt ist. Das ist alles, was hinter der Sauerstoffmaske steckt.
Für „World’s Strongest Man“ haben Sie sich von HipHop und Frank Ocean beeinflussen lassen, wie viele Musiker Ihrer Generation. Steckt Gitarrenpop in der Krise?
Die Musikwelt ist heutzutage mehr und mehr auf Urban ausgerichtet. Das habe ich schon mit meinem voran gegangenen Album, „Matador“ von 2015, gespürt. Es fehlt im Rock eine Band, die derart nur um sich selbst kreist, dass sie keine Zeit hat nur an Erfolgsziele zu denken. Es darf nie darum gehen, schon mit der ersten Platte in Arenen aufzutreten. Als ich mit Supergrass anfing, verschwendeten wir nicht einen Gedanken an Geld und Girls. Man spielte über Wochen, über Monate in einem kleinen Raum, nur für sich. Von den neueren Bands mag ich Shame. Musik, Stil und Image sprechen eine gute Sprache. Also, Indie-Rock hat ein paar Probleme. Aber ich spiele ja nicht mehr in einer Band, sondern bin Solokünstler. Also schaue ich mir auch sehr genau die Arbeit anderer Solokünstler an. Beck, Frank Ocean.
„Vanishing Point“ mit seiner Zeile „I’ve got to get my fucking head straight“ klingt in seiner überfallartigen Hysterie fast wie Radiohead.
Ich will gar nicht wie Radiohead klingen, denn sie sind einzigartig. Vielleicht ist der Sound, den Sie ähnlich finden, so eine „Oxford-Sache“, wir kommen ja aus derselben Stadt. Ihr Bassist Colin Greenwood wohnt bei mir in der Nähe, und er wollte den Bass auf „Oxygen Mask“ einspielen. Er sagte: „Darf ich?“ Ich sagte: „Unbedingt!“ Meine Vorgehensweise ist die von britischen Kunstschülern, die sich, wenn sie alleine komponieren, im Kopf auch eine Art Fantasy-Lineup aus prominenten Musikern zusammenstellen. Ich habe mir auch angelesen, wie Prince im Studio arbeitete. Erstmal so viele Ideen wie nur möglich in ein Lied hinein verfrachten. Dann nach und nach die Schichten entfernen. Bis man zum Herzen vorgestoßen ist.
„Männer sollten aufhören, sich immer nur bedroht zu fühlen“
Für „Wounded Egos“ haben sie einen Kinderchor engagiert, der singt: „Right wing psychos / All the madness outside”. Wie brachten Sie deren Eltern dazu, das zu erlauben?
Die repetitive Melodie bot sich dafür an, andere Sänger ins Boot zu holen. Kinder waren die natürliche Lösung, denn sie sind unsere Erben und müssen das geradebiegen, was bei uns schiefgelaufen ist. Aufgrund der politischen Aussage war ich darauf eingestellt, dass manche Eltern oder Lehrer den Auftritt der Kinder untersagen würden. Aber sie durften alle mitmachen. Ich war ja nicht der erste Musiker mit dieser Idee, Pink Floyd hatten ihr „Another Brick In The Wall, Pt. II“. Das ist auch ein schöner Aspekt daran, Kinder zu haben. Man hat einen viel aufmerksameren Blick auf Kontroversen.
Der Albumtitel ist angelehnt an Grayson Perrys Abgesang auf die Männlichkeit, sein viel zitiertes Buch „The Descent Of Man“. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Sexismus in der Musikwelt?
In den 25 Jahren mit Supergrass lebten wir wie in einer Blase. Crew, Label und Management schirmten uns ab. Ich habe damals keinen Sexismus bei anderen wahrgenommen, aber es ändert natürlich nichts daran, dass es ihn gibt. Wir waren drei Jungs vom britischen Land. Keiner hat sich als Alphatier aufgespielt. Heute verschwimmen die Geschlechtergrenzen, und das ist gut so. Für unsere allerersten Konzerte bedienten wir uns aus dem Kleiderschrank meiner Mutter. Heute lebe ich mit drei Frauen in unserem Haus, also meiner Ehefrau und zwei Töchtern. Da darf es keinen Platz für männliches Arschlochverhalten geben. Männer hatten seit Anbeginn das Sagen, und es fühlt sich gut an, dass sich das nun ändern könnte. Wir sollten die Herausforderungen annehmen, anstatt sich einfach nur bedroht zu fühlen.