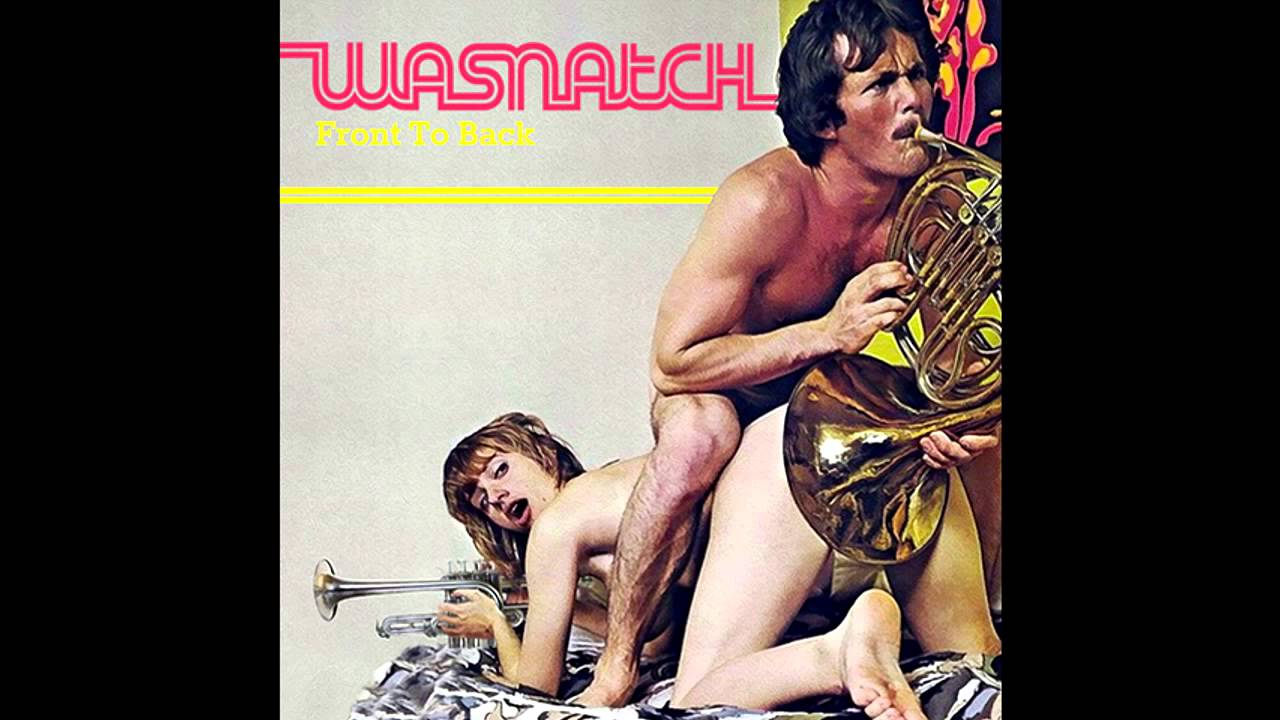Favela-Funk und Molotow-Cocktails

Es war schon eine komisch krude Inszenierung: Da tanzt und singt ein hübsches Mädchen im Minirock vor einem grell animierten Hintergrund, der wie die Graffiti-Version eines Volksaufstands aussieht. Rüben Fleischer, der das Video zu M.l.A.s erster Single „Galang“ drehte, wollte nicht nur die Sängerin zeigen, sondern auch die Kunst der am Londoner Institute of Art & Design ausgebildeten Sängerin. Und prompt gab es einige Kritiker, die über „revolutionary chic“ schimpften und behaupteten, hier würde die Exotik weit entfernter Kämpfe ausgebeutet und vom tatsächlichen politischen Kontext abgekoppelt. Regisseur Fleischer sieht das anders: „Dass wir M.I.A.s Artwork verwendet haben, war absolut notwendig, um sie zu definieren und den Leuten einen Eindruck zu geben. Wie viele gutaussehende Sängerinnen performen denn sonst vor brennenden Palmen, Panzern, Bomben, Molotow-Cocktails und Hubschraubern?“. Aber hat die Künstlerin deswegen eine politische Botschaft?
Ja, denn die Form führt direkt zum globalisierungskritischen Inhalt. Das „Galang“-Video, aber auch die Cover-Artworks der beiden M.I.A.-Alben sehen aus, als seien sie in einem Internet-Cafe in Colombo entstanden: grelle Schockfarben, billigste Grafikprogramme, das illegale Flair von Street Art und die Ikonografie des revolutionären Widerstands. Es ist die visuelle Umsetzung von M.I.A.s anarchischer Collagen-Musik, die keinen Moment nach befriedetem Genre und kultureller Festung klingt, sondern nach dem Culture-Clash der Favelas und Ghettos, die alle Einflüsse aufsaugen und als brodelnden Soundtrack einer unzufriedenen Jugend wieder ausspucken: „Wenn ich morgens aufwache und in London zum Bus gehe, höre ich auf der Straße nicht nur Ragga oder HipHop, sondern marokkanische und indische Musik, wenn ich bei Freunden bin, laufen dort die Pixies – und das alles in 24 Stunden. Wie könnte ich mich da auf einen Stil beschränken?“
Die ersten Jahre ihres Lebens verbrachte M.l.A. in Sri Lanka, wo sie mit dem permanenten Horror des Bürgerkriegs leben musste – in den ihr Vater als Tamilen-Kämpfer involviert war. Als Maya Arulpragasam zehn war, flüchtete ihre Mutter mit den Kindern in das Londoner „Phipps Bridge Housing Estate“. In diesem Gebäudekomplex in der Vorstadt, dessen 4000 Bewohner zu 65 Prozent Unterstützung vom Staat bezogen, war es kaum besser: Einbrüche, Schlägereien, vollgepinkelte Aufzüge und Autos, die auf der Straße vor sich hin rosteten. M.I.A.s Vater Arul „Arular“ Pragasam wurde für M.l.A. damals eine Art Robin Hood, weil er sich in der alten Heimat gegen noch schlimmere Formen von Unrecht und Unterdrückung zur Wehr setzte. Doch die „Liberation Tigers of Tamil Eelam“ (zu denen auch Arulars Gruppe EROS gehörte) sind keine Pazifisten, sondern militante Kämpfer, die auch vor Selbstmordattentaten nicht zurückschreckten.
Dennoch strotzen M.I.A.s Songs und ihr Artwork vor Verweisen auf den bewaffneten Kampf gegen ethnische Unterdrückung und Globalisierung – eine Mischung aus aufrichtiger Haltung und Spiel mit Codes, Symbolen und Slogans: „Ich kann mir den Luxus nicht leisten, über Liebe zu singen und all die angenehmen Dinge das tun schon genug andere. Ich habe permanent das Gefühl, ich dürfe mir nicht alles bieten lassen.“
2004 ließ M.l.A. deshalb auch den tamilischen Tiger (das Wappentier der LTTE) durch ihr kontroverses „Galang“-Video laufen und zeigt bei der Gelegenheit noch das Porträt eines militanten tamilischen Guerilla-Führers. Den Clip zur zweiten Single „Sunshowers“ wollte MTV erst senden, nachdem die Zeile „Like PLO I never surrender“ entfernt wurde. Doch die Künstlerin möchte keine Tabus brechen, sondern einfach klar machen, dass jede Seite ihre eigene Wahrheit hat: „Sunshowers“ handelt davon, wie in den Nachrichten die Welt in Gut und Böse eingeteilt wird. Wie kann man vernünftig über Waffenbesitz und ähnliche Themen reden, wenn Blair predigt, dass man nach einem Angriff doppelt so hart zurückschlagen muss?“
M.I.A.s wütende Pose wirkt ungewohnt in der westlichen Popkultur, die schon lange nicht mehr schreit „Macht kaputt, was euch kaputt macht!“, wie einst Ton Steine Scherben. Egal ob Rock, Pop oder Gangster-Rap: Meist geht es um das Seelenleben satter Mittelklasse-Kids, die abstrakt-ästhetische Inszenierung von Gewalt und den Kult um Marken, die oft mehr zählen als die Rechte der Menschen.
M.l.A. dagegen setzt auf die gefährlich brodelnde Vitalität der Elendsviertel von Colombo bis Gaza. Zu Favela-Funk empört sie sich über Unrecht und Ausbeutung. Ihre Slogans mögen naiv sein, radikal und äußerst subjektiv. Doch es ist eine künstlerische Stimme jenseits der gutbürgerlichen Selbstverliebtheit des Westens – der sich über Gewalt in den Medien empört, aber gleichzeitig Kriege in den entferntesten Winkeln der Welt führt. M.l.A. serviert kein politisches Manifest, sondern eine Popmusik, die instinktiv spürt, dass es mehr als eine Wahrheit gibt.