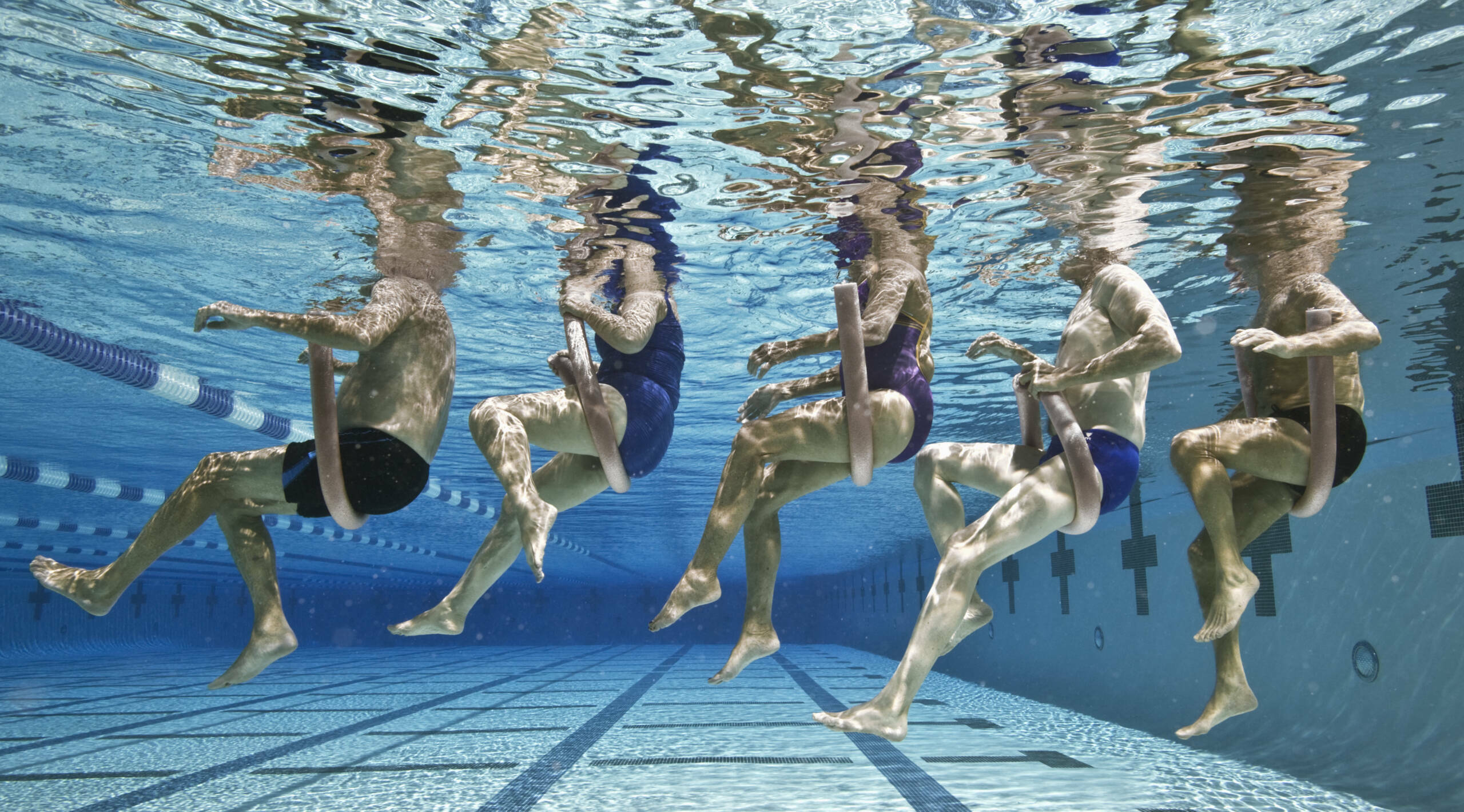Eric Pfeils Pop-Tagebuch: Reggae aus Münster
Über staunenswerte Anmoderationen im Radio, das ostentative Flair deutscher Stadtteilfeste und einen Nasenflötisten aus Ichendorf

Folge 223
Da war sie wieder, diese Anmoderation im öffentlichrechtlichen Radio: „Wir machen weiter mit Country-Rock, der nach amerikanischen Weiten und staubigen Feldwegen klingt. Dabei kommt die folgende Band erstaunlicherweise aus Osnabrück. Sollte man nicht denken. Hier sind …“ Den Rest bekam ich schon nicht mehr mit, weil ich mir vor lauter Schreck den Morgenkaffee ins Ohr gegossen hatte.
Immer wieder höre ich in Sendungen, die nicht vorrangig mit Musik befasst sind, Varianten dieser Moderation: „Die leichtfüßigen Reggae-Sounds, die Sie gerade gehört haben, kommen nicht etwa aus der Karibik, sondern aus Münster. Ja, richtig gehört: Münster!“ Oder: „Wir machen weiter mit luftigem Bossa nova, der – man höre und staune! – nicht am Zuckerhut entstanden ist, sondern in Reutlingen. Hier sind …“ Ich würde gern einen Urlaub unter dem Stein buchen, unter dem diese Anmoderationen verfasst werden. Es muss ein Ort immenser Beschaulichkeit und Weltabgewandtheit sein, wo die Menschen noch Schuhe aus Holz tragen, die Wäsche im Fluss gereinigt wird und Kinder die heimischen Nutztiere siezen müssen.
Der Rest der Welt ist freilich längst eingeweiht: Wenn es eine Sache gibt, bei der man im Jahr 2021 davon ausgehen kann, dass hier die Globalisierung im Gleichschaltungsmodus aus allen Rohren feuert, dann ist es wohl die Popmusik. Immerhin ist es 52 Jahre her, seit Paul McCartney es für eine gute Idee hielt, mit „Ob-La-Di, Ob-La-Da“ einen Ska-Song zu komponieren. Nein, schlechtes Beispiel. Nehmen wir für die Radiomoderatoren lieber etwas Deutsches: 65 Jahre sind vergangen, seit Peter Kraus seine Version von Little Richards „Tutti Frutti“ auf die Menschheit losließ. Dass die Aneignung international erfolgreicher Musikspielarten spätestens seit Erfindung des – Achtung! – Radios zu den Grundtechniken des Musikmachens zählt, scheint bei den öffentlich-rechtlichen Sendern noch nicht angekommen zu sein. In der faszinierenden Parallelwelt des gebührenfinanzierten Rundfunks ist eine Retro-Soul-Band aus dem Landkreis Vechta (und nicht aus Detroit!) ein Anlass für Fassungslosigkeit.
„Denkt man deren Logik zu Ende, so hätten deutsche Musiker eigentlich nur zwischen zwei Optionen zu wählen: Sie könnten entweder bis unter die Augenbrauen tätowiert zu vulgärprovokantem Grunzen und Metal-Geschrubbe mit Pyrotechnik herumhantieren“
Stopp! Es geht hier keineswegs um ein Bashing des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich zähle zu jenen Menschen, die bereitwillig mehr Rundfunkgebühren zahlen würden als verlangt. Auch machen die Moderatoren meines Stammsenders ansonsten einen verlässlich guten Job und informieren in ebenso kompetenter wie differenzierter Weise über Weltgeschehen und Kulturbetrieb. Es sind schlicht diese mit den Gepflogenheiten des Musikbetriebs offenbar gänzlich unvertrauten An-und- Abmoderationen. Denkt man deren Logik zu Ende, so hätten deutsche Musiker eigentlich nur zwischen zwei Optionen zu wählen: Sie könnten entweder bis unter die Augenbrauen tätowiert zu vulgärprovokantem Grunzen und Metal-Geschrubbe mit Pyrotechnik herumhantieren. Oder sie entschieden sich, roboteresk auf Synthesizern herumzudrücken. Okay, Blasmusik und Schlager wären auch erlaubt. Alles andere – komplett verrückt.
Dabei ist es ja tatsächlich umgekehrt: Ich möchte behaupten, dass es in Deutschland weitaus mehr Reggae- und Soul-Bands gibt als Vertreter motorisch pluckernder Teutonen-Elektronik. Auch laufen hierzulande entschieden mehr Gitarrenbarden amerikanischer Prägung durch die Gegend als Klaus-Nomi-Wiedergänger. Man mag das bedauern. Es hat aber schlicht damit zu tun, dass sich mit der Nachahmung international gängiger Gebrauchsmusik-Spielarten mehr Geld verdienen lässt. Sollte es irgendwann mal wieder Stadtteilfeste und Autohauseröffnungen geben (und wer hungerte nicht danach?), werden Sie feststellen, dass auf diesen Veranstaltungen der deutschproduzierte Latin Pop das Zepter schwingt. Menschen, die zu einem monotonen Beat 15 Minuten lang ihren Synthesizern kosmisches Flirren entlocken, findet man dort selten. Vielleicht war ich aber auch nur jahrelang auf den falschen Stadtteilfesten.
Pardon, das musste mal raus. Jetzt aber weiter im Programm mit einem Musiker namens Walden. Er singt zauselige HöhlenbewohnerMantras und begleitet sich selbst auf der Nasenflöte. Und das Irre: Er lebt gar nicht auf La Gomera, sondern in Quadrath-Ichendorf!