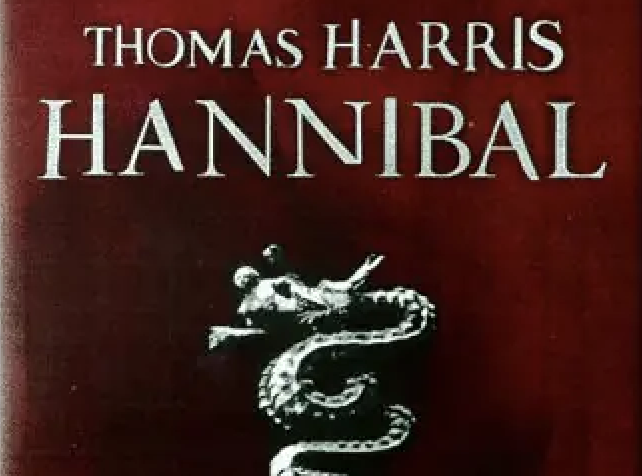Ein Anarchist stürmt die Traumfabrik
Der Filmkomponist und gebürtige Frankfurter HANS ZIMMER hat sich den Respekt verschafft, für seine Scores wie von "Gladiator" und "M:I-2" Millionengagen und Narrenfreiheit zu fordern

Hoch ’n Toast, noch ’n Ei, noch ’n Kaffee, noch ’n Brei. Oder wenigstens den Kaffee und dazu ’ne halbe Schachtel Zigaretten. Dann lässt es sich mit Hans Zimmer schon reden wie man sagt das so leichthin mit ’nem Doofen. Was nichts Anderes bedeuten soll als: Der Mann kennt keine Allüren, führt kein aufgeblähtes Ego spazieren. Obwohl es dafür ausreichend gute Gründe und sogar annehmbare Entschuldigungen gäbe. Wenn nämlich in bundesdeutschen Medien wieder einmal von „unseren Männern in Hollywood“ die Rede ist, dann fällt eben diesem die dritte Geige hinter Emmerich und Petersen regelmäßig in den Schoß. Glück für ihn, dass nicht jedem bei seinem Namen auch gleich etliche Gerüchte und Geschichten aus der Traumfabrik einfallen.
Ihm selbst übrigens auch nicht. Oder: Er hat keine Lust, sie zu erzählen. Noch wahrscheinlicher indes ist, dass jenem schlicht die Zeit fehlt, sich allzu häufig mit der glamourösen Seite seiner Wahlheimat einzulassen. Vor ein Uhr mittags steht der Mann nur selten auf, vor fünf Uhr morgens geht er noch seltener ins Bett. Dazwischen allerdings nutzt er nicht seinen Pass als VIP-Card, dazwischen kühlt er sein Fieber, seine Passion und niemals seinen Mut. Er arbeitet. Wie ein Besessener. Wer zu Hollywoods erstem Dutzend freischaffender Filmkomponisten zählt und den Produzenten Gagen in Millionenhöhe abverlangen darf, ohne das Riechsalz in der Jackentasche mitfuhren zu müssen, brauchte das eigentlich nicht wirklich tun. Wem aber sechs Soundtracks pro Jahr kaum genügen und zudem der Ruf eines verkappten Anarchisten der Branche ein beinahe unschätzbarer Wert bedeutet, darf nicht kleckern.
Dafür immerbin lächelt Hans Zimmer auch jetzt, wo er sich an die letzten fünf Stunden Schlaf am Stück „gar nicht mehr erinnern kann“, noch frohgemut in die Gegend. Und das, obwohl er sich gerade wieder mal hat einspannen lassen in die Werbemaschinerie für sein jüngstes Projekt. „Ich mache das nur sehr selten“, ringt Zimmer mit den deutschen Vokabeln, die er seit seinem Umzug nach England als 13-Jähriger langsam zu vergessen droht, „aber manchmal hat man eben an einem Film mitgearbeitet, der so toll geworden ist, dass man hinterher am liebsten auf die Straße liefe und es allen erzählen würde.“ Wäre jetzt ein Promoter im Raum, es hätte Beifall gegeben. Und anschließend hätte ihn Hans Zimmer vermutlich galant rausgeschmissen.
Wasserträger, Satelliten, Plattenfirmen – alles Dinge, die er nicht besonders schätzt, „ich bin nicht beim Zirkus, ich mache Filme“. Als Komponist? Als Empfänger lukrativer Aufträge, aber halt doch mit Liefertermin und ziemlich strengen Vorgaben? „Solche Komponisten“, sagt Hans Zimmer da und lässt nicht mal die leiseste Ahnung von Arroganz aufkommen, „gibt es natürlich auch. Ich gehöre zum Glück nicht dazu. Denn ich biete keine Dienstleistung an, sondern liefere Ideen. Und dafür verlange ich viel.“
Das lässt sich in Mark und Dollar gar nicht fassen. Aber wenigstens vortrefflich anhand des schon erwähnten und -nebenjohn Woos“M:I-2″ – neuen Projektes beschreiben, über das ja nun endlich auch geredet werden soll. Irgendwann sei ein Anruf von Ridley Scott gekommen, für dessen Filme „Black Rain“ und „Thelma & Louise“ er bereits die Musik geschrieben hatte. Der Mann wusste also, worauf er sich einlässt, als er nun für sein Sandalen-Epos „Gladiator“ den alten Weggefährten wollte. „Und wie üblich hatte er mir sechs Monate zur Verfügung gestellt. Er ist gar mit seinem kompletten Schnittstudio bei mir eingezogen, damit ich ihn auf jeden Fall rund um die Uhr mit dummen Fragen löchern konnte.“ Die Musik sei bei einem Film, „der selbst der Hauptfigur keine zwanzig Minuten Text zumutet“, keine Nebensache. Und in einem Film, für den Hans Zimmer Notenblätter vollschreibt, sowieso nicht. Es muss ja wenigstens ein paar gute Gründe dafür geben, ein Revolutionär der Leinwand-Musik genannt zu werden. Einen kennt sogar Zimmer selbst: „Früher glaubte man, dass Filmmusik bloß als Krücke tauge, wenn die Bilder mal weniger großartig waren, und klammheimlich wieder im Nichts zu verschwinden habe, wenn die Optik wieder stimmte. Ich finde aber, man braucht auch auf der Leinwand echte Songs, mit einem Anfang, einer Mitte und gerne auch einem dramatischen Finale. Denn schließlich komme ich ja vom Rock’n’Roll-“ Was kein Märchen ist 1976 hatte Zimmer in London gemeinsam mit Trevor Horn und Geoff Downes The Buggles gegründet. Ein Projekt mit zwei wichtigen Resultaten für den vor 42 Jahren in Frankfurt geborenen Künstler: Mit „Video Killed The Radio Star“ hatte man einen (böse Zungen sagen: gerade mal einen) internationalen Superhit, „und nach dem ersten Versuch, eine Tournee und somit die Karriere als Popstar zu organisieren, war ich von diesem Traum auch schon für immer und ewig geheilt.“ Es sei wirklich alles wie in einem schlechten Film über die Abgründe des Musik-Business gewesen, „von dem ständigen Gezänk bis zu den Gagen, die ich nie gesehen habe“. Danach wollte Hans und gerade grinsend berichtet, dass er die Musik zum „Gladiator“ erst „acht Wochen vor Filmstart fertig hatte. Beziehungsweise, etwas ehrlicher gesagt: herausgegeben habe“. Auf die spätestens seit „Titanic“ bekannte, höchst effiziente Wechselwirkung von Platten- und Filmpromotion musste also leider, leider verzichtet werden, „der Trailer ist ohne Musik in die Kinos gekommen, ich hatte dafür mehr Zeit zum Nachbessern“, erklärt Zimmer. Eine neue Zigarette, Anarchistenblick. So gewinnt man also Oscars, Grammys und den künstlerischen Luxus, „neun von zehn Angeboten abzulehnen“. Mehr Zimmer lieber ohne Bühnen und im Hintergrund, dafür aber für bessere Filme leben.
Beides ist ihm gelungen. „Und heute brauche ich mich nicht mit irgendwelchen Plattenfirmen herumschlagen, die auf Vertragserfüllung bestehen und mir sofort auf die Pelle rücken, wenn es mal länger dauert. Diese Buchhalter glauben ja immer, für derart viel Geld müsse ein Musiker jeden Morgen mit brillanten Ideen im Kopf aufwachen. An den meisten Tagen aber fällt mir gar nichts ein, oder ich bringe die letzte Scheiße zu Papier.“
Heute schließt Hans Zimmer seine Verträge immer nur für ein Projekt zur Zeit ab – was bei sechs Filmen pro Jahr sechs Alben ergibt. „Welches Label würde mir das wohl erlauben?“ Wir überlegen gar nicht erst. Zumal Zimmer uns schon wieder neidisch macht noch: Hans Zimmer kann es sich leisten, die unter Schauspielern üblichen Kriterien für ein Engagement umzukehren. „Wenn mir ein Script nicht sonderlich gefällt, der Regisseur aber nett ist und eine gute Atmosphäre und viel Spaß verspricht, ist mir das Script halt scheißegal.“ Und die Gage auch. Für einen Dollar will Zimmer schon komplette Soundtracks geschrieben haben, „und ich habe mich auch einmal mit einem sehr erschwinglichen Gemälde bezahlen lassen“. Als daraufhin sein Agent die berechtigte Frage nach seinem Anteil stellte, hatte Hans Zimmer auch dafür eine Lösung parat: „Er hat ein Polaroid von dem Bild bekommen.“ Durchaus möglich, dass beim nächsten Film wieder ein bisschen härter verhandelt wurde.
Und der kommt für Hans Zimmer stets schneller, als der Künstler sich umsehen kann. Seit er als Novize 1983 Nicolas Roegs „Eureka“ mit Takten und Tönen versorgte, ist der Strom von Aufträgen nicht mehr versiegt. Bernardo Bertoluccis „Der letzte Kaiser“, „Green Card“ mit Gerard Depardieu, die Komödie „Cool Runnings“, Tony Scotts „True Romance“, Disneys Zeichentrick-Kassenschlager „König der Löwen“ (für den er den Oscar entgegennahm), „Nine Months“, „The Rock“, oder „Das Geisterhaus“ und „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ vom deutschen Produzenten Bernd Eichinger sind nur höchst fragmentarische Auszüge aus Zimmers Poesie-Album, bekannte Namen wie Stephen Frears, Bruce Beresford, John Schlesinger, Mike Nichols, Brian Henson, Bille August oder eben Ridley Scott auch bloß ein Schnipsel aus der Kundenkartei. Dass kaum ein anderer Deutscher in Hollywood da mithalten kann, weiß auch Hans Zimmer selbst nur mit einem Griff in den Zitatenschatz zu erklären. „Napoleon soll einmal gesagt haben, er wolle keine genialen oder wagemutigen Generäle, sondern lieber welche, die Glück haben. Ich glaube, in seiner Armee hätte ich gute Chancen gehabt.“
Bessere jedenfalls als bei den deutschen Medien. Denen fällt nur immer wieder dieselbe, dumme Frage ein, „und ich sage jedes Mal wieder, nein, ich hätte nichts dagegen, auch für deutsche Filme zu arbeiten. Aber dass es dazu kommen wird, glaube ich weniger.“ Als er mit Eichinger „Das Geisterhaus“ vertonte, „da musste ich mit einem Münchner Orchester arbeiten. Es war grauenhaft. Das waren alles nur Beamte, keiner hat sein Instrument aus Liebe gespielt, die haben bloß auf den Feierabend und ihre Gage gewartet.“
Dann doch lieber Hollywood, „wo Verrückte noch was gelten. Die Musik zum „König der Löwen‘ etwa hab ich bloß gemacht, weil ich vor meiner kleinen Tochter angeben wollte. Die darf meine Filme sonst ja nicht sehen.“ Die Kleine war begeistert. Und dass dieses Album auch noch 14 Millionen mal verkauft wurde, „hat mich nicht mehr interessiert“.
Wir glauben ihm. Schon weil Hans Zimmer jetzt wieder dieses umwerfende Anarchistenlächeln auflegt.