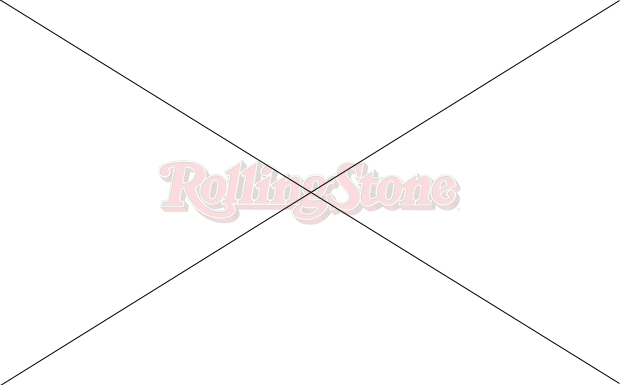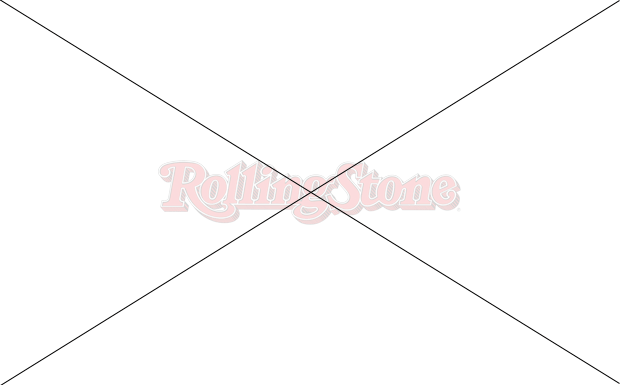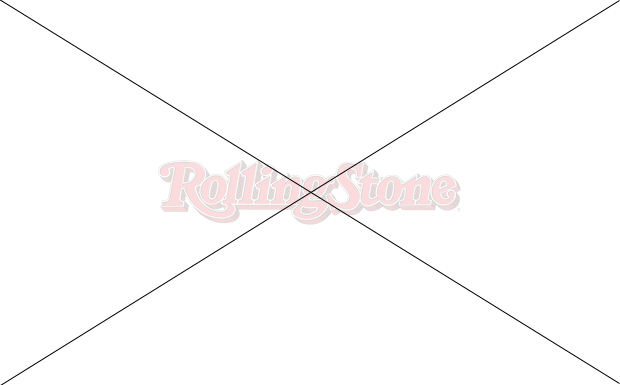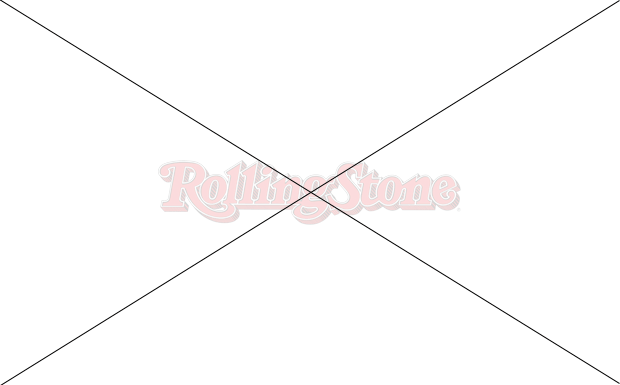Die unbesungene Metropole: Fünf Alben aus Glasgow
Bei aller Verehrung des UK als unerschöpfliches musikalisches Quell und nimmermüder Impulsgeber der Popmusik, bleibt seine drittgrößte Metropole nicht selten unbesungen. Im Rahmen eines großen Glasgow-Specials befragte das aus dem Forum entstandene Musikmagazin get happy!? seine Redakteure und Autoren zu ihren liebsten Alben von Künstlern, die in der Stadt einst beheimatet waren, dort musizierten - oder es bis heute tun.

Empfehlungen der Redaktion

Fotos: Die unbesungene Metropole: Fünf Alben aus Glasgow
Mehr News und Stories