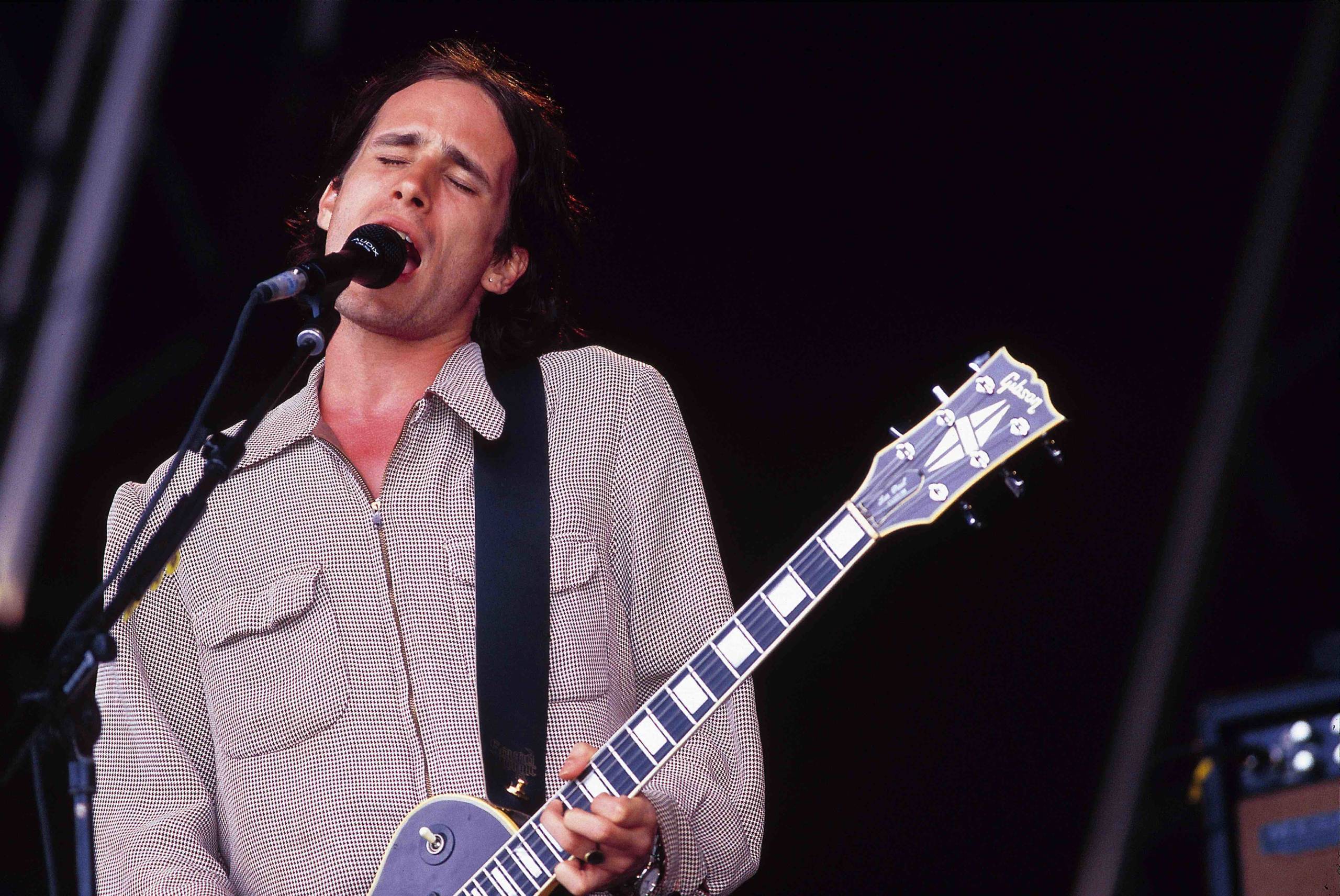Die digitale Welt hat viel mehr Punk zu bieten als die analoge
Das unbedingte Wollen, etwas zu tun, was man eigentlich nicht kann, findet inzwischen schon längst unter neuen Vorzeichen statt.

Wie weit die Erschütterungswellen des Punkrock trugen, ist schnell erzählt. Do it yourself, ob als musikalisches oder produktionstechnisches Prinzip, machte Dinge möglich, die zuvor unmöglich schienen. Weder die folgende Kreativexplosion namens New Wave noch die selbstbewusste Gründung und Ausbreitung unzähliger Indielabels wären ohne Punk denkbar.
In Großbritannien lebte Punk als stumpfe Traditionslinie in noch heute als Oldiebands tourenden Vertretern wie Sham 69 und Luxus-Boxsets mit rumpeligen Sex-Pistols-Live-Aufnahmen fort, während schon Ende der 70er-Jahre das Ska-Revival der Specials, die Bläsersätze der Dexys, Siouxsies Düsterbeats und die elektronischen Sounds von Gary Numan in neue Richtungen wiesen.
Das Prinzip Punk lebt
Der aufregende, moralisch rigide US-Hardcore von Bands wie Dead Kennedys, Black Flag, Minutemen und Meat Puppets wurde schließlich von Bad Religion & Co. versimpelt und von Green Day in den Mainstream überführt. Und in Deutschland waren die Einstürzenden Neubauten das eine, Die Toten Hosen das andere Ende dessen, was man Punkrock nennen kann. Ob Noise-Pop, Industrial, Grunge oder Riot Grrrls: Das Prinzip Punk lebt – und ist lebendiger als die Musik, die unter diesem Label firmiert.
Immer wenn ich heute Musik höre, die mich zu der Frage zwingt: „Geht denn das, und geht das nicht zu weit?“, fühle ich mich an Punk erinnert. Die kompromisslose Leidenschaft, das provozierende Artikulieren von Wut, Angst, Ungeduld, Lust und das unbedingte Wollen, etwas zu tun, was man eigentlich nicht kann: All das ist Punk – und der findet sich heute eher in der digitalen als in der klassischen Rock’n’Roll-Welt. Ungerecht? Nein, Punk.