Die 50 besten Doppel-Alben aller Zeiten

Hüsker Dü: „Warehouse Songs And Stories“ (1987)

Mit „Zen Arcade“ hatte das Punk-Trio aus Minneapolis bereits ein Doppelalbum veröffentlicht, das 1984 den Wechsel vom Hard- zum Melodie-Core einleitete. Ein Vertrag beim Majorlabel Warner folgte. Die Masterminds Bob Mould und Grant Hart entdeckten die Finessen der Studioproduktion. Der Wettbewerb untereinander schoß ins Kraut. So entstanden 20 filigrane Tracks, eher Song-Katalog als stringentes Konzept. Während Mould mit „Could You Be The One?“ oder „Ice Cold Ice“ Americana auf Speed beisteuert, komponiert Hart den Shanty „She Floated Away“. Das Duo, das nicht mehr zusammenfindet, schafft so eine Vielfalt, die zum Steinbruch für die Grunge-Generation wird. RN
Prince: „Sign ‚o‘ The Times“ (1987)

Sein meistgefeiertes Album, vielleicht das meistgefeierte Doppelalbum der 80er-Jahre, war ironischerweise jenes, das Prince schnell wieder vergessen wollte: Die Plattenfirma ließ ihn aus Angst vor mangelnden Verkäufen die Tripel- zur Doppel-LP mit 16 Songs kürzen. Wurde seine Vision damit zerstört? Auch das verkleinerte Werk ist noch immer gigantisch. Es war sein Debüt als politischer Komponist, wie in „The Cross“ oder dem Titelsong, der Aids, Armutskriminalität und die Unkosten der Raumfahrt thematisierte. Nicht weniger aufwühlend war es im Privaten: In „If I Was Your Girlfriend“ sehnt sich Prince in den Körper einer Frau hinein – damit er endlich versteht, was Frauen wollen. SN
The Cure: „Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me“ (1987)

Nach zwei Jahren Studiopause, der bis dato längsten, kehrten The Cure sogleich mit ihrem ersten Doppelalbum zurück. Schon der – damals noch nicht anstößige – Arbeitstitel „1.000.000 Virgins“ offenbarte Getriebenheit. Er zeigte wohl, dass Robert Smith Lieder als Tabula-rasa-Wesen betrachtete, die er mit Sexualität ausfüllen könnte. Sein Jauchzen und Stöhnen waren neu und ungewohnt.
Für ihr bis heute vielleicht bedeutendstes Werk gingen The Cure erstmals in ein ausländisches Studio, das Miraval in der 900-Seelen-Gemeinde Correns. Spuren der südfranzösischen Riviera-Hitze finden sich im Funk von „Hot Hot Hot!!!“ oder dem Voodoo-Flair von „The Snakepit“.
Entstanden sind poetische Traumdeutungen („If Only Tonight We Could Sleep“) und mit „Just Like Heaven“ der wohl populärste Cure-Song, der sich um Hyperventilation und Ohnmacht dreht. Dennoch war auch Negativität eine Triebfeder. Umfänglich wird der Entfremdung („How Beautiful You Are“) und Gewaltandrohungen Platz eingeräumt – „Shiver And Shake“ und „Icing Sugar“ behandelten die Frage, ob sich der alkoholkranke Kindheitsfreund und Co-Musiker Lol Tolhurst loswerden lässt, indem man ihn bei den Aufnahmen anschreit.
Die größte Besonderheit dieses Doppelalbums aber liegt in der Abwesenheit jeglichen Erzählflusses zwischen den Liedern. Die 18 Songs verbindet kein roter „Kiss Me“-Faden, keine auf- und abschwellende Dramaturgie. Die Sequenzierung erscheint erfrischend willkürlich, und wer im damals anbrechenden Digitalzeitalter die CD im Zufallstrack-Modus hörte, stieß auf selbst konstruierte, aber nicht weniger sinnhafte Zusammenhänge.
Viele ihrer Alben haben The Cure schon in ganzer Länge aufgeführt – dieses wunderschöne Monster wartet noch darauf. Sassan Niasseri
Metallica: „… and Justice for all“ (1988)

Jason Newsteds Bassspiel sei „absolut fantastisch“ gewesen, gibt Produzent Flemming Rasmussen später augenzwinkernd zu Protokoll, „auch wenn so wenige Leute es gehört haben“. Newsted, der Nachfolger des verstorbenen Bassgenies Cliff Burton, musste untergebuttert werden, so wollte es die Bandpsyche. Die Aufnahmen waren eben auch Trauerarbeit, davon zeugt nicht zuletzt „To Live Is To Die“, eine Collage aus Burton-Riffs. „Justice“ zeigt aber auch die zunehmende Prätention der Band. Man wollte nicht einfach noch ein weiteres Thrash-Album aufnehmen, sondern ein Kunstwerk. Gelegentlich verhebt man sich dabei, aber Songs wie „One“ machen die Mühen der Ebene wieder wett. FS
Sonic Youth: „Daydream Nation“ (1988)

Urknall des Indie-Rock: „Daydream Nation“ griff 1988 all die kleinen Verästelungen seit NY-Punk und No Wave auf, verband Oldschool mit Gegenwart und öffnete sie in die Zukunft (auch wenn der Teenage-Aufstand dann eher schlafloses Rumlungern in Seattle war). Das Quartett präsentierte nach einem knappen Jahrzehnt gemischt gelungener Experimente das Ergebnis: noisigen Rock, der den subkulturellen Kanon als gültigen Pop setzte. Vom Richter-Cover zur Warhol-Hommage, von der J‑Mascis-Inauguration zur Art-rockigen „Trilogy“, von den brausenden Gitarren und dem dreschenden Drive bis zur schneidigen Coolness der Stimmen: ein Dokument künstlerischen Stolzes. MS
U2: „Rattle and Hum“ (1988)
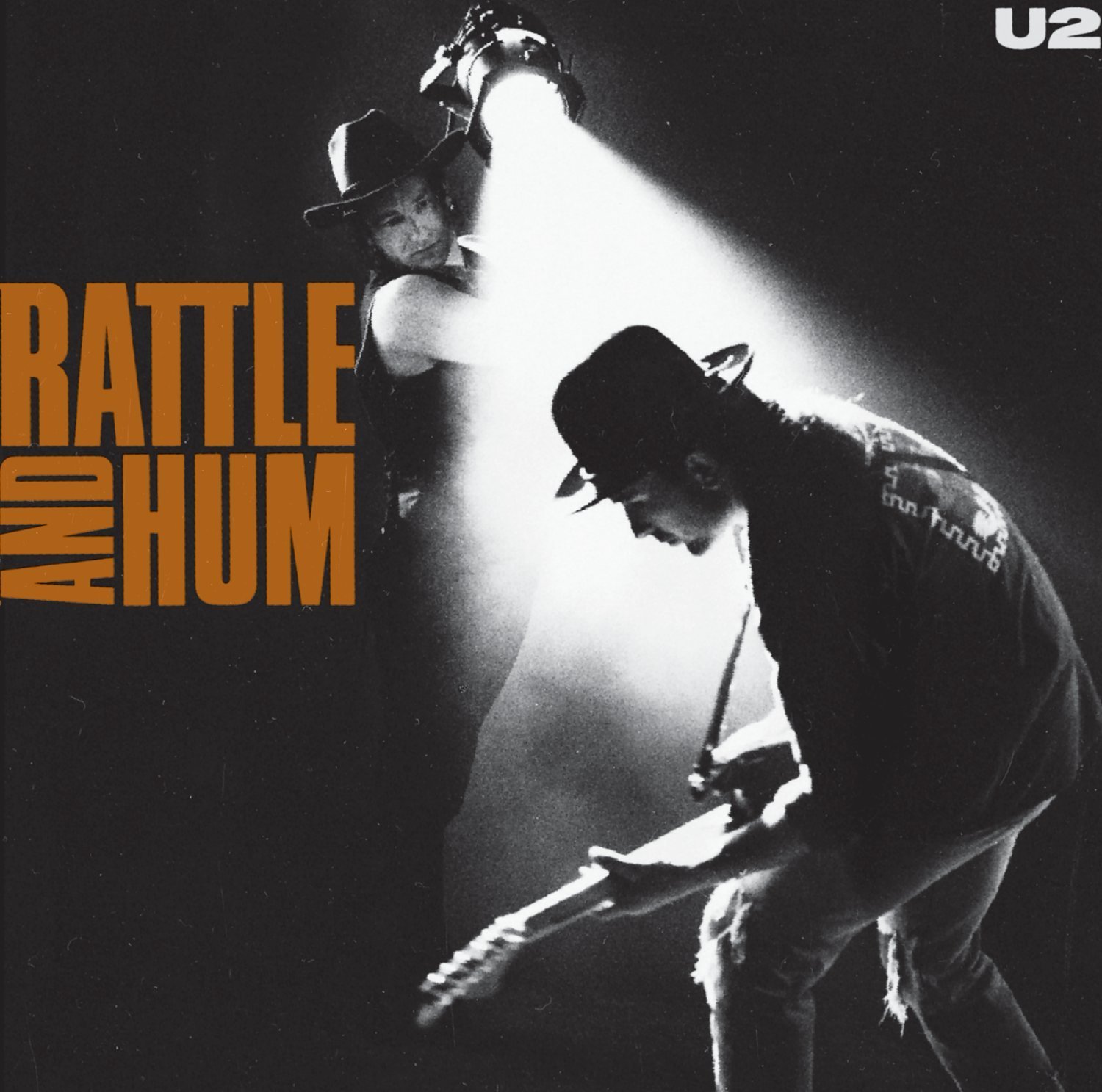
Es war eines dieser ca. 14 bis 28 Jahre, in denen wieder mal behauptet wurde, U2 hätten ihren Zenit überschritten. 1987 war das Meisterwerk „The Joshua Tree“ erschienen, die Tour dazu ein Triumph geworden. „Rattle And Hum“ feiert das, ohne falsche Bescheidenheit. Phil Joanous Film nervt manchmal mit seiner Bedeutungsschwere, aber auf dem Doppelalbum bleiben neben famosen Covers und Live-Versionen einfach etliche sehr gute Songs übrig, sozusagen irische Americana: The Edges „Van Diemen’s Land“, „Desire“, „Love Rescue Me“ (mit Bob Dylan) – und das nur oberflächlich zynische „God Part II“ verzückt mit dem Bekenntnis, dass Rock’n’Roll vielleicht nicht die Welt verändern kann. Aber die Liebe! BF
Smashing Pumpkins: „Mellon Collie and the Infinite Sadness“ (1995)

Im Herzen ist Billy Corgan ein Hardrocker der Siebziger. Nach dem Welterfolg „Siamese Dream“ konnte er sich seinen Jugendtraum vom Doppelalbum erfüllen. Die Aufteilung der LP-Hälften in dramatisierte Tageszeitbeschreibungen („Dawn To Dusk“, „Twilight To Starlight“) wird bis heute kopiert. Die Anzahl der Songs, 28, machte im Gegensatz zu manch anderen 90er-Jahre-Platten das Doppelalbum-Format aber tatsächlich zwingend. Die Stilvielfalt war überwältigend: Neoklassik, Metal, New Wave und Grunge-Rock. Das typische Doppelalben-Gedankenspiel „Könnte man das Werk zur Qualitätssteigerung auch auf eine Scheibe eindampfen?“ würde hier ins Leere laufen. Kein Gramm Fett zu viel. SN
Guns N’ Roses: „Use Your Illusion I & II“ (1991)

Es ist etwas geschummelt, hier einfach „Use Your Illusion I & II“ hinzuschreiben, denn es sind ja zwei Doppelalben. Aber wie sollte man sich für eins davon entscheiden? Sie erschienen zeitgleich im September 1991 (eine Woche vor „Nevermind“), und die Spannung hätte nicht größer sein können, denn mit „Appetite For Destruction“ hatten Guns N’ Roses 1987 eins der größten Rock-Debüts aller Zeiten hingelegt, und dann gab es lauter Chaos und Streit und Verzögerungen und Gerüchte und natürlich zu viele Drogen, zu viel Alkohol, zu viel von allem. Die Leute, denen Axl Rose, Slash, Izzy und Duff mit ihrem ungenierten Rock’n’Roll-Gebaren sowieso schon auf die Nerven gingen, hatten sie längst als gestrig abgeschrieben, doch die beiden Doppelalben waren ein Triumph – kommerziell, vor allem aber künstlerisch: Auf „Use Your Illusion“ gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Außer Genügsamkeit.
Wie bei den meisten Doppelalben ist auch hier nicht jeder Song unverzichtbar, doch die 30 Stücke gehen in so viele verschiedene Richtungen, dass die Schwächen fast nötig sind, um das Gesamtwerk auszuhalten. Axl brachte die Klavier-Epen mit, Slash die Hardrock-Wucht, Izzy den trockenen Blues und Duff den rattigen Punk (oder was wir damals gerade dafür hielten). Zwischen der Wut von „Don’t Damn Me“ und dem Psychotrip von „The Garden“, der Gnadenlosigkeit von „Civil War“ und der Traurigkeit von „Don’t Cry“, der Resignation von „Dead Horse“ und dem Trotz von „Breakdown“ liegen Welten, und da sind die Großwerke „Estranged“, „November Rain“ und vor allem „Coma“ noch gar nicht dabei.
Wie Axl Rose in „Coma“ in zehn Minuten einen Drogensuizid durchspielt, eine Nahtoderfahrung greifbar macht und dann ins Leben zurückdrängt: Das sorgt auch nach 29 Jahren noch für Herzrhythmusstörungen. Natürlich kann man „Back Off Bitch“ als misogyn abtun, aber wie all die anderen Liebeshasslieder würde es andersrum genauso funktionieren – und manchmal ist der Gram der gebeutelten, halt doch gar nicht so harten Männer auch putzig, bei der Ihr-seid-alle-so-gemein-Journalistenschelte „Get In The Ring“ etwa oder beim patzigen Schunkler „You Ain’t The First“: „You was just a temporary lover, honey/ You ain’t the first/ Lots of others came before you/ But you’ve been the worst.“ Gut, der Schluss-Rap „My World“ wäre vielleicht nicht nötig gewesen, obwohl der Satz „You ain’t been mindfucked yet“ das komplette GN’R-Erlebnis eigentlich recht gut zusammenfasst.
Keine zwei Monate nachdem „Use Your Illusion I & II“ erschienen waren, verließ Izzy Stradlin die Band, dem verschlossenen Gitarristen war die Aufregung zu viel. Die Welttournee ging weiter, es gab noch mehr Chaos und noch mehr Streit, 2008 dann Axls Auferstehung mit „Chinese Democracy“ und 2016 die unwahrscheinliche Wiedervereinigung. Im Sommer touren Guns N’ Roses unter dem Motto „Not In This Lifetime“ noch einmal durch Deutschland. Es ist anrührend zu sehen, dass Axl, Slash und Duff überhaupt noch leben und relativ fit auf der Bühne stehen. Doch ohne Izzy war es nie mehr dasselbe. Birgit Fuss
Es gibt nicht viele Stimmen, die aus dem Meer der Stimmen auftauchen und die Oberfläche durchdringen. 1997 gehörte diese Stimme Erykah Badu, ihr erstes kreatives Lebenszeichen hieß „On & On“. Badus Stimme wand sich um einfaches Geklöppel und eine rudimentäre Melodie, sie sang unfassbar viele Wörter, wie man es sonst nur von akrobatischen Rappern kannte, und man hatte keine Ahnung, wovon sie sang (von wie Steine rollenden mystischen Zahlen und der Fütterung des Geistes zum Beispiel). Badus Debütalbum, natürlich „Baduizm“ betitelt, führte den Neosoul aus der Aseptik der Endneunziger in die jazzy Rhythmik der Roots. Deren Schlagzeuger, Questlove, war einer der Produzenten (und brachte Ron Carter mit), und er sollte auch drei Jahre später wieder dabei sein (und diesmal Roy Ayers mitbringen), als Erykah Badu das schwierige zweite Album aufnahm.
Schwierig, weil zweite Alben, die auf große Debüts folgen, keine leichte Aufgabe sind, und schwierig, weil ein neues Millennium anbrach und Badu ihren Punkt bereits im alten gesetzt hatte. Eine gute Idee also, ein Sequel zu ihrem allerersten Track einzubetten. „… & On“ reflektiert auf lässige Weise die Einwände gegen ihre afrozentristische Mystik (die sie allerdings erst in den Folgejahren richtig ausleben sollte): „What good do your words do / If they can’t understand you/ Don’t go talkin’ that shit, Badu, Badu.“ Dazu benötigt sie nicht weniger Wörter als zuvor, aber auf „Mama’s Gun“ sind sie klarer. „Bag Lady“ erzählt von der Selbstermächtigung einer Afroamerikanerin, „Didn’t Cha Know?“ vom Fehlermachen und -verzeihen. Nicht weniger als 14 Stücke bietet Badu auf, alle toll, alle unterschiedlich und alle die Tradition des 70er-Jahre-Soul aufgreifend, von Sly Stone bis Stevie Wonder, die ganze Breite und Fülle.
Erykah Badu eröffnet „Mama’s Gun“ mit einer genuschelten To-do-Liste („I have to write a song, warm up the apartment, I need to take my vitamin“), die sie dem musikalisch retrospektivsten Moment des Albums voranstellt, der ausladenden Funk-Rock-Nummer „Penitentiary Philosophy“. Ein Opener, der einen dicken Schlussstrich unter den Minimalismus von „Baduizm“ zieht. Danach wird es smoother. Ein anderer Vergleichspunkt ist D’Angelos im selben Jahr im Electric-Lady-Studio aufgenommenes Album „Voodoo“, das sich ebenfalls der antiken Analogtechnik des berühmten New Yorker Produktionsraums bedient. Selten stand Retro deutlicher im Hier und Jetzt als auf diesen beiden Doppelalben. Es ist, als hätte sich uralte Musik über eine lange Traditionslinie ins neue Millennium hinein verändert und verästelt wie das ihr Werk grundierende Thema Rassismus, das, obwohl verästelt und erforscht, noch immer als ungelöste Frage in Amerikas Gegenwart steht. Und Amerikas Mythos und Gegenwart sind Badus Lebensthema. Nie wieder wird sie sich ihm so konkret und hoffnungsvoll widmen wie hier, mit dem meist ungetrübten Blick einer Feministin und Worten der Ermutigung: „I guess nobody ever told you/ All you must hold on to/ Is you, is you, is you.“ Sebastian Zabel
DJ Shadow: „Endtroducing …..“ (1996)

Als das Debüt von Joshua Davis alias DJ Shadow 1996 in die Läden kam, waren DJs die Lead-Gitarristen der HipHop- und Club-Kultur: „DJ Shadow is the Jimi Hendrix or Jimmy Page of the sampler“, zitiert ein Sticker auf dem Cover den „NME“. Gratedigger nannte man damals Typen wie Davis, die sich durch obskurste Plattenläden wühlten, um längst vergessene Schätze zutage zu fördern. Aus Hunderten von Quellen unterschiedlichster musikalischer Genres entstanden eklektisch tobende Groove-Monster und eine neue abstrakte Sound-Ästhetik. Heute ist „Endtroducing“ eine Art „Citizen -Kane“ des instrumentalen HipHop. Und wie Orson Welles muss sich DJ Shadow seitdem daran messen lassen. JZ
Wilco: „Being There“ (1996)

Die Kreativität von Wilco explodierte bei den Aufnahmen für ihr zweites Album nach dem noch etwas hüftsteifen Debüt, „A.M.“, geradezu. Heraus kamen 19 höchst unterschiedliche Songs, die allesamt eine Frische und Rohheit ausstrahlen, dass man meint, direkt im Studio zu stehen, während sie live eingespielt werden. „Misunderstood“, diese Mischung aus Ballade und Noise-Rock, öffnete das Kapitel für alle zukünftigen Sound-Experimente – die „No Depression“-Anhänger waren geschockt. Kaum einer wollte die Platte kaufen, dabei schlossen sich hier launischer Songwriter-Pop („Far, Far Away“, „Someone Else’s Song“) mit üppigen, lärmigen Rock-Nummern („I Got You“, „Hotel Arizona“) kurz. MV
Outkast: „Speakerboxx/The Love Below“ (2003)

Big Boi und André 3000, die Mitglieder von OutKast, waren Polaritäten, in deren Spannungsfeld der aufregendste HipHop der Jahrtausendwende entstand. Hier konnten sie schon nicht mehr zusammenarbeiten, teilten sich das Album auf: Auf der einen Seite („Speakerboxxx“) der sprachmächtige Traditionalist Big Boi, auf der anderen („The Love Below“) der anarchische, androgyne André. Wer entschied das Duell für sich? Am Ende gewann die Kunstform selbst. Die beiden zeigten die Möglichkeiten des HipHop auf, setzten Atlanta auf die Landkarte, bereiteten der Trap-Explosion den Boden. Hier hört man sie zum letzten Mal gemeinsam, wenngleich getrennt, auf der Höhe ihrer Fähigkeiten. JJ
Nick Cave & The Bad Seeds: „Abattoir Blues/The Lyre Of Orpheus“ (2004)
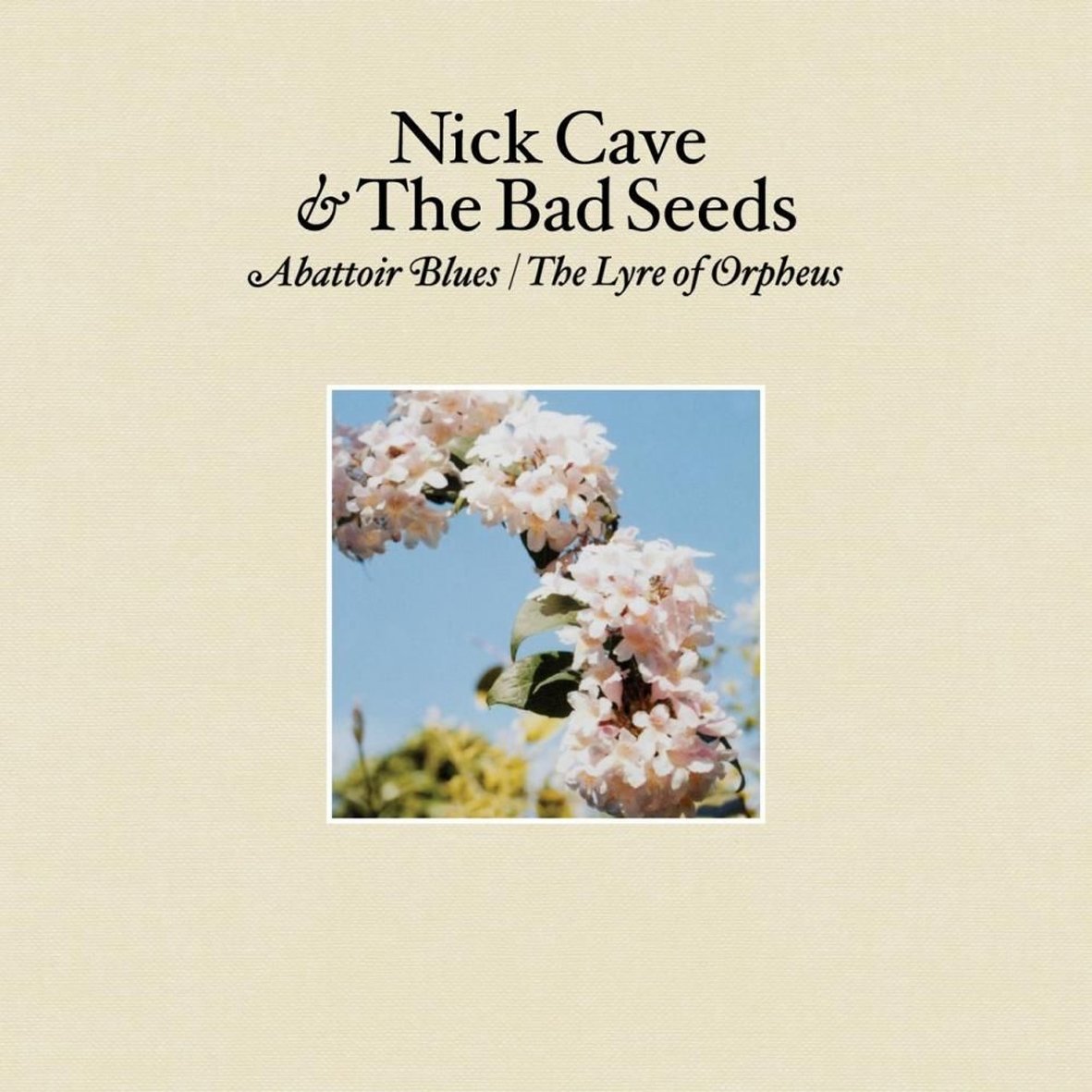
Nick Caves erstes Doppelalbum wird von Gospel, kannibalischen Hymnen und mal düsterem, mal überraschend balladeskem Blues getragen. Es beginnt mit einer Aufforderung: „Get Ready For Love“. Der Schmerzensmann dichtet für unschuldige Kinder und erweitert sein Mythenrepertoire in den überraschend komischen Lyrics um antike Stoffe. Dafür hielt im Pariser Studio ein Analoggerät her, das sonst nur Jazz-Klänge kennt. Während „Abbatoir Blues“ mit Songs wie „Hiding All Away“ an den alttestamentarischen Cave erinnert, bezeugt „Lyre Of Orpheus“ mit erhaben-traurigen Chorgesängen wie aus dem Elysion („Easy Money“), dass es auch für geschundene Seelen Befreiung geben kann. MV
The White Stripes: „Elephant“ (2003)

2003 war eine gute Zeit für die CD, kaum jemand dachte noch in Vinyl, und im Format einer Doppel-LP schon gar nicht – außer Jack White. „Elephant“, der Nachfolger des Durchbruchsalbums „White Blood Cells“, erschien auf zwei Scheiben, und Promo-Exemplare gab es auch ausschließlich auf Vinyl. The White Stripes waren keine kleine Garagen-Band mehr, und plötzlich interessierte sich die Welt auch noch dafür, dass sie geschieden und doch keine Geschwister sind.
Viel haben sie sich die Produktion ihres vierten Albums nicht kosten lassen: ungefähr 9000 Dollar. Für die Aufnahmen waren Meg und Jack White nach London gereist, und sie spielten die Platte – mit Ausnahme zweier Songs – innerhalb von knapp zwei Wochen ein, produziert mit altem Equipment, ohne teuren Schnickschnack oder Computer, denn laut Jack White würde das die Kreativität zerstören. Mindestens einen Effekt gibt es aber, der die Gitarre bei „Seven Nation Army“ wie einen Bass klingen lässt. Das Eröffnungsstück der Platte war Jacks Versuch, einen Song ohne Chorus zu schreiben, der trotzdem die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zieht. Dass ihm das gelungen ist, beweisen Tausende grölender Menschen in Fußballstadien, die die Band aus Detroit vermutlich gar nicht kennen – und ein Grammy für den besten Rocksong (und das beste Alternative–Album). Zum ersten Mal hört man Meg singen („In the Cold, Cold Night“), Kate Moss räkelte sich zur Coverversion von Burt Bacharachs „I Just Don’t Know What To Do With Myself“, und „The Hardest Button To Button“ bescherte ihnen einen Auftritt bei den Simpsons.
Wer hätte damals gedacht, dass die Band, die zu einer schwarz-weiß-roten Marke geworden war, mit „Elephant“ schon in der letzten Hälfte ihrer Diskografie angekommen war?
Naomi Webster-Grundl
Arcade Fire: „Reflektor“ (2013)

Nach dem überwältigenden Erfolg von „The Suburbs“, mit dem sie völlig unerwartet den Grammy für das Album des Jahres gewonnen hatten, unterliefen Arcade Fire die riesigen Erwartungen und machten eine Platte, die in jeder Hinsicht das Gegenteil des Vorgängers war: Wo zuvor Heartland-Rock regierte, riefen nun karibische Rhythmen und Disco-Beats zum Tanz auf, und die Coming-of-Age-Erzählung wurde von einer Interpretation der Orpheus-Sage abgelöst. Vom LCD-Soundsystem-Genie James Murphy produziert und mit einem Cameo von David Bowie, ist „Reflektor“ das mitreißendste aller Arcade-Fire-Alben. Begannen sie ihre Karriere mit „Funeral“ als Sargträger, feiern sie hier das Leben. JJ
Tame Impala: „Currents“ (2015)

Der Durchbruch für die australischen Neo-Psychedeliker. Das heißt, eigentlich nur für Kevin Parker, der es 2015 allein produziert hat und nur auf der Bühne Menschen neben sich stellt. Auf diesem dritten Album hat er den Sound mit einem mutigen Schritt in die Elektronik aus der Flaming-Lips-Echokammer endgültig in einen ungeahnt melodischen, flauschig tanzbaren Kosmos geschoben. Die Gitarren verschwinden unter Pedalhaufen, die größer als The Edge sind. Mit säuselnd verhangenem Wehmuts-Falsett über Pink-Floyd-Nebeln und Prog-Club-Beats wie „Let It Happen“ und dem Disco-Rocker „The Less I Know The Better“ gelangen ihm erste Hymnen für das Millennial-Stadion. MS
Weitere Highlights
- ROLLING-STONE-Guide: Die zehn besten Alben von Eric Clapton
- Selten gezeigte Bilder von Lady Gaga vor ihrem Durchbruch
- Michel Legrand im Interview: „Die Jazz-Giganten sind tot“
- Die meistunterschätzten Alben aller Zeiten: George Michael – „Patience“
- Pearl Jam: Das ist die tragische Geschichte des „Jeremy“-Stars Trevor Wilson




