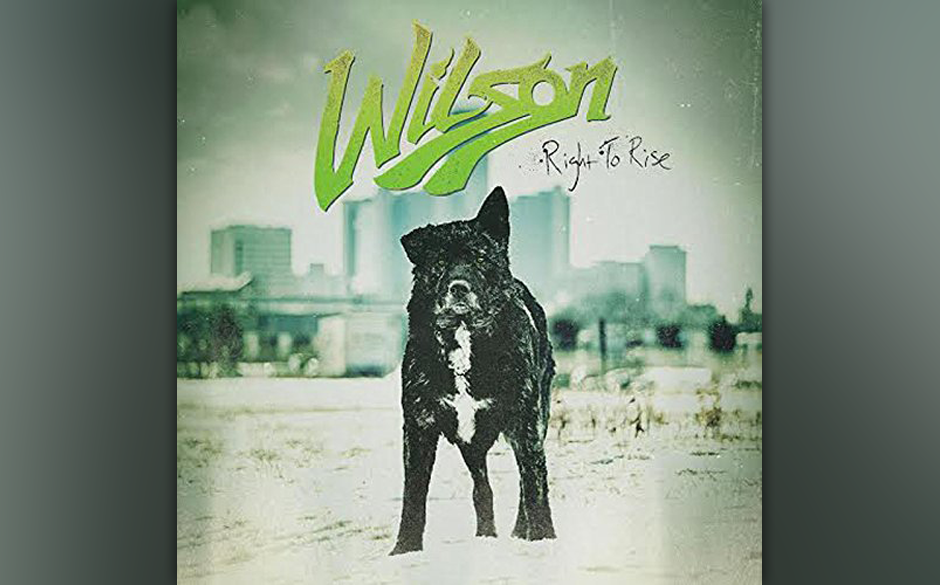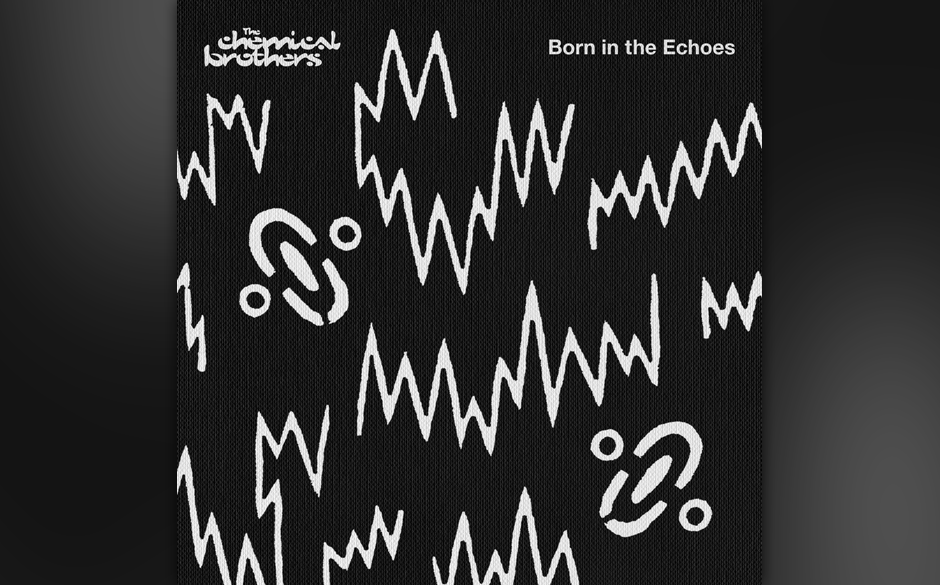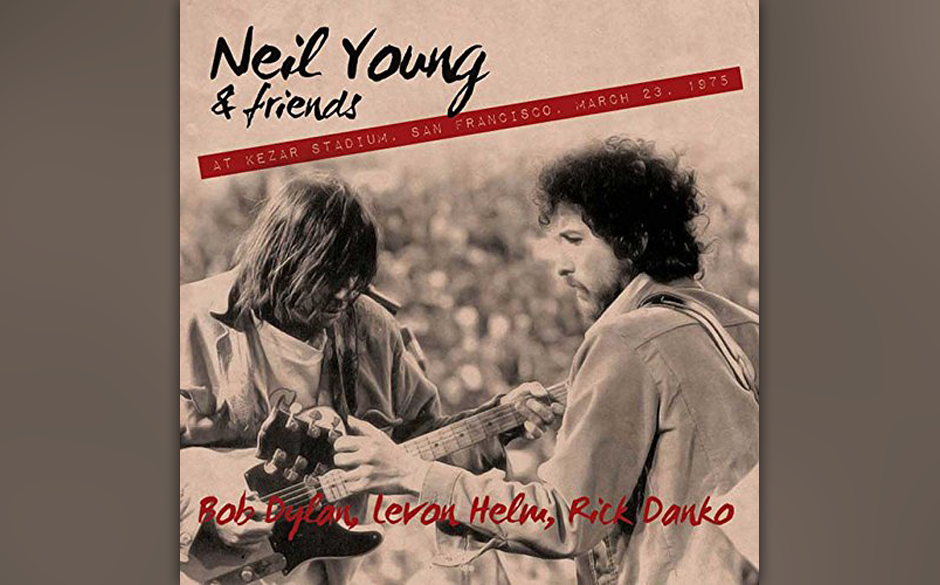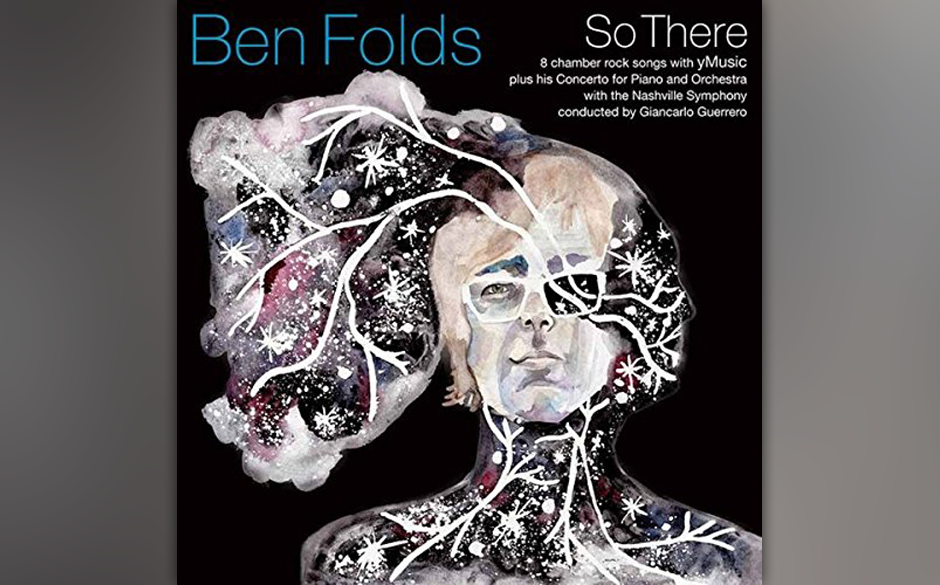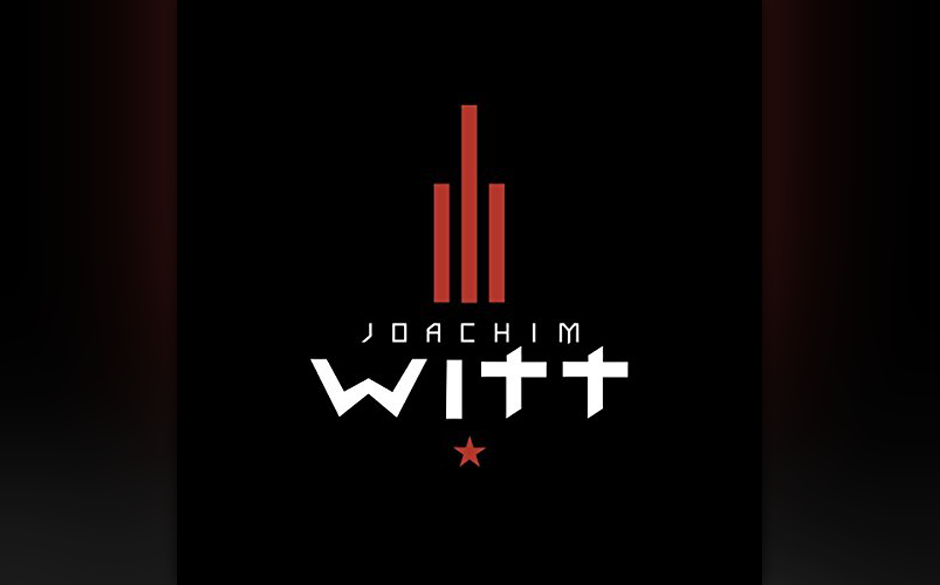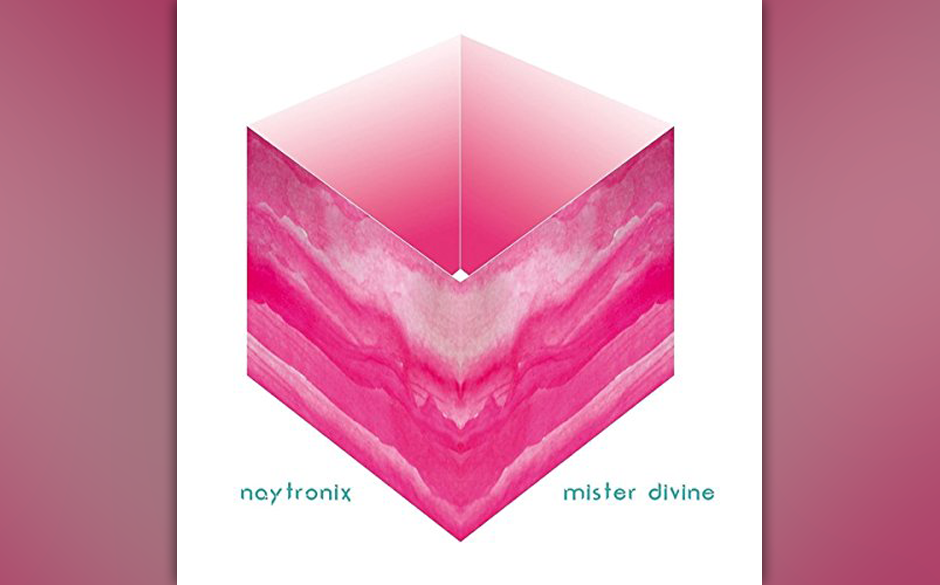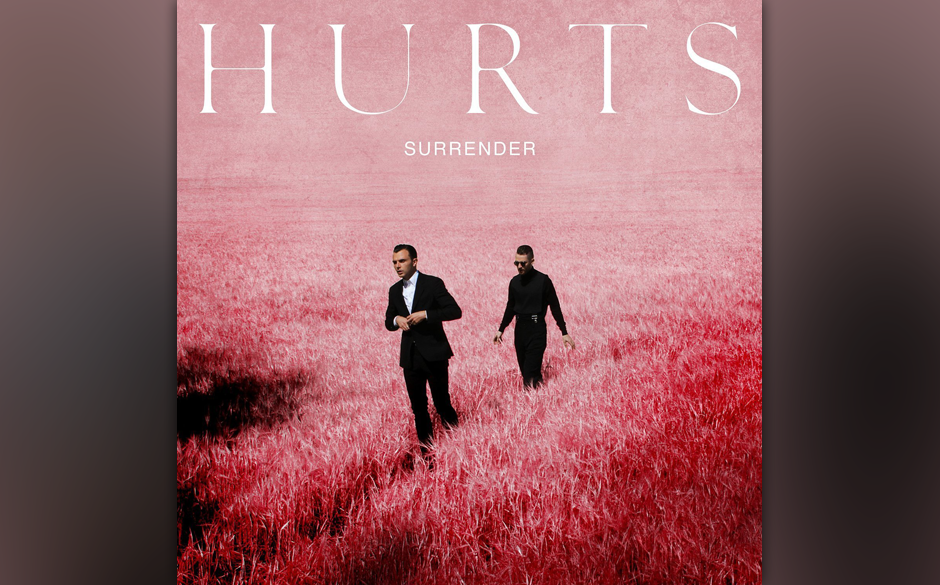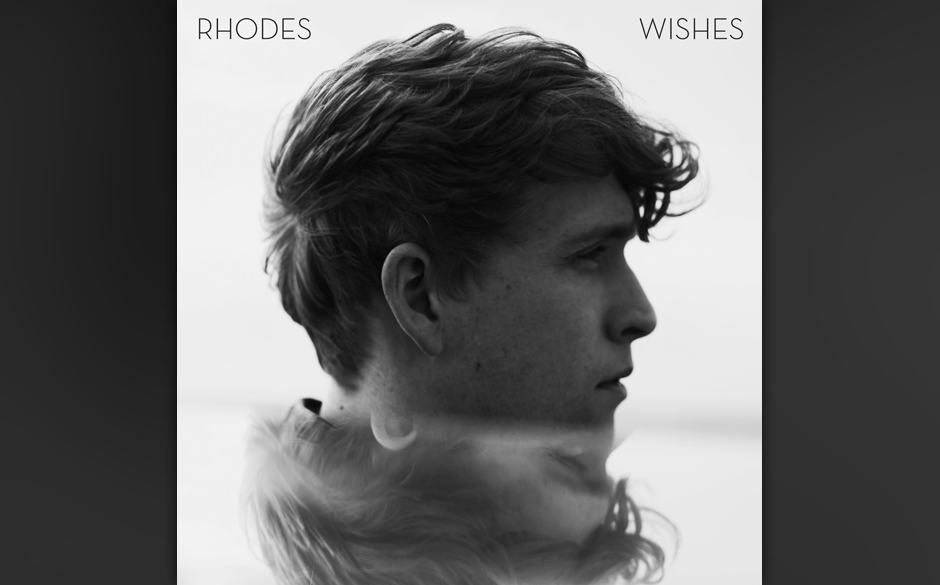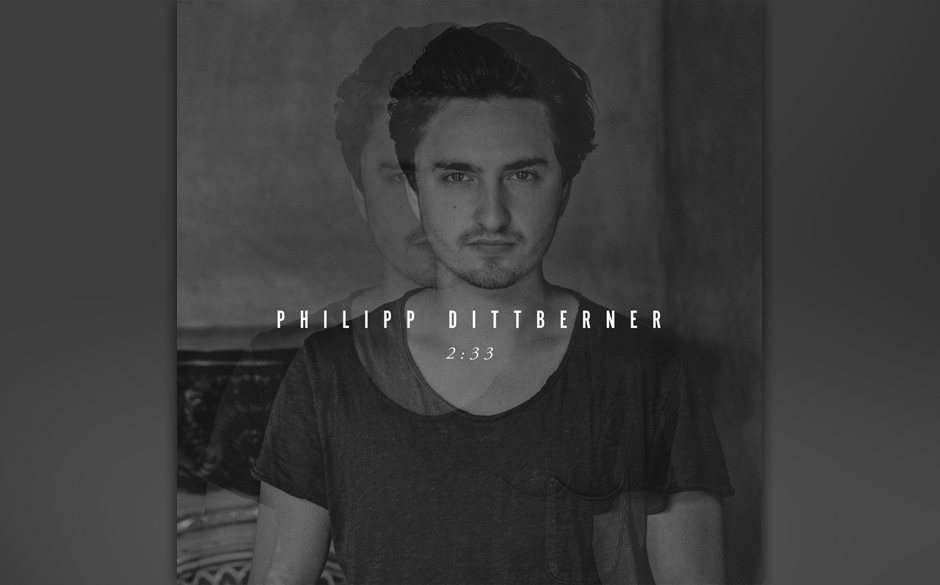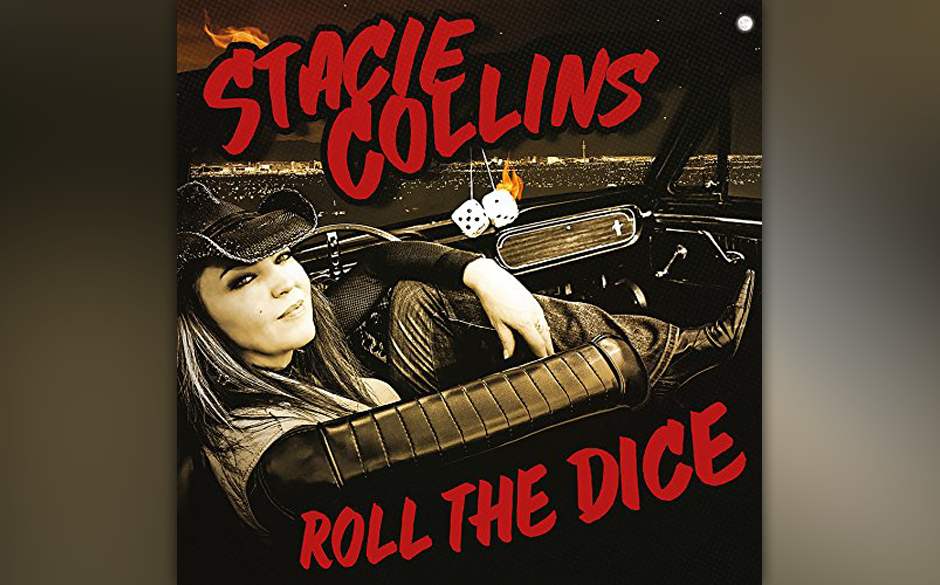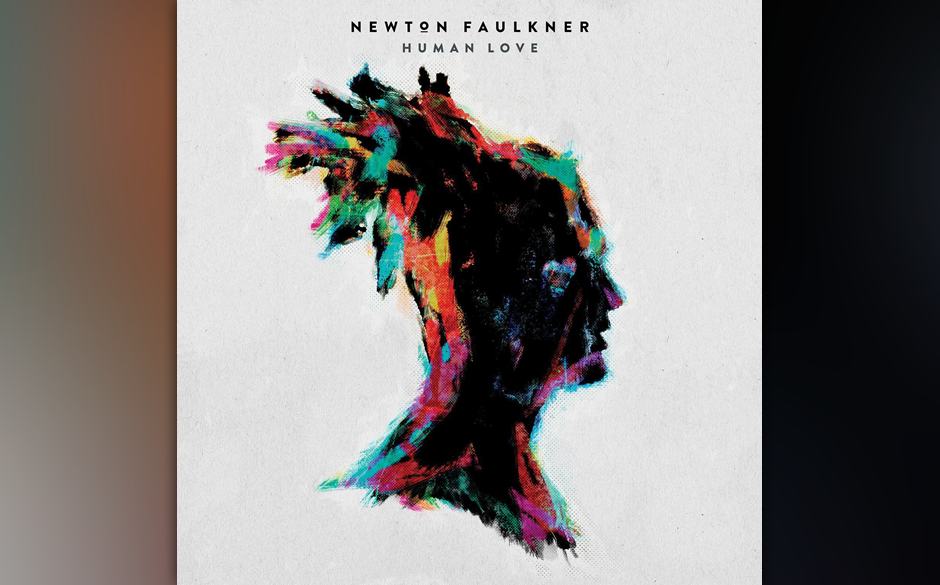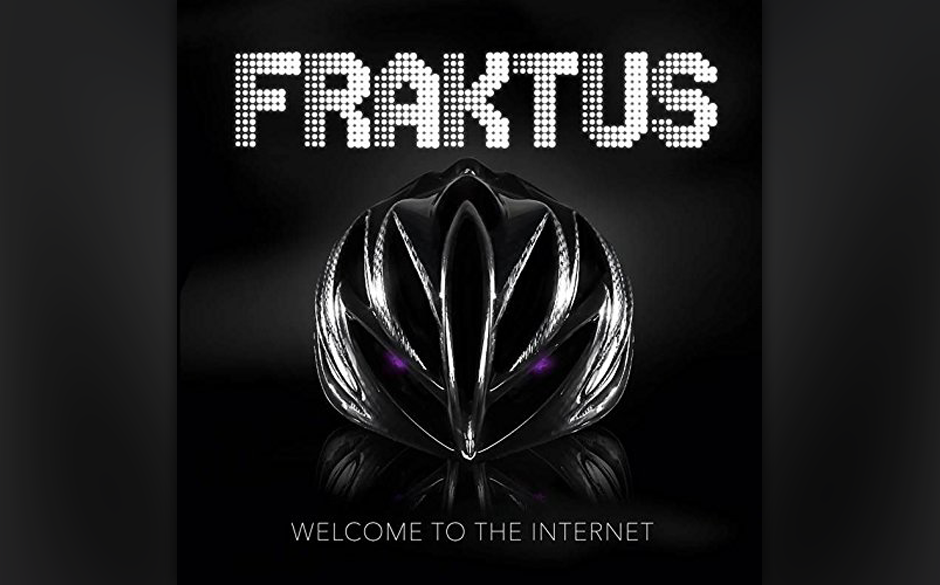Rock’n’Roll für Teestuben mit Tischdeckchen: Die 30 schlechtesten Alben des zweiten Halbjahres 2015
Sehen Sie hier: Die zwischen August und Dezember veröffentlichten Alben mit den schlechtesten Bewertungen aus der ROLLING-STONE-Redaktion.

Empfehlungen der Redaktion
Bereits Anfang des Jahres warfen wir einen Blick auf das Unvermeidliche: schlechte Alben. 59 davon konnten wir damals in den Monaten Januar bis Juli ausmachen – in den Monaten August bis Dezember sind jetzt noch einmal 30 weitere Platten dazugekommen.
In die Liste sind alle Alben aufgenommen worden, die in den ROLLING-STONE-Ausgaben 8/2015 bis 01/2016 eine der drei Bewertungen bekommen haben: 1 Stern, 1,5 Sterne oder 2 Sterne.
Sehen Sie in der Galerie: Die schlechtesten Alben von August bis Dezember. Mit Neil Young, The Chemical Brothers, Joachim Witt, Cäthe und James Morrison.
Mehr News und Stories