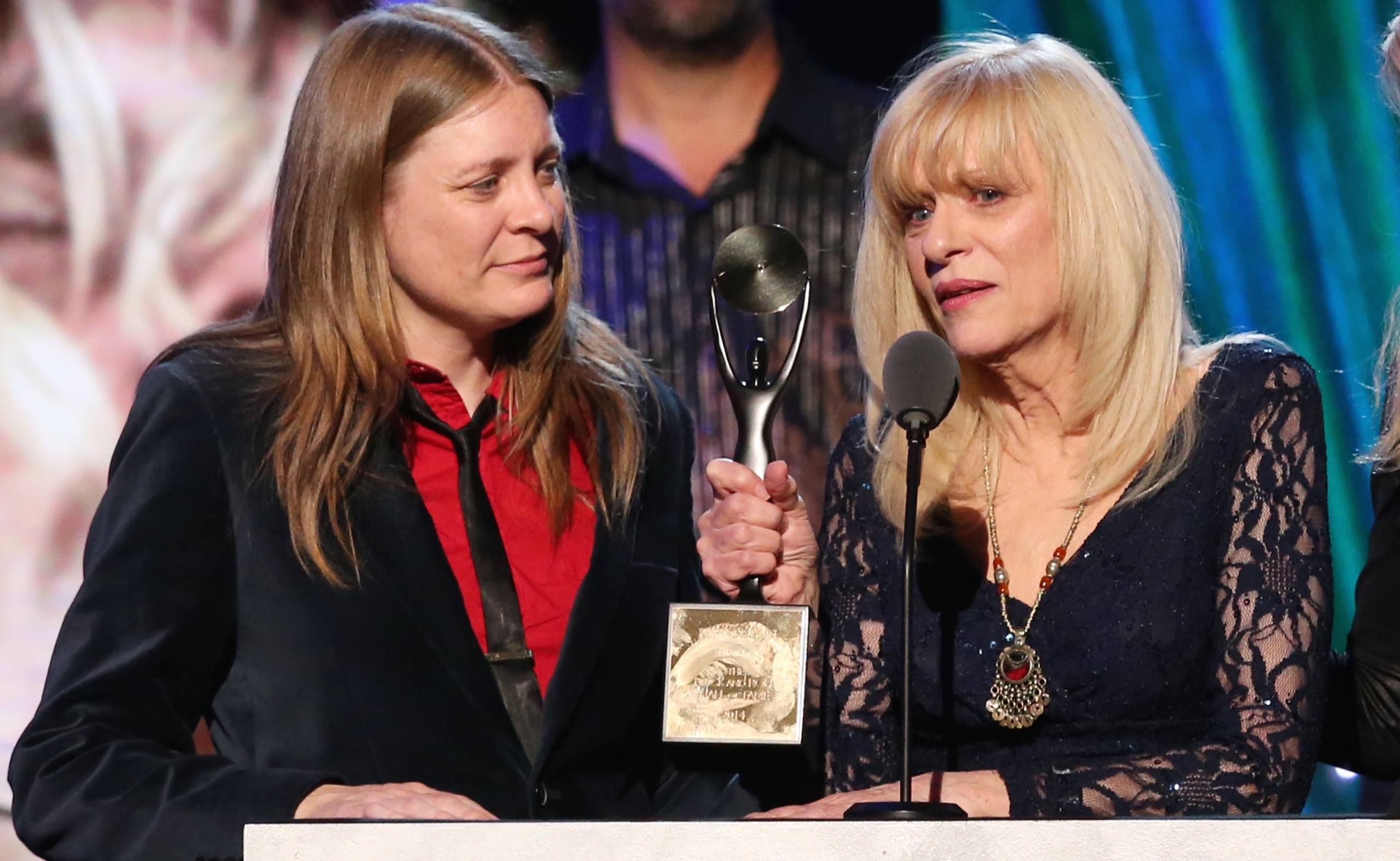Der New Yorker KEVIN DEVINE bewundert Elliott Smith, hat aber längst erkannt: Nacheifern bringt nichts. Er versucht es lieber mit kleinem, feinem Folk.

An dem Abend, als er Elliott Smith zum ersten Mal live sah, wusste Kevin Devine, dass er Musiker werden wird. Nicht halbtags, nicht halbherzig. Ohne doppelten Boden. „Der war so gut, dass ich das unbedingt auch machen wollte. Ich werde wohl nie so gut sein, aber ich wollte es unbedingt probieren.“
Auf seinem neuen Album „Make The Clocks Move“ sind dem New Yorker feine Folksongs geglückt, die einem gerade deshalb ans Herz gehen, weil sie sich nicht durch Kryptisches interessant machen, sondern mit Alltagssorgen kämpfen. Beim Solo-Debüt sang Devine noch: „I’m not a protest singer, I’m only protesting myself.“ Inzwischen hat er längst erkannt, was sein Problem war: „From the office to die coffin/ All our time and talent wasted/ And that weight against your throat, is that a noose dressed like a necklace?“ Also: Job gekündigt, Sänger geworden. Und die Gedichte einfach in Songs umgewandelt. Einfach? „Von wegen! Ich schreibe zwar dauernd – auf Quittungen, Servietten und alle möglichen Papieren. Aber ich kann nur zehn bis zwölf Akkorde spielen, deshalb sehe ich mich eher als Schreiber, nicht notwendigerweise als Songschreiber.“
Trotzdem hat er immerhin zwei Möglichkeiten, Lieder loszuwerden: bei seiner Alternative-Band Miracle Of ’86 und allein. Der Unterschied? „Die Miracle-Songs sind aggressiver, direkter, oft eingängiger. Solo konzentriere ich mich mehr auf die Poesie.“ Die schwerste und doch schönste Arbeit Devine macht sich nichts vor. Er ist mit Dylan aufgewachsen, mit Nirvana und Pavement erwachsen geworden – er weiß um die Unmöglichkeit des wirklich Originellen: „Es setzt eine gewisse angenehme Resignation ein, wenn man erkannt hat, dass es egal ist, wie schlau man zu sein versucht – man wird trotzdem immer wieder in ein Singer/Songwriter-Klischee verfallen. Es gibt einfach zu viele! Alles, was du tust, hat schon mal einer vor dir getan, und wahrscheinlich besser. Aber das muss einem egal sein.“
Devine schafft es mit einer sympathischen Mischung aus Selbstkritik und Humor, sich davon nicht deprimieren zu lassen. Am Ende erzählt er noch, dass er Journalismus studiert und als freier Mitarbeiter bei diversen New Yorker Magazinen gearbeitet hat „Aber damit kommt man hier auch nicht über die Runden, also dachte ich irgendwann: Hey, kein Geld verdienen kann ich auch als Musiker!“