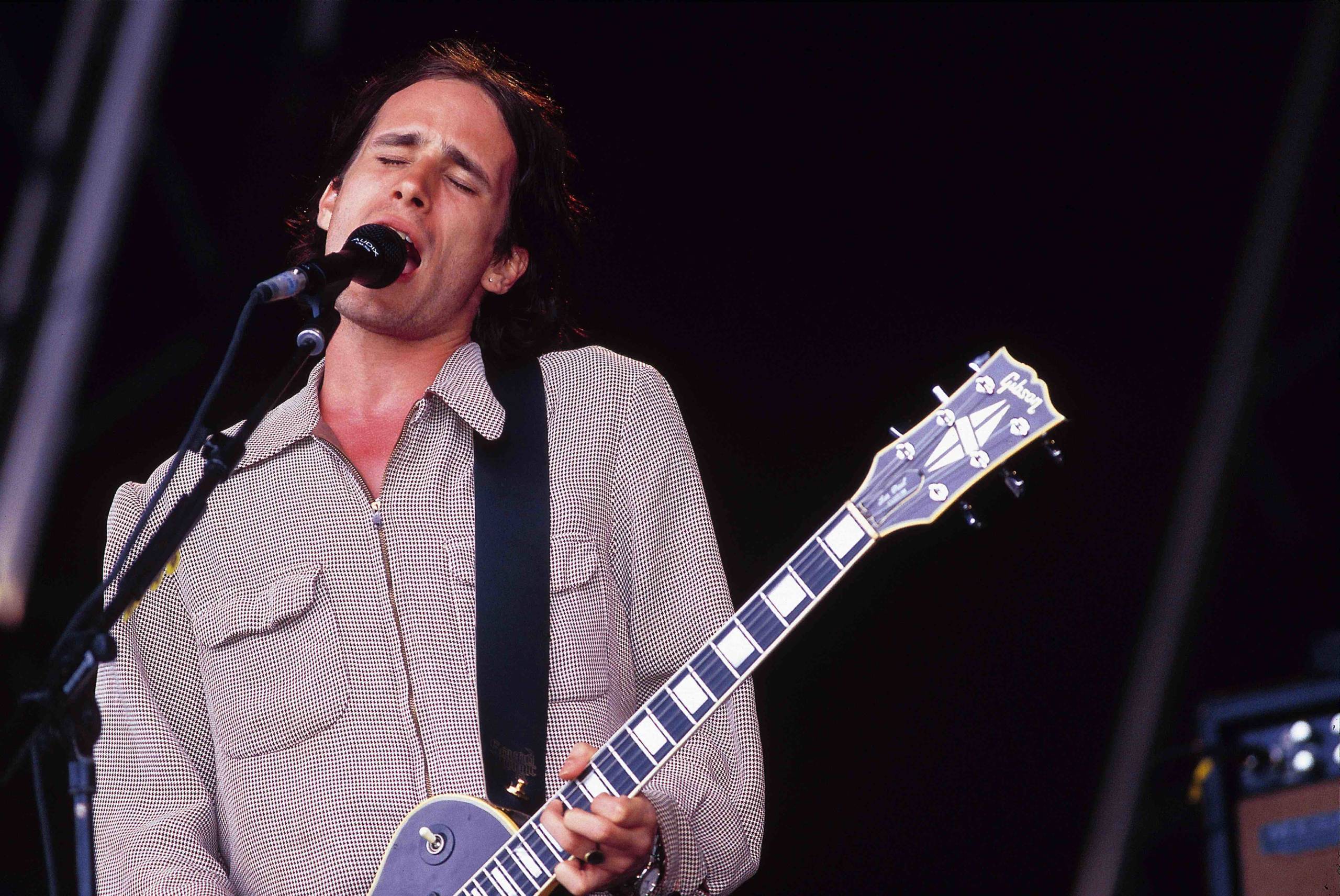Der britische Autor Nick Hornby schreibt nicht nur über seine persönlichen Lieblinqssongs, er liefert gleich eine Ästhetik mit

Es gibt einen latenten Widerspruch in „31 Songs“ (Kiepenheuer & Witsch, 14,90 Euro), diesem klugen, unpreziösen neuen Buch von Nick Hornby, das sich als Aufsatzsammlung über seine Lieblingssongs tarnt, aber sehr viel mehr ist: „Ich wollte in erster Linie darüber schreiben, was in diesen Stücken steckt, das mich dazu gebracht hat, sie zu lieben, nicht darüber, was ich in diese Songs hineingehört habe“, heißt es im einleitenden, programmatischen Text. Neunzig Seiten später, in den Assoziationen zu Van Morrisons „Caravan“ muss er dann jedoch einräumen: „Dieses Buch setzt nicht voraus, dass Sie und ich exakt dasselbe heraushören; mit anderen Worten, es geht nicht um Musikkritik.“ Durch die abschwächenden Attribute wird der Widerspruch ein bisschen verkleistert, aber eigentlich gibt Hornby hier ja doch zu, dass man ohne ein „Hineinhören“ anscheinend nicht auskommt, die Suggestivität eines Popsongs nicht wirklich objektiv bzw. analytisch erklären kann, dass man dabei also stets gezwungen ist, auch über sich selbst zu schreiben.
Nun sind solche kleinen Diskrepanzen nichts Seltenes in eher aphoristischen, unsystematischen Büchern wie diesem. Man könnte auch vermuten, dass Hornby im Schreibverlauf einsehen musste, dass seine Beschreibungskompetenz nicht ausreichte – weil sie niemals ausreicht! -, die Transzendenz des gelungenen Songs ohne individuelle Teilhabe anschaulich zu machen. Wahrscheinlicher aber ist wohL dass er sich dessen gar nicht bewusst war, denn, obschon er zunächst etwas Anderes avisiert, macht er intuitiv von Anfang an das Richtige, protokolliert er mit, was seine musikalischen Favoriten mit ihm anstellen, und das heißt ja auch immer, was er mit ihnen anstellt.
Und indem Hornby sehr persönlich sein Leben mit Musik beschreibt, also Rezeptionssituationen, Lebenskontexte (zum Beispiel Details über das Zusammenleben mit seinem autistischen Sohn), soziale Konditionierungen, ästhetische Prämissen (seine Klassik- und Jazz-Animosität), Wahrnehmungsprobleme etc. preisgibt, setzen sich seine Illuminationen nach und nach zu etwas Größerem zusammen: nicht nur zu einer charmanten Apologie des Pop wider seine Verächter, sondern auch zu einer eigenen Ästhetik. Natürlich ist ein Popsong ein ephemeres Phänomen, „ein Wegwerfprodukt“, das. weiß auch Hornby, aber er weiß auch, dass dessen mitunter selig machende Wirkung von diesem Wissen überhaupt nicht berührt wird. Außerdem gibt es genügend Gegenbeispiele, Stücke, die in unserem Kollektivbewusstsein immer noch nachhallen. Aber darum geht es ihm nicht Er dreht den Spieß um: Dass Popmusik es zunächst gar nicht auf so etwas wie Unvergänglichkeit abgesehen habe, dieser Umstand ist ihm gerade nicht Defizit, sondern „ein Zeichen für ihre Reife, für das Wissen um die eigene Begrenztheit“. Und vielleicht sogar eine Art barockes Demuts-Exerzitium? Das schreibt Hornby zwar nicht, aber es fehlt nicht viel daran. Und derlei metaphysische Spekulationen sind ihm auch keineswegs fremd.
Ebenso luzid ist aber auch Hornbys Auseinandersetzung mit popimmanenten Problemen, etwa dem, dass Nachgeborene sich bei den Klassikern stets mit einem irreversiblen Verlust an Authentizität herumplagen müssen. Ein guter Song bleibt ein guter Song, aber die Aura, die er bei der ersten Chartplazierung besaß, verliert sich natürlich mit den Jahren und mit zunehmender Rotation. „Wie mag es gewesen sein, ‚Like A Rolling Stone‘ 1966 im Alter von neunzehn oder zwanzig zu hören?“ Dass diese Frage nicht einmal näherungsweise zu beantworten ist, gehört zur Tragik jedes ernsthaften Pop-Archäologen. Und Hornby vermutet sehr plausibel, dass die „Versessenheit auf B-Seiten, alternative Versionen und unveröffentlichtes Material“ nur als eine Art Kompensationszwang zu verstehen sei, als Versuch, diese Erbschuld für einen Moment vergessen zu machen: „Wenn man heute Dylan oder die Beatles in ihrem unverwechselbar eigenen Sound und auf dem Höhepunkt ihres Schaffens hört – aber unverwechselbar in einer Weise, die wir nicht schon tausend, Millionen Mal gehört haben -, dann erlebt man ein kurzes, aber elektrisierendes Aufblitzen ihtes Genies, und näher kommen wir Spätgeborenen“ der verlorenen Unschuld nicht mehr.
Aber dafür haben wir unsere eigenen Pop-Paradiese, die uns noch Naivität gestatten, und das ist im Grunde die frohe Botschaft dieses wundervollen Buches: „Ab und zu nehme ich mir eine Kassette fürs Auto auf, ein Tape mit den ganzen neuen Stücken, die mir in den vorangegangenen Monaten gefallen haben, und jedes Mal, wenn ich sie fertig habe, kann ich mir kaum vorstellen, dass noch eine weitere dazukommt. Aber es kommt immer eine dazu…“