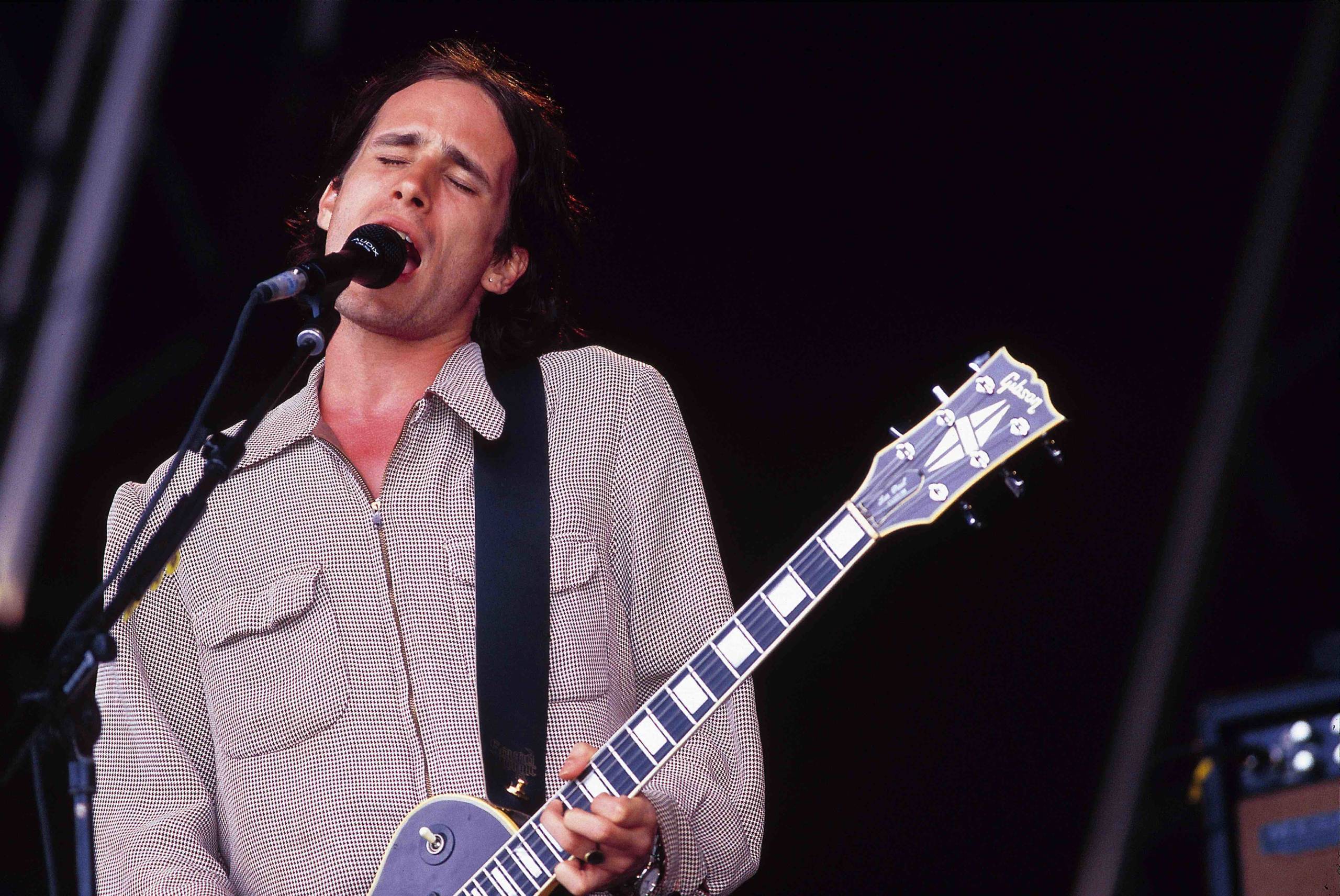Denkmal fürs Prekariat
Bloß kein Thirtysomething-Stuss: In seinem Roman "Anke" beschreibt Linus Volkmann das Leben der verzweifelt kreativen Großstadt-Boheme sehr realistisch

Linus Volkmann arbeitet im Hauptberuf als Redakteur bei „Intro“ und muss gerade das neue Heft fertigstellen. Er hat wenig Zeit, trotzdem stimmt er meiner Interviewanfrage bereitwillig zu. „Das geht natürlich vor, höhö!“ Nach zwei Erzählungsbänden, die sich schon im Titel ganz offensiv als Popliteratur positioniert haben“Smells like Niederlage“ und noch schöner „Heimweh to hell“ -, ist nun wieder mal ein Roman erschienen. Und der heißt so niederschmetternd schlicht „Anke“ (Ventil, 14,90 Euro),dass man das zunächst nur ironisch gelten lassen mag. Aber Volkmann meint das durchaus ernst. „Einen Namens-Titel hatte ich mir schon länger vorgenommen. Ich wollte unbedingt etwas unaufgeregtes, was mal auf mehr als auf die coole geile Sprach-Oberfläche verweist. ‚Heimweh to hell‘ hätte übrigens seinerzeit beinah sogar ‚Androgyne Alkoholiker‘ geheißen. Lieber Himmel. Mit dieser Interessantheits-Quakerei musste mal Schluss sein.“
Zumal sich hier auch bereits eine moderate Zurücknahme des Pop-Etiketts ankündigt, die den ganzen Roman prägt. Volkmann geht sehr diskret und bedacht vor bei der Ausstattung mit den notorischen Insignien des Genres, er zitiert nur sehr sporadisch Songs, es gibt keine Listen und keine Spezialisten-Exkurse, nur zwei Szenen, in denen Kino-Filme eine Rolle spielen, und er charakterisiert seine Figuren eher durch Beschreibung ihrer Gesten und durch ihre Sprache als durch Markennamen. „Dieses 8oer-Verweis-Geboller, das bei ‚Liegen Lernen‘ und diversen anderen Pop-Dingern die einzige Existenzberechtigung darstellte“, findet er ohnehin ziemlich deprimierend. „Dieser wohlige Thirtysomething-Stuss von Bazooka Joe, Quench, Walter Wallmann etc. – quasi Oliver Geissens Retro-Show zum Lesen. Das habe ich mir bewusst verbeten, um nicht schlecht drauf zu kommen.“
Er sieht durchaus ein, dass all das mitschwingt, wenn er sein Buch vom Verlag als Poproman annoncieren lässt. „Aber ich will eben nicht unhöflich sein. Nicht jeder sollte sich gleich neue Kategorien schaffen.“ Als Musikjournalist gehe es ihm immer wieder auf den Wecker, wenn „jede Emoband nicht Emo, jeder Electroclashhuber nicht Electroclash etc. genannt werden will.
Ich finde das irgendwie unhöflich und eitel, sich ständig über jede Einschätzung hinwegsetzen zu müssen, und alles als ‚Schublade‘ zu brandmarken.“ Außerdem ist Popliteratur „kein Begriff wie Nu-Metal, mit dem man nach dessen kurzzeitiger Blüte untergeht, sondern so schwammig, dass man ihn sich problemlos anheften kann. Na also.“
Und Pop liefert hier immerhin so etwas wie einen inhaltlichen Bezugsrahmen. Die titelgebende Protagonistin arbeitet als Kulturredakteurin der „Hessischen Vogue“. „Also neue Bücher Bands, Filme etc.“ Und Gärtner, ihr Verflossener, kehrt als abgemeierter A&R-Manager einer großen Plattenfirma ins Heimatnest zurück und versucht nun vom ehemaligen Jugendzimmer aus mit einer Musik-Promotion-Ich-AG Fuß zu fassen. Die beiden treffen sich nach all den Jahren auf einer PR-Party wieder, Anke nimmt ihn mit aufs Klo, Gärtner sie dafür mit nach Hause (er hat „sturmfreie Bude“!) – und nach dieser durchgemachten Nacht mit allem, was dazugehört, darf er endlich das elterliche Purgatorium wieder verlassen und das freie Zimmer in ihrer WG bewohnen. Diese Nacht wird das Beste sein, was die beiden zusammen erleben, und Volkmann bietet literarisch einiges auf, damit man sie auch als Leser im Gedächtnis behält. Er präsentiert ihren überdrehten Enthusiasmus, dieses quasi-mystische Einheitsgefühl mit der Welt nicht zu schmalzgebacken, verrät es aber andererseits auch nicht völlig an die Ironie.
Schon bald darauf beginnen die Mühen der Ebene. Zunächst ist es nur das übliche Knirrschen und Ruckeln, wenn zwei sehr verschiedenen Alltage sich verzahnen, dann kommen Gärtners Minderwertigkeitskomplexe hinzu, genährt von beruflicher Erfolglosigkeit, Ankes Mitleid mit ihm, und ihre etwas übertriebene Passion für kolumbianisches Rohrfrei spielt auch noch eine Rolle. Man ahnt längst, noch vor den beiden, wohin das führt, und hofft dennoch wie in jeder guten Liebesgeschichte, dass der Autor Erbarmen hat. Hat er natürlich nicht. Nicht ganz unschuldig an diesem Scheitern sind Gärtners heikle Arbeitsverhältnisse. „Anke“ ist damit auch ein Roman zur gerade kurrenten Prekariats-Debatte, ein Roman für all die selbstausbeuterischen „Kreativen“, für die „urbanen Penner“ oder die „digitale Boheme“, je nachdem wie positiv man diesen Lebensentwurf bewerten mag oder wie zugehörig man sich fühlt. „Das Thema liegt und lag ja auf der Straße. Lebensentwürfe sind hyperindividualistisch geworden und schaffen krumme Karteileichen, die alle nur noch für sich stehen müssen, die sich nicht mal mehr auf irgendeine humanistische bis knallgeile Utopie vertrösten lassen dürfen. Wer das geschilderte Leben drumherum in dem Buch liest, darf beunruhigt sein, aber soll auch merken, auch ganz unten hat man zumindest manchmal halbguten Sex, Vollrausch und irgendwie ’n paar Leute um sich herum.“
Der Roman liefert eine realistische Zustandsbeschreibung dieses Befunds – und unterscheidet sich somit grundsätzlich von Holm Friebes und Sascha Lobos essayistischer Selbstapotheose „Wir nennen es Arbeit“ (Heyne). Obwohl er einen der beiden Autoren persönlich kennt, hält Volkmann das Buch denn auch für „latent obszön, weil dieser selbstauferlegte Liberalismus alle sozialen Frechheiten affirmiert. Klar, wer hat, der hat. Und wer supertopcheckermäßig im Web – und mit ökonomischem Rückhalt – sich pusht und einen eigenen Marktwert schafft, der ist heutzutage sicher zu beneiden. Und so Leute gibt es auch. Mir ging es aber um all die, die hinten runterfallen. Nicht die total Abgehängten, sondern genau solch ein Prekariat, das auch mit wehmütigen Äuglein „Wir nennen es Arbeit“ liest und sich noch nicht mal damit trösten kann, dass die gesellschaftlichen Umstände sie unten hält. Sondern sie selbst wieder hundertprozentig in der Pflicht sind, ein geiles Leben aus dem Nichts zu zimmern. Da braucht man schon starke Nerven.“
Und einen gewissen Witz. Gärtner, dieser durch und durch tragischen Gestalt, bleibt ja gar nichts anderes übrig, er muss die Tristesse seines Lebens im Witz aufheben, um sie überhaupt ertragen zu können – und für den Leser, den alten Voyeur, fällt dabei durchaus einiges an Komik ab. „Er hatte geträumt, seine Mutter würde Anrufe entgegennehmen, die für ihn und den Aufbau seiner Freelance-Promo-Agentur bestimmt waren. Peinlich. Mit 30 wieder zu Hause. Und jeder, der anruft, musste über Mutter, musste über die Travestie eines Sekretariats, das dann so was sagte wie: ,Nee, der sitzt auf dem Topf, oder: ‚Bitte rufen Sie nicht zwischen 13 und 15 Uhr an, da beten wir immer.'“ Auch Ankes Charakter hat eine kleine Delle, die für einen hübschen running gag gut ist. Sie hört Stimmen. So offenbart ihr in einer dieser kurzen akustischen Visionen ein McDonalds-Angestellter „mit Migrationshintergrund“: „Hier ist dein McFlurry – und ich schäme mich für all das, was Fastfood uns antut.“ Das ist aber der einzige Spezialeffekt, den sich Volkmann erlaubt. Anders als bei so vielen neueren Romanen, deren Stoffe und Plots nicht mehr aus echter Erfahrung geschöpft sind, sondern aus Kinofilmen und Sitcoms, sind Volkmanns Protagonisten keine Pointenschleudern, sie sprechen wie echte Menschen.
Gelegentlich überlappen sich Fiktion und Wirklichkeit. Die Episode, in der Gärtner eine Plattenbesprechung mit dem Appell beendet, sich anstatt der verissenen lieber eine CD von Robbie Williams brennen zu lassen, was dann den Beißreflex des Labels auslöst, hat Volkmann selbst erlebt. „Die sogenannte ,Der-Satz-mit-dem-Brennen-Affäre‘ gab es tatsächlich, ist ja kein Geheimnis. Nach fünf Jahren wurde die Akte nun offiziell geöffnet und mir gestattet, dass ich sie als Fußnote einbringe. Sowas kann man sich ja auch kaum ausdenken. Das war damals schon ein ziemlicher Skandal. Den offensichtlich ironisch gemeinten Review-Schlusssatz .Bitte sofort brennen hatte seinerzeit Jens Friebe geschrieben. Ich habe im Schlusslektorat entschieden, das könne man doch mal bringen. Insofern natürlich auch therapeutisch, dass das in ‚Anke‘ jetzt mal historisiert werden konnte.“