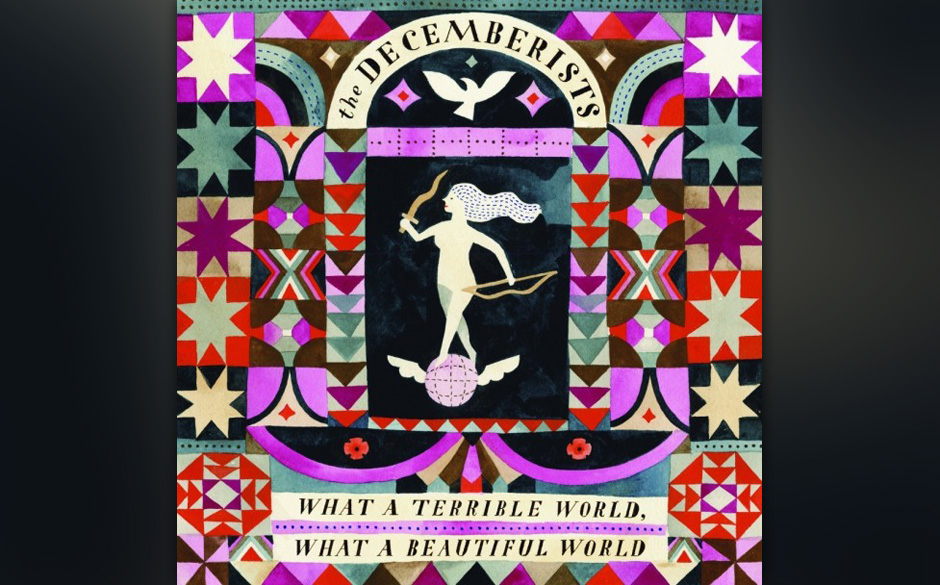Decemberists – Hamburg, Knust
Das Mini-Orchester der Decemberists begibt sich mit freundlicher Ironie auf lustvolle Ausflüge in die musikalische Vergangenheit Amerikas

Zunächst eine Stimme aus dem Off: Man solle sich doch einen Moment Zeit nehmen, um die wundervolle Architektur der heutigen location zu bewundern und den Nebenmann bzw. die Nebenfrau zu begrüßen; sogar die Augen sollen wir schließen, um uns auf die nahende Erscheinung der Decemberists einzustimmen.
Eine freundliche Ironie, die gut passt zum Decemberists-Songwriter Colin Meloy, der das Wort natürlich ungern selbst an sein Publikum richtet, weil er ein bisschen steif ist und lieber die Distanz wahrt, freilich auch in seinen kleinen Geschichten von Seefahrern, Mördern, dem Krieg und der romantischen Liebe. Augen wieder auf, und da steht Meloy jedenfalls da, in einem komischen Streifenanzug wie aus einem alten Musical, vielleicht „Mary Poppins“. Bei ihm sind die vier bereits bekannten Decemberists sowie eine Dame an Bratsche, Glockenspiel, Synthie, Banjo und Gesang – selbst sechs Musiker brauchen ein gutes Maß an instrumentaler Flexibilität, um den aufwändigen Folk-Rock und die Ausflüge in andere Genres von „The Crane Wife“ live umzusetzen.
Das ist überhaupt das Beste an einem Konzert der Decemberists: die vielen unterschiedlichen Klangräume, die ständig neu entstehen. Traditioneller Folk-Prog-Rock bei dem uferlosen „The Island“, Sezessions-Musik bei den „Shankill Butchers“ (mit Drehleier und Akkordeon), irgendwo plötzlich ein Mini-Orchester aus Violine, Bratsche und Kontrabass, dann wieder eingängiger 8oer-Jahre-Indie-Folkrock zum Mitsingen, wie etwa bei „We Both Go Down Together“ vom „Picaresque“-Album. Apropos: Es ist schon erstaunlich, wie dieses und einige andere Lieder („16 Military Wives“, „Eli, The Barrow Boy“, aber auch schon „O Valencia!“) über Nacht zu kleinen Klassikern geronnen sind und im ausverkauften Haus wie ein jahrelang geliebtes Standardrepertoire gefeiert werden.
Überhaupt ist es eine Wonne, den Decemberists zuzuhören, weil all diese kunstvoll komponierten und liebevoll facettenreich arrangierten Songs live sogar noch an Größe gewinnen. Die drei Teile von „The Crane Wife“ zum Beispiel, insgesamt stolze fünfzehn Minuten lang, bilden gleichzeitig den Höhepunkt und ungefähr den Rahmen des regulären Sets, das anschließend in einen etwas unüberschaubaren Zugabenteil übergeht. „Hear all the bombs that fade away“ – immer und immer wieder.
Insgesamt war das dann auch ein großartiger Abend. Nur eine kleine Hoffnung wurde dann doch enttäuscht: Da die fabelhafte, mittlerweile wie die Decemberists in der amerikanischen Indie-Metropole Portland/Oregon beheimatete Laura Veirs (mit der Meloy daheim neulich sogar auf Duo-Tour war) am folgenden Tag in Hamburg Interviews für ihr neues Album „Saltbreaker“ zu geben hatte, hätte man sich gern von einer gemeinsamen Live-Version des „The Crane Wife“-Duetts „The Yankee Bayonet“ überraschen lassen. Aber alles kann man ja schließlich nicht haben.