David Lynch endlich erklärt: Der letzte große Surrealist von A-Z
Der Meister der unheimlichen Bilder gibt der Filmwelt sein Jahrzehnten Rätsel auf. Anlass genug, mit einem umfangreichen Glossar den Geheimnissen seiner Filme auf die Spur zu kommen.

Alphabet
David Lynch ist wohl der größte Sprachkritiker des Gegenwartskinos. Beginnend mit seinem Kurzfilm „The Alphabet“ von 1968 (in dem mit suggestiven Bildern die Qual, lesen und schreiben zu lernen, symbolisiert wird) ist die Unfähigkeit zu sprechen und die Gefahr des geschrieben Wortes in fast allen Filmen Thema. Es kommt bei Lynch eher darauf an, wie etwas gesagt wird, als was gesprochen wird. Seine Kritik an der verbalen Kommunikation ist aber auch ein Appell an die Zuschauer, auf andere Formen der Verständigung – auf Träume, die Kraft der Elemente und die Macht der (immerzu Sehnsüchte erzeugenden) Geheimnisse und vor allem Geräusche zu vertrauen. In „Twin Peaks“ bringt der Regisseur dies mit seinem Cameo-Auftritt als schwerhörigem FBI-Agenten absurd-komisch auf den Punkt.
Bacon
David Lynch begann seine künstlerische Karriere als Maler, studierte an der Pennsylvania Academy of Fine Arts, wo er vor allem düstere Gemälde entwickelte (einige davon wurden in der Wanderausstellung „Dark Splendor“, die im Max-Ernst-Museum in Brühl gezeigt wurde, ausgestellt). Seine Einflüsse hat der vielleicht wirkmächtigste Universalkünstler des heutigen Kinos dabei – in Interviews ansonsten eher verschwiegen, was Ursprünge und Bedeutungsebenen seiner Werke angeht – überraschend deutlich offengelegt. Neben den Filmen von Bergman, Kubrick und Fellini sind als künstlerische Vorbilder wohl Edward Hopper, Henri Rousseau und vor allem Francis Bacon bedeutsam, der mit seiner Darstellung von gequälten und in den erschreckendsten Positionen verrenkten Körpern mit ähnlicher Präzision wie Lynch, vielleicht aber noch eine Spur abstrakter, das Eindringen des Unheimlichen ins alltägliche Leben zeigte.
Von Bacon hat Lynch den ambivalenten Zugang zur Reflexion von Gewalt, ganz konkret zu beobachten bei grotesken und aggressiven Figuren wie Frank Booth („Blue Velvet“) und Bobby Peru („Wild At Heart“), deren Gesichter von den Schauspielern Dennis Hopper und Willem Dafoe ganz ähnlich verzerrt werden wie die menschliche Anatomie bei Bacon. In dem frühen minimalistischen Animationsfilm „Six Figures Getting Sick“, eher noch Kunstinstallation als Film, ist der Einfluss des britischen Malers aber (noch) am deutlichsten zu sehen. Ein erschreckendes Frühwerk.
Clowns
Die natürlich immer schon tragikomischen Clowns haben Konjunktur in den Filmen David Lynchs. Sie wirken durch ihre groteske, wahnsinnige, eben auch komische Art, mit der Umwelt in Beziehung zu treten, unterhaltsam, doch verbergen sie immer auch Geheimnisse, die kaum je aufgedeckt werden. Die flirrende Welt des Zirkus‘ und der Jahrmärkte gab Lynch in Interviews als große Inspiration für seine künstlerische Arbeit an, verewigt wurde diese Faszination in „Der Elefantenmensch“. Aber mit seinem selbstständig eingespielten Album „Crazy Clowntime“ und dem dazugehörigen Titelsong samt psychedelischem Video fand er noch einmal einen völlig anderen Zugang zu dem Thema.
Dumbland
David Lynch kreierte nicht nur mit „The Angriest Dog In The World“ einen genialen wöchentlichen Comic-Strip (der stets aus den selben Bildern bestand und nur im Dialog variiert wurde), sondern auch eine radikale Zeichentrickserie namens „Dumbland“, die lediglich acht kurze Episoden trug und zunächst auf seiner Website veröffentlicht wurde. Mit kruden Animationen zeigt er hier Situationen aus dem Leben eines Wutbürgers. Natürlich geht es auch hier seltsam, wenn nicht gar vulgär zu. Nachbarn haben Sex mit Enten, es wird eher geschrien als gesprochen, Blut spritzt aus den Köpfen der Figuren und Ameisen spielen eine furchterregende Nebenrolle.
Esoterik
Seit sich David Lynch für die Transzendentale Meditation stark macht, wird sein Werk in einem völlig anderen Licht betrachtet. Während einige Kritiker in dem esoterischen Kauderwelsch, das Lynch auch auf Podiumsdiskussionen loslässt (z.B. in Berlin, wo eine Veranstaltung nach Studentenprotesten im absoluten Chaos endete), einen Ankerpunkt gefunden haben, um ihre Abneigung gegen seine Filme zu begründen, haben selbst glühende Fans Schwierigkeiten, mit Lynchs spirituellen Aussagen umzugehen. David Sieveking drehte mit „David Wants To Fly“ eine glänzende Doku-Satire, die das Dilemma veranschaulicht.
Der Meister düsterer Gegenwelten hat in einem Buch namens „Catching The Big Fish“ – das im Januar 2016 zum ersten Mal auf Deutsch erschienen ist – auch noch eine Anleitung zur friedfertigen Meditation und einem gelungenen Leben gegeben. Darin erzählt er von seinen tiefen Erfahrungen mit dem Tempo des Lebens, warum „Eraserhead“ sein spirituellster Film ist und wie man Musik richtig, also nach innen hört. Dabei sind auch Lynchs Filme von einer zuweilen bizarren Esoterik geprägt. Wenn Agent Dale Cooper (Kyle McLachlan) in „Twin Peaks“ mit einem Buchstaben- und Dosenspiel versucht, den Mörder von Laura Palmer zu ermitteln, wird dieses Vertrauen in eine Welt, in der nichts zufällig ist und der Zugang in derartige Paralleluniversen (The Red Room!) nur wenigen Individuen zugänglich ist, auf geradezu sanftmütige Weise versinnbildlicht. Wenn Sie das „Spice“ in „Der Wüstenplanet“ für Sci-Fi-Quatsch hielten und die Schlussszene von „Blue Velvet“ für puren Kitsch, täuschen Sie sich eventuell.
Feuer
Kein Bild in Lynchs Werk ist so stark wie das Feuer, das zum Leitmotiv in „Twin Peaks“ wird (Fire Walk With Me), in „Wild At Heart“ erotische Leidenschaft und Aggressionen ganz gegenständlich in Beziehung setzt und vor allem auch auf der akustischen Ebene in eigentlich jedem Film präsent ist. Auch ein Soundtrack-Album Lynchs trägt das Feuer bereits im Titel („The Air Is On Fire“). Das Element ist in seinen Filmen mehr als nur eine Metapher (so wie bei Andrej Takowskij das Wasser), es steht als geradezu kreative, narrative Kraft für sich – so wie das Haus, das in „Lost Highway“ in Flammen aufgeht.
Geheimnis
Kein Film von David Lynch, der nicht im dunklen Herzen ein Geheimnis trägt (kongenial deshalb auch die deutsche Übersetzung seiner mit Mark Frost entwickelten TV-Serie „Das Geheimnis von Twin Peaks“), vielleicht auch deshalb, weil er wie kaum ein anderer Filmemacher darauf vertraut, dass die wesentliche Magie des Kinos darin besteht, dem Zuschauer etwas zu zeigen, von dem er nicht weiß, wie es entstanden ist. Vielleicht trägt dies noch mehr als die Frage nach der Bedeutung einer Erzählung. Bis heute rätseln Filmfans, welches Material Lynch für das unheimliche „Baby“ in „Eraserhead“ verwendete. „Was Geheimnisse so interessant für mich macht, ist das mysteriöse Drumherum: ein düsteres Geheimnis…Allein schon die Worte ‚düsteres Geheimnis‘ sind einfach wunderschön“, sagte Lynch einmal in einem Interview.
Und seine Figuren bleiben, auch wenn sie stets auf der Suche nach der Wahrheit sind, irgendwie stets davor stehen, bevor sie sie ergreifen. Sie schauen zwar in Heizungsrohren, Kleiderschränken und in merkwürdigen blauen Kästchen nach, doch sie haben vor dem Zuschauer keinen Wissensvorsprung. Und auch andersherum weiß der Zuschauer nie, wohin die Reise der nicht selten verunsicherten Charaktere gehen wird. Lynchs „Strange Worlds“ werden von zwergwüchsigen Männern und Kreaturen auf fernen Planeten gesteuert, deren Motivation wohl nicht einmal der Regisseur selbst kennt. Lynch: „Ich hoffe eigentlich, dass ich niemals die allumfassende Antwort erhalten werde, es sei denn, sie geht einher mit einem gewaltigen Schuss an Glückseligkeit. Ich mag den Prozess, in ein Geheimnis einzudringen.“
Hölle
Nimmt man das melancholisch-stille Road-Movie „Straight Story“ einmal aus, so lässt Lynch seine Figuren in eigentlich allen Filmen unaufhaltbar in die Hölle fahren. Wobei die Bewegung, die Fahrt, der Prozess des (vor sich hin) Treibens in eine andere Sphäre – sie muss nicht notwendigerweise unterirdisch sein – eine große Rolle spielt. Auch wenn Henry Spencer von einer unheimlich deformierten Tänzerin, die in seiner Heizung wohnt, vorgesungen bekommt, dass im Himmel alles großartig sei, bleibt ihm schließlich, nach einem wahrlich surrealistischen Inferno, nur die Verwandlung in einen Radiergummi. Hölle, das ist bei Lynch auch ein Ort, an dem die Menschen mit ihren verdrängten Schattenseiten konfrontiert werden, ihren sexuellen Gelüste und aggressiven, sinnlosen Trieben begegnen, und stets verwundert über deren Macht erscheinen. Gewalt und Gegengewalt wird hier mit großer visueller Kraft von ihrer ansonsten infantilen Verkleinerung im Kino befreit. Selbst Hollywood, bei Lynch natürlich in mehreren Ebenen eine Traumfabrik, kann wie in „Mulholland Drive“ zum Moloch werden, in dem finstere Gestalten und mysteriöse Hintermänner heimlich die Strippen ziehen und so selbst hochmotivierte und trotzdem naive Blondinen in einen Strudel der Abgründe entlassen.
Inspiration
Lynchs filmische Methode könnte man noch am ehesten mit der Écriture automatique der Surrealisten beschreiben. In unzähligen Interviews hat er beschrieben, dass er kaum eine nachvollziehbare Methode habe, zu seinen Erzählungen vorzudringen, zuletzt auch in seiner Autobiographie „Traumwelten“. Sie seien einfach da, wie Bilder vor den Augen, wenn man sich in einen Sessel setzt und seinen Tagträumen hinterher schaut. So hinterlassen seine Filme bei den Zuschauern auch den Eindruck, sie seien einzigartig, könnten in der Form nur von Lynch und von sonst niemandem stammen. In diesem Zusammenhang spricht man deshalb auch von lynchesk oder lynchig (die Verwandtschaft mit dem Begriff des Kafkaesken ist durchaus kein Zufall, Lynch fühlt sich nach eigenen Angaben dem Prager Schriftsteller seelenverwandt) – als würde es ein spezielles Gefühl geben, das Lynchs Kinofilme, seine Musik, seine Bilder sofort auslösten. Dabei ist Lynch selbst ein aufmerksamer Beobachter der Künste. Seine Werke sind alles andere als referenzlos.
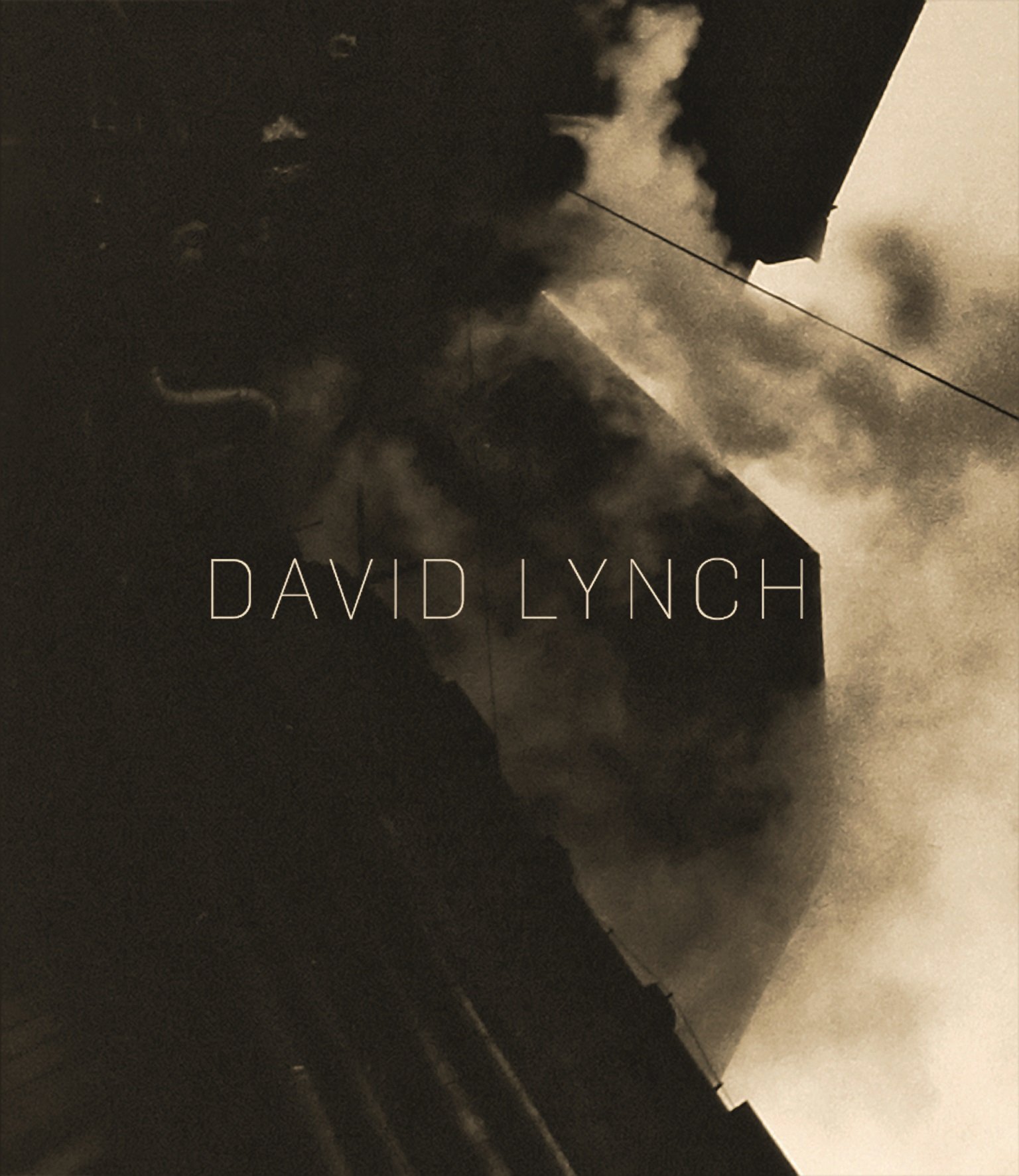
Sie beziehen ihre Inspiration aber weniger aus Hollywood als vielmehr aus dem europäischen Kino (die absurde Komik von Jacques Tati, der tiefe Einblick in die weibliche Seele von Ingmar Bergman, die Bilderlust von Federico Fellini), der Fotografie, der Musik und aus dem gesteigerten Interesse für Strukturen und Texturen (Körper, Haut, Maschinen!). Seiner Faszination für Fabriken verlieh Lynch mit einer eigenen Bilderserie Ausdruck („David Lynch: The Factory Photographs“). Hinzu kommen Stoffe, die der Regisseur wie ein nimmermüder Liebhaber umkreist: Der Zauberer von Oz, Lolita, die großen Königinnen und Könige der Populärkultur (Marylin und Elvis), und ein Amerika, das seine Abgründe hinter einer nur an der Oberfläche unschuldigen Fassade verbirgt.
Joyride
David Lynchs Filme sind Trips in eine andere Welt, die von Gesetzen gesteuert werden, die eben nur dort – in „Lynchland“ – gelten. Jünglinge wie Jeffrey Beaumont in „Blue Velvet“ oder Paul Atreides in „Der Wüstenplanet“ (beide von Kyle Mclachlan auch als eine Art alter ego des Regisseurs angelegt) legen ihre Scheu ab und bahnen sich den Weg zu einem für sie zuvor kaum vorstellbaren Unbekannten, das ihr Leben für immer verändert. Ein Pärchen flüchtet quer durch die halbe USA vor einer wildgewordenen Mutter/Hexe, die eine Handvoll Killer auf sie angesetzt hat. Ein Mann verliert seinen Verstand und erlebt sich plötzlich in einer völlig anderen Realität. Das Bild bleibt die Straße im Dunkeln, die sich ewig dehnt. Lynchs Filme sind Joyrides, für seine Figuren, die wie Henry Spencer permanent im Urlaub oder irgendwie nicht beschäftigt sind, stetig vor neuen Initiationen stehen und mit (ihren) Dämonen zu kämpfen haben. Aber es sind auch Spritztouren für den Zuschauer, der in der unheimlich verzerrten Filmwelt Wahrheiten entdeckt, die das konventionelle Erzählkino, an Genregrenzen gekettet, an Erzählkonventionen gebunden, längst nicht mehr auszusprechen in der Lage ist. Subversives Geisterbahn-Kino.
Kult
„Eraserhead“ begründete mit Filmen wie „El Topo“ von Alejandro Jodorwosky, „Pink Flamingos“ von John Waters und „The Rocky Horror Picture Show“ von Jim Sharman (allesamt Filme, die einer ähnlichen, längst verflogenen Geisteshaltung entsprangen) in den Siebzigern das Mitternachtskino in den USA mit. Fünf Jahre hatte Lynch an dem verqueren Un-Werk gedreht, sogar auf dem Set geschlafen, um den Film fertig zu bekommen. Seitdem ist Lynch einer der innovativsten Bildkünstler der Gegenwart, konnte sich Millionen-Flops wie „Der Wüstenplanet“ leisten. Spätestens mit „Blue Velvet“, vor allem aber auch mit der einflussreichen Fernsehserie „Twin Peaks“ (Quality-TV, noch bevor der Begriff durch die „Sopranos“, „The Wire“ und „Mad Men“ zur Standardfloskel verkam), wurde Lynch Kult. Von Cineasten verehrt, von Kritikern nicht immer geliebt, vom durchschnittlichen Kinogänger aber stets mit einer hochgezogenen Augenbraue verfolgt. Dabei spielt auch seine geschickte Selbstvermarktung eine Rolle. Die auffällige Physiognomie des Regisseurs, gepaart mit seiner ikonischen Frisur, dürfte heute genauso bekannt sein wie einst die Silhouette von Hitchcock, die zum cineastischen Gütesiegel wurde. Zudem gelingt es Lynch, mit unzähligen Interviews (schön und erhellend in „Lynch über Lynch“ – im Gespräch mit Chris Rodley) zugleich Spuren ins Sinnzentrum seiner Kunst zu legen und sie mit der geschickten Verweigerung von Erkläransätzen wieder zu verwischen. Auch seine Website, über die der Filmemacher gegen eine Abo-Gebühr kleine abstrakte Filmhäppchen reichte, den Wetterbericht in Los Angeles präsentierte und Kaffee verkaufte, gehört zur Marke Lynch dazu. Natürlich fordert dies längst auch zu unzähligen, größtenteils liebevollen Parodien im Netz auf.
Labyrinth
Worin besteht das Vergnügen, sich in einem künstlich angelegten Garten zu verirren, der möglicherweise viele oder gar keine Ausgänge hat? David Lynch ist der Großmeister der filmischen Labyrinthe. Seine Erzählungen sind verschachtelt („Mulholland Drive“), kennen unendlich viele Cliffhanger („Twin Peaks“), führen die eigenen Hauptfiguren in die Irre („Lost Highway“) und in einen undurchsichtigen Zitate-Dschungel der Popkultur („Wild At Heart“) oder des eigenen Werks („Inland Empire“). Damit kommt David Lynch die Rolle eines prophetischen Künstlers zu, der mit den Mitteln des postmodernen Kinos die Komplexität einer Welt beschreibt, die ihren eigenen Diskursen nicht mehr entkommen kann („Das ist eine Schlangenlederjacke. Sie ist ein Symbol meiner Individualität und meines Glaubens an die persönliche Freiheit“, sagt der von Nicolas Cage gespielte Sailor in „Wild At Heart“). Man kann sich in diesen kunstvollen Labyrinthen, die nicht selten einer Traumlogik folgen, mit wohligem Schauer verlieren, man kann sie aber auch fürchten, weil sie in ihrer Konstruktion hyperrealer Tableaus keine (moralischen) Auswege zulassen. Alles scheint hier Pose, Rätsel, endlos geflochtenes Band. Als Lynch 1990 bei den Filmfestspielen in Cannes für „Wild At Heart“ die Goldene Palme gewann, warf man ihm dennoch Zynismus und ein vollständig leeres Programm vor. Die Kunstfertigkeit des Regisseurs besteht aber darin, die Zeichen der Zeit zu lesen – und sie mit der Sprache des Films in Flammen aufgehen zu lassen.
Metamorphosen
David Lynch hat sich schon vor vielen Jahren die Filmrechte für „Die Verwandlung“ von Franz Kafka gesichert. Höchstwahrscheinlich wird es nie zu einer filmischen Realisation dieses einzigartigen literarischen Stoffes kommen – weil Lynch Kafka verehrt („Der eine Künstler, bei dem ich wirklich das Gefühl habe, er könnte mein Bruder sein“) und weil er wohl nicht so dumm wäre, die gewaltigen Assoziationen, die der bedeutendste deutschsprachige Autor des 20. Jahrhunderts weckt, mit seinen eigenen kühnen Bildvisionen zu verrechnen. Aber „Die Verwandlung“ passt auch deshalb, weil Lynch in all seinen Filmen Metamorphosen zeigt. Seine Figuren puppen und enthäuten sich, verwandeln sich vom spießigen Familienvater in ein mordendes Monstrum, von der Blondine zur Brünetten (und umgekehrt) oder von einem Saxophonisten in einen Mechaniker. Dabei verfolgt Lynch streng das geheime Programm der Surrealisten (ohne sich selbst je dazu bekannt zu haben, einer von ihnen zu sein), wonach es schön ist, wenn sich eine Nähmaschine mit einem Regenschirm auf einem Seziertisch begegnet.

Nicht zu Ende geborener Mann
Einer der vielen (vielleicht hilflosen) Interpretationskrücken, mit der man Lynch beizukommen versuchte, ist die des „nicht zu Ende geborenen Mannes“, den der Regisseur laut dem Filmkritiker Georg Seeßlen in fast all seinen Filmen symbolisch und zugleich überkonkret inszeniert. Natürlich scheint hier „Eraserhead“ am Hintergrund auf, das symbolische Ur-Ei in „Lynchville“. Hier hat der Protagonist mit einem schockierenden, kreischenden, röchelnden, wurmähnlichen Wesen zu kämpfen, dessen Vater er angeblich sein soll. Doch der psychoanalytische Ansatz, der auch schon für Lynchs erste bedrückende Kurzfilme wie „The Grandmother“ fruchtbar gemacht werden kann, reicht noch wesentlich weiter, denn im Grunde geht es bei Lynch fast immer um junge Männer, die nach einer Erklärung für ihre Schmerzen, ihre eigenartige Verstocktheit und ihre Fremdheit fahnden – und dann meist in einen düsteren Joyride verwickelt werden.

Dabei steht die Angst vor der eigenen Sexualität (das größte Geheimnis im Lynch-Kosmos) stets im Zentrum genauso wie die Enttäuschung durch Mütter und Frauen, die den einsamen Mann verlassen oder hintergehen. Lynchs Filme spielen mit dem psychoanalytischen Zugang (so wie es einst auch Hitchcock tat), in dem wesentliche Versatzstücke z.B. der Traumdeutung, aber auch Stereotypen der filmischen Psychologisierung (die kühle Blonde, der unsichere Jüngling, die Femme Fatale, der Doppelgänger) potenziert und zum Teil sogar mit parodistischen Mitteln gezeigt werden. Damit machen sie es dem Zuschauer eigentlich leicht, Sinn hinter den scheinbar sinnlosen Bildern zu finden. Doch der psychoanalytische Querbezug könnte – genauso wie es in den Erzählungen Kafkas der Fall ist und wie es sich bei den großen Surrealisten von Breton über Bunuel bis Dali zeigt – eine geschickte Interpretations-Falle sein.
Ohr
Natürlich, das Ohr, das Jeffrey Beaumont in „Blue Velvet“ findet (Lynch zeigt in vielen seiner Filme KörperTEILE; es gab sogar einmal das Gerücht, dass er eine ganze Sammlung solcher vormals lebendiger Gegenstände in seinem Heimkühlschrank lagert). Aber wer die Filme von David Lynch schaut, der sollte vor allem auch die Ohren spitzen: Auf den Sound kommt es an. Der kam schon in den frühen Filmen von Studienkollege Alan Splet, der mit großem Feingefühl eine elektronische Atomsphäre des Grauens schuf. Unvergesslich das überlaute Brummen der Heizung in „Eraserhead“, erschreckend selbst das explosionsartige Anzünden einer Zigarette in „Wild At Heart“. Aber auch die Musik von Angelo Badalamenti, der seit „Blue Velvet“ die Filme Lynchs mit atmosphärischen Synthie-Flächen unterlegt, gehören zum Klanguniversum des Regisseurs dazu und erzeugen das „Lyncheske“, ohne dass auch nur ein Bild zu sehen ist.
Publikum
David Lynch: „Ich weiß nicht, was ich dem Publikum sagen will. Ich zeige auf der Leinwand Gedanken und Vorstellungen, die mich beschäftigen. Ich kann einfach nicht verstehen, weshalb die Leute um jeden Preis einen Sinn in der Kunst finden wollen, während sie sich längst damit abgefunden haben, dass es ihn im Leben nicht gibt.“
Trotz aller Rätselhaftigkeit, trotz all der versponnen Bildideen und der Lust an der Provokation: David Lynchs Filme sind Publikumsfilme wie sie im Buche stehen, denn sie leben von der Reaktion der Zuschauer, ziehen sie mit in den Erzählfluss hinein, so wie die Kamera in Ohren oder Kästchen zoomt. Bei Vorstellungen von „Mulholland Drive“ sollen Zuschauer lauthals angefangen haben zu lachen, als die obskure letzte Szene lief und der Bildschirm plötzlich schwarz, alle Fragen aber offen waren. Ein Lachen, wie es Sigmund Freud geliebt hätte, vor Entzückung, Verwunderung, Kapitulation vor dem Fremden. Natürlich spielt Lynch, wie es ja auch Hitchcock tat, mit den Erwartungen der Zuschauer – wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte man in „Twin Peaks“ den Mörder von Laura Palmer niemals enthüllt und die Serie wie eine groteske Form der Telenovela ewig weiter spielen lassen. Am schönsten dürfte Lynchs Spiel mit den Erwartungen seines Publikums aber in „Der Elefantenmensch“ ausgefallen sein, in dem die grotesk entstellte Hauptfigur, hinter der sich eine zartfühlende Persönlichkeit verbirgt (ergreifend von John Hurt gespielt), zunächst überhaupt nicht gezeigt wird. Stattdessen sehen wir die Tränen von Arzt Frederick Treves (Anthony Hopkins), als er das „Jahrmarkt-Monster“ zum ersten Mal erblickt.

Qual
Lynch-Filme sind nicht ohne einen gewissen Hang zum Masochismus zu ertragen. Das liegt auch daran, dass seine Figuren selbst im Teufelskreis der Schmerzerfahrungen (seien sie nun selbst erlebt, beobachtet oder anderen zugefügt) eingezwängt sind. Außerdem besitzen alle seine Stoffe unter ihrer abstrakten, kinematographisch ausgefeilten Oberfläche stets einen tragischen Kern. „Twin Peaks – Der Film (Fire Walk With Me)“, einer der umstrittensten Filme Lynchs, in der Retrospektive aber wohl einer seiner interessantesten, enthüllt mit wesentlich erschreckenderen Bildern als die Serie, dass sich hinter der Geschichte um die ermordete Stadtschönheit auch das Drama um eine in den verschiedensten Formen missbrauchte junge Frau verbirgt und der erschreckende Kreislauf von Geld, Drogen und Prostitution in jedem idyllischen Ort (oder, so will es uns Lynch weismachen, gerade dort!) Einzug erhalten kann. Mit „Twin Peaks – The Return“ setzte Lynch dieser künstlerisch radikalen Vorstellung einer von Flammen bedrohten Welt (ohne Gott?) noch einmal ein Denkmal. Stellvertretend dafür steht der entsetzlich laute Schmerzensschrei der Laura Palmer. Das Entsetzen ist für Lynch, so die kaum genießbare Pointe, stärker als jede erzählerische Auflösung, auch stärker als jede Form der Gnade.
Die größte Qual mag für den Zuschauer aber sein, sich darauf einzulassen, dass Sinn und eine logisch erzählte Geschichte mit einer nachvollziehbaren Moralvorstellung bei Lynch eben schlicht suspendiert sind. Stattdessen herrscht die Diktatur des Blickes, die der Regisseur mit der Inszenierung von hyperrealistischen Nahaufnahmen, der komplizierten Differenzierung von Bild und Ton und der zuweilen sogar zynischen Variation von üblichen Hollywood-Topoi in ihrer Funktionsweise im Kino, oder generell in den visuellen Medien der Popkultur, offenlegt. So kann auch „Straight Story“, die meditative letzte Lebensreise des Alvin Straight, zu einer qualvollen Erfahrung werden, weil hier mit allen Mitteln versucht wird, die Notwendigkeit von den Plot voranbringenden Konflikten durch die friedliche Einsicht in die Schmerzhaftigkeit des Lebens zu ersetzen. Der Blick ins All wird so zum gleichsam entspannenden wie erschreckenden Ereignis.
Rita
Es ist eine der Schlüsselszenen in „Mulholland Drive“, die den Film als Hommage und tragikomische Parodie auf die großen Zeiten Hollywoods (und vor allem auch ihre Spiegelung durch „Sunset Boulevard“ von Billy Wilder) entlarvt: Weil eine Frau nach einem Autounfall ihr Gedächtnis verloren hat und nicht mehr weiß, wie sie heißt, erblickt sie ein Poster des Films „Gilda“ mit Rita Hayworth und nennt sich von dem Zeitpunkt an „Rita“. Man hat es Lynch oft vorgeworfen, dass seine Frauenfiguren stets mit einer gewissen Holzschnittartigkeit bestimmte Rollen einnehmen, oft im Kontrast zueinander die naive, asexuelle Blonde und die geheimnisvolle, sexuell vielseitige Brünette. Natürlich geht dieser Vorwurf niemals vollständig auf (man denke nur an die ambivalente weibliche Besetzung in „Twin Peaks“), doch Tatsache ist, dass Lynch die Frauen in seinen Filmen mit großer Zärtlichkeit und auch einer gewissen Neugierde betrachtet. Ihre nicht zu entschlüsselnden Wünsche sind stets das pulsierende emotionale Zentrum seiner Filme.
Dabei hatte Lynch auch ein fantastisches Händchen für die Besetzung, setzte Laura Dern mit „Blue Velvet“, „Wild At Heart“ und „Inland Empire“ ein Denkmal (versuchte sogar auf originelle Weise einen Oscar für sie zu erkämpfen) und entdeckte die faszinierend wandlungsfähige Naomi Watts. In diesem Zusammenhang darf seine Casting-Agentin und Produzentin Johanna Ray nicht vergessen werden. Gerade in „Mulholland Drive“ wird der stets männlich konnotierte Blick auf die Frau im Hollywood-Film mit perfider Konsequenz der Lächerlichkeit preisgegeben und sinnlos gemacht. Hier herrschen nicht die freudianischen Kategorien des von Männern erträumten Traumfabrik-Weltbildes, sondern die Einsichten einer wohl tragisch gescheiterten Schauspielerin. Nach Ingmar Bergman mag Lynch wohl der anspruchsvollste „Frauen-Regisseur“ sein. Wie passend, dass er sich in „Inland Empire“ mit einer grandiosen, minutenlangen Sequenz vor dessen Meisterwerk „Persona“ verneigte und damit auch all die großen Sterbesequenzen in den Filmen von Quentin Tarantino alt aussehen ließ.

Sex
Fernab von voyeuristischen Kategorien, die eine Betrachtung dieses Gegenstandes ganz von selbst mit sich bringen, kann man ohne Scham behaupten, dass Lynch einige der schönsten, aber auch bizarrsten Sex-Szenen der Filmgeschichte inszeniert hat. Angefangen von der Unzahl an Sex- und Geburtsakt-Metaphern in „Eraserhead“ (die in einen Traum gipfeln, in dem die Angst vor der Sexualität ganz konkret wird) über die erschreckende Vergewaltigung in „Blue Velvet“, in der der von Dennis Hopper gespielte Frank Booth wie ein Tier über Dorothy Vallens (Isabella Rossellini) herfällt, bis hin zu „Mulholland Drive, in dem nicht nur lesbischer Sex für einen vermeintlichen Mainstream-Film auffällig selbstbewusst inszeniert wurde, sondern der auch (selten genug im Kino, aber längst nicht mehr so Aufsehen erregend wie in „Das Schweigen“ von Ingmar Bergman) eine Szene weiblicher Masturbation zeigt, gibt es unzählige Varianten der Sex-Darstellung.
Lynch, der in Interview mehrmals betonte, wie sehr er Sex als „Schlüssel zu einem fantastischen Geheimnis des Lebens“ betrachtet, nutzt die Darstellung von Sex dabei nie nur als erotisches Reizmittel, das den ästhetischen Bedürfnissen des Publikums Rechnung trägt, sondern inszeniert mit solchen Szenen immer auch zum Teil für die Figuren qualvolle Momente, in denen die oszillierende Macht zwischen den Geschlechtern sichtbar wird. Bezwingend ist die Szene in „Lost Highway“, wenn Fred Madison (Bill Pullman) von seiner Frau Renée demütigend auf den Rücken getätschelt wird, als er im Bett versagt. Zugleich erscheinen diese Ur-Szenen mehr als einmal das Tor zu einer anderen Dimension zu öffnen. Der (infantile) Zuschauer kann nicht mehr zurück zur Unschuld, nachdem er all dies gesehen hat.
Träume
Das Kino ist eine Projektion unserer Träume. Das Kino ist (scheinbar) in der Lage, die Logik unserer Träume sichtbar zu machen. Doch den wenigsten Filmemachern gelingt es, sich ohne Klischees an die ästhetische Mimesis tatsächlicher Traumerfahrungen heranzuwagen. David Lynch hat in vielen Gesprächen darauf hingewiesen, dass er mit seinen Filmen, in denen konkrete Träume der Figuren immer wieder thematisiert und auch dargestellt werden – am schönsten wohl in „Twin Peaks“ –, eher den Techniken des Tagtraums vertraut, die seiner Meinung nach viel eher das Potential hätten, zu Wahrheiten über die eigene Biographie vorzudringen (ist Lynch vielleicht ein Jungianer?). Aber letztlich geht es in diesen Filmen nicht nur darum, Traumsymbole zu entschlüsseln, sondern sich auf dieses Spiel mit Verschiebungen, Verdopplungen und Motiven einzulassen. Und zwar ohne Netz und doppelten Boden.
Die Traumsprache des Regisseurs wird nämlich erst dann ergiebig, wenn man ihre konzentrierte Form über alle Werke hinweg betrachtet. Dann sieht man die sich wiederholenden Symbole (Feuer!), dann entdeckt man als Zuschauer, welche geheimnisvollen Fährten der an konventioneller Psychologie vollkommen desinteressierte Lynch gelegt hat. „Mulholland Drive“ darf, was die Inszenierung von traumähnlichen Zuständen bzw. einer stringenten Traumlogik angeht, wohl als Höhepunkt in seinem Schaffen angesehen werden. Vielleicht ein eher der Not geschuldetes Glück, wurden doch einzelne Fragmente aus einer geplanten und dann vom TV-Sender ABC verworfenen Serie zu einem neuen Muster zusammengefügt. So wie Träume mit den Motiven eines Lebens spielen und sie manchmal quälend wiederholen, bedient sich Lynch aus dem Stoff- und Filmmaterial seines eigenen Werkes. Da war es kein Wunder, dass plötzlich die lakonischen Hasen aus einem Website-Special, das Lynch gedreht hatte, plötzlich auch in „Inland Empire“ auftauchten.
Unheimlich
Ein blauer Samtvorhang, die dramatischen Klänge von Angelo Badalamenti. Dann plötzlich ein blauer Himmel, rote Rosen, „Blue Velvet“ von Bobby Vinton, ein Feuerwehrwagen, winkende Feuerwehrmänner, sich im Wind wiegende gelbe Blumen, Kinder überqueren eine Hauptverkehrsstraße, von einem Lotsen sicher geleitet. Dann eines dieser typischen amerikanischen Vorstadthäuser, ein Mann sprengt den Rasen, eine Frau sitzt auf dem Sofa, sieht fern, trinkt einen Kaffee dazu, auf dem Bildschirm sieht man eine Pistole, vielleicht schaut die Frau einen Krimi. Plötzlich verfängt sich der Wasserschlauch in einem Gewächs, gleich könnte die Wasserzufuhr durchbrochen werden. Doch stattdessen fasst sich der Mann an den Hals, gestikuliert wild vor sich hin. Er hat wohl einen Schlaganfall. Er fällt auf den Boden. Das Wasser spritzt unkontrolliert aus dem Schlauch, ein Hund labt sich daran, ein Kleinkind tappst herbei. Noch immer „Blue Velvet“ von Bobby Vinton, aber das Geräusch des zähnefletschenden Hundes übertönt den Schlager. Dann geht taucht die Kamera ins Gras ab, immer tiefer, bis unzählige schwarze Käfer zu sehen sind, die immer lauter schmatzend etwas verschlingen. So beginnt „Blue Velvet“ – und damit gelingt David Lynch geradezu exemplarisch, in einer nahezu perfekten Filmsequenz, das Unheimliche zu visualisieren, jenes ästhetische wie psychologische Konzept, das Freud in seinem berühmten Essay zu greifen versuchte und bei den deutschen Romantikern in direktem Anschluss an die Gothic Novel wohl zum ersten Mal deutlich beschrieben wurde.
Verstörende Irritationen, die den Alltag durchbrechen und etwas von Alters her Vertrautes und längst Verdrängtes auf erschreckende Weise wieder ans Licht holen (Freud) gibt es bei Lynch zuhauf. Dazu beunruhigende Gestalten wie den Mystery Man in „Lost Highway“, der zugleich an zwei verschiedenen Orten sein kann und mit seinen Worten Einfluss auf das Leben der Hauptperson (und auch auf die Handlung des Films) nehmen kann. Schließlich all die Doppelgänger und Spiegelfiguren, Paradesymbol des Unheimlichen: Fred Madison/Pete Dayton; Renée Madison/Alice Wakefield; Mr. Eddy/Dick Laurent in „Lost Highway“, Betty Elms/Diane Selwyn und Rita/Camilla Rhodes in „Mulholland Drive“ (zwei Filme, die selbst wie Doppelgänger funktionieren, aufeinander verweisen, sich gegenseitig erhellen).
Dazu gelingt es Lynch mit seinen Filmen auf manchmal bedrückende Art und Weise Kritik an unserem Realitätsverständnis zu üben. Das funktioniert auch, in dem zwei wesentliche ästhetische Operationen der Populärkultur gegeneinander ausgespielt werden, die eigentlich nie aufeinanderprallen: Gewalt und Kitsch. Das Publikum wird so dazu gedrängt, die Emotionen in Frage zu stellen, die es aus unzähligen Kinofilmen und Fernsehserien eintrainiert hat und wohl auch für das eigene Leben anzuwenden weiß. Passiert im wahren Leben eine Situation, die in einer bestimmten Form unheimlich, ja bedrohlich und geheimnisvoll ist, so wäre es nicht unwahrscheinlich, dass sie in dem Fall „lynchesk“ genannt werden könnte.
Voyeurismus
Auch hier wieder: „Blue Velvet“. Jeffrey Beaumont kann gerade noch in den Kleiderschrank flüchten und muss nun etwas beobachten, das ihn wie auch den Zuschauer wohl gleichsam abstößt wie eigenartig erregt. Auf jeden Fall sorgt diese Variation der Ur-Szene (Kind beobachtet Mutter und Vater beim Sex) dafür, dass Jeffrey der geheimnisvollen Brünetten Dorothy Vallens verfällt. Oftmals qualvoller Voyeurismus prägt die Filme von Lynch. Es wird gezeigt, wovor man sonst die Augen verschließen würde. Natürlich trauern die Figuren in „Twin Peaks“ um Laura Palmer, aber sie tun es so intensiv und ausgiebig, wie wir es aus dem Fernsehen und Kino nicht gewohnt sind. Die Trauer ist sonst stets nur Anlass für eine Weiterentwicklung einer Geschichte. Nicht so in „Twin Peaks“, hier ist die Trauer um Laura Palmer die emotionale, atmosphärische Kernenergie, die erst alles andere, das in der Serie passiert, zur Entfaltung bringt. Man will als Zuschauer mittrauern; Angelo Badalamenti versucht dies mit seinem hochemotionalen Thema, das immer erklingt, wenn es um die Ermordete geht, zu unterstützen. Doch recht eigentlich wartet man, von unzähligen Krimis und Horrorfilmen daran gewöhnt, dass die Fassade aufgebrochen wird und die (auch von der Trauer entlastende) Wahrheit ans Licht kommt. Unheimlich ist es dann aber doch, wenn es plötzlich nicht mehr um die Aufklärung eines Gewaltverbrechens geht, sondern um den Geschmack von Donuts und Kaffee. Das Böse kann an jeder Ecke lauern, sogar hinter dem Parkplatz eines Diners. Das Publikum wird gezwungen, zu sehen. „Zu beobachten, ohne selbst gesehen zu werden, ist eine tolle Sache“ – so Lynch in einem Interview.

Wahnsinn
Henry Spencer wird in „Eraserhead“, alleingelassen mit einem Monster, verrückt. John Merrick, der „Elefantenmensch“, leidet weniger an seinem grotesken Äußeren als vielmehr an seiner Schwermut. Frank Booth erstickt in „Blue Velvet“ fast an seinen sexuellen Aggressionen („Ich ficke alles, was sich bewegt“), Laura Palmers Mörder in „Twin Peaks“ ist vielleicht Produkt einer gefährlichen Schizophrenie, an der wohl auch Fred Madison in „Lost Highway“ leiden könnte, oder eben tatsächlich besessen von einem Dämon namens BOB. In „Wild At Heart“ ist sogar die Liebe, die letzte Gewissheit, auf die sich die aus den Fugen geratene Welt noch einigen kann, irrsinnig geworden. In Lynchs Kunstwerken herrscht der Wahnsinn, der sich an Logik und Sinn zu schaffen gemacht hat. Auch hier folgt der Regisseur konsequent dem Programm der Surrealisten, die sich am Kranken und Wirren labten wie der Barock am Tod.
Zauberer von Oz
An diesem uramerikanischen Stoff von Frank L. Baum, 1939 verfilmt von Victor Fleming, arbeitet sich Lynch seit Jahrzehnten ab. Die roten Schuhe, sie kehren in „Wild At Heart“ wieder (ebenso wie die gute Fee und die böse Hexe). Natürlich heißt Isabella Rossellini in „Blue Velvet“ Dorothy. Lynch: „Der Zauberer von Oz hat etwas von einem Traum und übt eine enorme emotionale Kraft aus.“ Es ist also schier unmöglich, die Filme Lynchs zu sehen, ohne diese Grundlage seiner Obsessionen für sich erschlossen zu haben.
Folgen Sie dem Verfasser dieser Zeilen, wenn Sie mögen, auf Twitter, Facebook und auf seinem Blog („Melancholy Symphony“).




