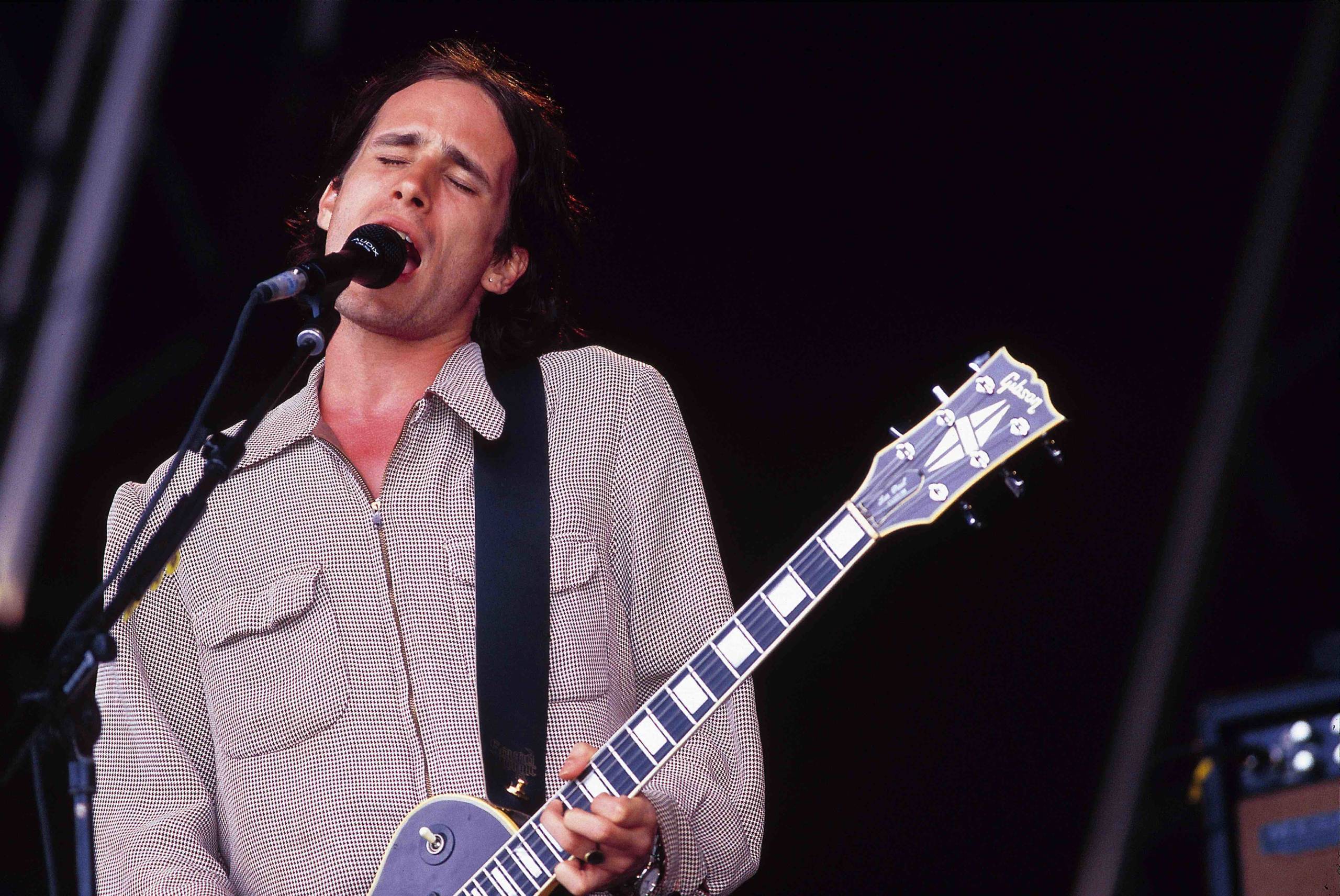Das kommt einem Englisch vor
Vielleicht sind es ja nur Klischees, mit denen ein Popsong seine britische Seele offenbart. Klischees, die den Rest der Welt verzücken, obwohl der britische Musiker doch nur seinen Job erledigt. Aber was genau kennzeichnet diese Zutaten? Und woher kommen sie?

Jetzt ist Ihre Phantasie gefragt: Wir schreiben das Jahr 1957. Sie sind zwölf Jahre alt, leben in einer englischen Kleinstadt irgendwo in den Midlands. Sie bewohnen mit ihrer Familie ein bescheidenes Reihenhaus aus Backstein, ganz in der Nähe der Fabrik, in der Ihr Vater arbeitet. Der nimmt Sie regelmäßig mit zum Fußballplatz, und in den Sommerferien geht’s nach Blackpool oder an die Küste von Wales. Sie würden lieber diesen neuen Rock’n’Roll im Radio hören, doch noch hat ihre Mutter die Hoheit über den Empfänger. Während der Hausarbeit hört sie immer alte Music-Hall-Schlager, deren Texte sie allesamt auswendig zu kennen scheint. Eigentlich könnten Sie auch längst mitsingen, doch Sie wollen ja lieber diesen Elvis hören. Oder zumindest jene Folkies, die unten im Pub um die Ecke Trinklieder, Moritaten und Romantisches aus längst vergangenen Zeiten singen, doch im Pub haben Sie noch nichts verloren.
Wenn Sie 18 sind, werden Sie in die Großstadt ziehen, Sie werden ihr eigenes Radio besitzen, die Art School besuchen, mit Ihren Kumpels in den angesagten Clubs abhängen. Und sich vielleicht manchmal an die proletarische Idylle Ihrer Kindheit erinnern, an den Fußballplatz, an das zugewucherte Gelände entlang der Bahnlinie hinter der Fabrik, an Mutters Music-Hall-Schlager und daran, wie sie Ihnen Kenneth Grahames „Wind in den Weiden“ vorlas, als Sie noch ganz klein waren. Da Sie die Art School nur gelegentlich aufsuchen, damit ihre Alten das Gefühl haben, aus Ihnen würde mal etwas Besseres werden, haben Sie viel Zeit. Die brauchen Sie allerdings auch, um all die amerikanische Musik zu dechiffrieren, die aus Ihrem Transistorradio plärrt, um neue Akkorde zu lernen und Gigs in den Vororten klarzumachen. Immerhin spielen Sie jetzt in einer Band und wollen so berühmt werden wie diese Typen aus Liverpool, die auch noch nicht so lange in der ganz großen Stadt leben.
Sie sind jetzt ein englischer Musiker. Sie gehören zur ersten Generation, der es gelingen wird, eine spezifisch britische Popmusik zu kreieren, die weltweit erfolgreich sein kann. Kommt natürlich drauf an, in welcher Band Sie spielen. Kommt auch drauf an, ob Sie die hektisch wechselnden Zeichen der Zeit erkennen werden, ob Sie sich von den amerikanischen Idolen emanzipieren können. Mit 20 werden Sie vielleicht ein Mod sein, der sein proletarisches Underdog-Gefühl mit französischer Couture kompensiert, auf italienische Motorroller und amerikanischen Soul abfährt. Wenn in Ihrem Art-School-Umfeld dann die ersten Hippies auftauchen, werden Sie womöglich LSD probieren, Allen Ginsbergs „Howl“ lesen, Grahames „„Wind in den Weiden“ mit fernöstlicher Mystik kreuzen, mit schrulligen Music-Hall-Klängen oder dem Folk aus dem Pub an der Ecke. Wenn die Kaftan- und Räucherstäbchen-Sause vorbei ist, werden Sie unter Umständen in eine Landkommune ziehen, das LSD sein lassen und sich dem einfachen Leben verschreiben. Ihr akustischer Folk, der von Farmern, Rittern und Seeleuten handelt, wird alle Gleichgesinnten begeistern. Es gibt natürlich weitere Optionen.
Sie haben die Wahl
Sie möchten lieber in der Stadt bleiben und ihren Alten beweisen, dass die Zeit auf der Art School doch nicht umsonst war? Dann machen Sie doch aus Tolkiens Trilogie ein anspruchsvolles Dreifach-Konzeptalbum, rocken dazu progressiv und lassen sich dafür vom Feuilleton feiern. Nicht glamourös genug? Dann nutzen Sie den libertinären Zeitgeist der Stunde, geben Sie den Dandy, werfen Sie sich in androgyne Phantasieuniformen, tragen Sie Federboas, legen Sie Make-up auf und stolzieren Sie in glitzernden Plateaustiefeln über die Bühne. Ihre Landsleute haben dafür vollstes Verständnis, denn singende Männer in Frauenkleidern gab es schon in der Music Hall, als Winston Churchill noch Kolonialminister war. Kann aber auch sein, dass Ihnen all das viel zu aufgeblasen, seltsam oder gar lächerlich vorkommt. Dass Sie im Grunde ihres Herzens ein Kleinstadtjunge aus der Arbeiterklasse geblieben sind, dem das Cup-Finale und ein veritabler Bierrausch viel mehr bedeuten als bunte Pillen bei Upper-Class-Partys in Kensington und langatmiges Gelaber über moderne Kunst. Die Lads im Fußballstadion ticken ganz genauso wie Sie und grölen Fragmente Ihrer herzhaft schlichten Rocksongs, wann immer es der Spielstand angeraten erscheinen lässt. Letztlich ist es jedoch ganz egal, wie Sie sich entscheiden werden. Sofern Sie auch nur eines dieser Klischees bedienen, ob bewusst oder unbewusst, wird man Ihre Musik im Rest der Welt mit großer Wahrscheinlichkeit als „„typisch britisch“ empfinden.
Natürlich gab es auch immer Inselmusikanten, die von all dem nichts wissen wollten, die durch und durch amerikanisch geprägt waren oder eine universelle Popsprache bevorzugten. Und im globalisierten Popgeschehen der Gegenwart macht ohnehin jeder alles, und zwar überall. Dass es seit den sechziger Jahren eine typisch britische Popmusik gibt, dürfte allgemein bekannt sein. Verwirrend nur, dass jene Zutaten, die als originär britisch empfunden werden, sich bisweilen diametral gegenüberstehen. David Bowie als glamouröser Alien, Brian Eno als Glitzerkönig? Ziemlich abgehoben, artifiziell und irgendwie auch ganz schön schwul. Jethro Tull als zottelbärtige Relikte aus der Dickens-Ära? Rustikal verschrobene Waldschrate, die beim Sex wahrscheinlich ihre Wollmützen aufbehalten. Slade als bierselige „Skweeze-mepleeze-me“-Lads? Bodenständig und absolut hetero. Nur: All das passierte zeitgleich, und all das wurde und wird zu Recht als typisch britisch wahrgenommen. Denn so wie es war, konnte es nur von der Insel kommen. Warum eigentlich?
Typisch englisch
Maßt man sich an, den britischen Pop in ein System zu pressen, stößt man früher oder später auf vier tragende Säulen, auf deren gemeinsamer Arkade der Union Jack flattert. Eine davon ist die britische Volksmusik, die sich – ebenso wie die amerikanische ins Popzeitalter retten konnte, ihm sogar den Weg geebnet hatte. Englische Popmusiker durften immer aus einem reichen Fundus an Melodien und Texten schöpfen, die sich problemlos in Pop und Rock integrieren ließen. Als Konzept, als Zitat, als Fragment oder einfach nur als Klangfarbe. Die linearen Erzählstrukturen manch alter Folkballaden inspirierten britische Songwriter ebenso wie die mitunter romantischen, skurrilen oder gar mythischen Sujets. Wer dann noch mit Lewis Carrolls „„Alice im Wunderland“, mit der Artus-Sage und Grahames „Wind in den Weiden“ aufgewachsen war, wer in der Schule eine zusätzliche Dosis Sir Walter Scott verpasst bekommen hatte, der ließ all das womöglich später in seine Songs einfließen. Egal, ob es sich im Ergebnis um den Folkrock von Fairport Convention, den komplexen Kunstrock der frühen Genesis oder Syd Barretts psychedelische Kinderlieder handelte: All das, so unterschiedlich es auch klingen mochte, trug englisches Folk-Erbgut in sich.
Und manchmal auch jenen skurrilen Humor, der die zweite Säule britischer Pop-Eigenarten ziert. Eine Säule, die ebenfalls schon etwas länger steht. Etwa seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die rasch anwachsende Stadtbevölkerung des britischen Empires nicht mehr nur durch harte Arbeit Albions Ruhm und Reichtum mehren wollte, sondern auch bezahlbares Amüsement einforderte. Die englische Oberschicht ging in die Oper, die Working Class ließ sich in der Music Hall unterhalten, von Sängern, Varietekünstlern und Komödianten. Die Music Halls der besseren Gegenden machten vielleicht auf vornehm, doch da, wo das Proletariat feierte, ging es recht ausgelassen zu. Viktorianische Prüderie hin oder her. Man tanzte, trank Bier und Gin in ungesunden Mengen, man amüsierte sich über Travestie, allerlei Zoten und derbe Parodien auf die hochwohlgeborenen Lords und Ladies. Kurz gesagt: Man hatte „„a jolly good time“, musikalisch untermalt von rührseligen Balladen und flotten Schlagern. Während etwa in Deutschland – aus durchaus auch nachvollziehbaren Gründen – der Kulturkampf zwischen „„Poprevolution“ und „„Schlagermief“ tobte, hatten englische Musiker weit weniger Probleme damit, sich bei der Unterhaltungsmusik ihrer Eltern und Großeltern zu bedienen. Augenzwinkernd womöglich, mit ironisiertem Sentiment, oder auch nur als Ritt auf der Nostalgiewelle – aber doch stets liebevoll und mit Respekt. Ob The Kinks 1966, Queen 1976, The Smiths 1986 oder Blur 1996 – an das Music-Hall-Erbe knüpfen britische Bands immer wieder gerne an.
Alles nur Vorurteile?
Ein Aspekt der britischen Mentalität mag dafür mitverantwortlich sein: Amerikanern etwa sagt man nach, alles Neue grundsätzlich für gut und besser zu halten, der Brite hingegen kultiviert offenbar lieber die Rolle des Skeptikers. Allzu krasse Umwälzungen sind seine Sache nicht – sollte sich die EU jemals erfrechen, den europaweit einheitlichen Rechtsverkehr und metrische Maße einzufordern, wird das gewiss als unverfrorener Angriff auf nationale Errungenschaften begriffen. Und da versteht der Brite keinen Spaß. Den Euro können wir uns sowieso sonst wohin stecken, Pfundkrise hin oder her. Auch wenn natürlich nicht jeder Insulaner dem Klischee entsprechend um Punkt fünf Uhr alles stehen und liegen lässt, um eine Tasse Tee zu trinken – Traditionen werden hoch gehalten, und die Sehnsucht nach dem Gestern, in manchen Teilen der Welt eher belächelt, ist durchaus ein Bestandteil britischer Alltagskultur. In Deutschland wurde das Auto zwar erfunden, doch die weltweit ersten Oldtimer-Clubs entstanden in England. Trainspotter jagen Dampfloks nach, und die British Music Hall Society kümmert sich bis heute um die leichte Muse aus der guten, alten Zeit.
Auf einer langen Tradition fußt auch die dritte Säule britannischer Popkunst: Ladism, jene maskuline Kumpeligkeit, die in Provinz-Pubs ebenso erblüht, wie in lederbesesselten Herrenclubs oder den Fußballstadien. Die Lads aus der Oberschicht gehen womöglich gemeinsam zur Jagd, die aus der Unterschicht jagen eher dem sozialen Aufstieg nach. Das Ziel ist „„a house in the country and a big sports car“ (Ray Davies) oder zumindest eine ordentliche „„Champagne Supernova“ (Oasis). Musiker zu sein, war ab den frühen sechziger Jahren eine ernst zu nehmende Karriereoption, denn „„what can a poor boy do, except to sing for a rock’n’roll band?“ (Mick Jagger). Unter Lads herrscht jedenfalls ein gewisser Korpsgeist, man ist klassenbewusst, rau aber herzlich, man trinkt so viel wie sonst kaum jemand in Europa und pflegt eine innige Abneigung gegen „die da oben“. Man badet in „Heinz Baked Beans“ (Roger Daltrey), trägt Fußballshirts (Liam Gallagher) oder outet sich lustvoll als Dialektsprecher von der falschen Seite der Stadt, der die herben Reize von „Rene, „the dockers‘ dee-loit“ (Steve Marriott) besingt. Ladism im britischen Pop war meistens vom trotzigem Stolz der Arbeiterklasse beseelt, was mitunter auch reichlich kuriose Blüten trieb. Man erinnere sich nur an die neunziger Jahre, als – von der Presse genüsslich angeheizt – der Konflikt Oasis (Working Class) gegen Blur (Middle Class) ausgetragen wurde.
Proletarier aller Grafschaften! Gründet Bands!
Viele britische Working-Class-Lads waren es auch, die ab den sechziger Jahren in mittlerweile vergessenen Bands durch die halbe Welt tourten, um sich ein Stück vom großen Pop-Kuchen abzuschneiden. Gerade in kontinentaleuropäischen Clubs und Kneipen war es seinerzeit en vogue, „original englische“ Kapellen auftreten zu lassen. Die Veranstalter freuten sich über das Arbeitsethos der britischen Musikmalocher, die bei mieser Bezahlung und Unterbringung stundenlang zum Tanz aufspielten – und die Gage vielleicht auch noch an der hauseigenen Bar in geistige Getränke investierten. Ein gutes Geschäft also. Das nur funktionierte, weil der Lad lieber in einem italienischen Touristenkaff Bassgitarre spielte, als daheim in Stoke-On-Trent an der Fräsmaschine zu stehen oder Post auszutragen – wenn dort überhaupt eine Stelle frei war. Britische Musiker waren überall, und manche von ihnen schafften es bekanntlich bis ganz nach oben. Denn sie waren hartnäckig. Und sammelten als Live-Musiker jede Menge Erfahrungen, von denen sie später womöglich profitieren konnten.
Higher Education
Das Vokabular aus britischem Folk, Music Hall und Ladism wäre auf der internationalen Bühne wohl viel eher eine Fremdsprache geblieben, wenn es nicht einen Katalysator gegeben hätte, ein Sammelbecken, in dem alles zusammenfließen konnte. In den Art Schools wurde der britische Pop vielleicht nicht erfunden, aber ständig weiterentwickelt und zum Markenzeichen erhoben. Die Basis waren amerikanischer Rock’n’Roll und besagte Versatzstücke aus heimischer Produktion, dazu gesellten sich R’n’B und Motown-Soul, Jean-Paul Sartre und moderne Kunst, Fantasy-Literatur, Surrealismus, Poesie und Film, Orientalisches, Karibisches, Elektronik, Dandytum, Drogen, Nihilismus, Radikalität und die Verheißungen des Space Age. Wobei eines klar sein sollte: Mit universitären Kunstakademien deutscher Prägung haben die Art Schools wenig gemein. Es sind „Institutes Of Higher Education“, und nicht in jeder Einrichtung kann man einen profunden Abschluss erwerben, von akademischen Titeln ganz zu schweigen. Die Zugangsvoraussetzungen bestimmt jedes Institut selbst. Was es nun einmal mit sich bringt, dass die Art Schools seit Jahrzehnten ein idealer Nährboden für all jene sind, die künstlerische Ambitionen jedweder Art in sich herumtragen, den eigentlichen Masterplan vielleicht aber noch nicht so recht entwickelt haben. Für angehende Popmusiker das perfekte Biotop. Doch es waren nicht nur Musiker, die aktiv ins Pop-Geschehen eingriffen. Storm Thorgerson etwa studierte am Royal College Of Art – einer „„richtigen“ Universität übrigens -, wo er aus Fotos surreale Montagen herstellte. Die befreundeten Pink Floyd ließen ihn das Cover ihres zweiten Albums „A Saucerful Of Secrets“ gestalten, den gemeinsamen Durchbruch erlebte man fünf Jahre später mit „„Dark Side Of The Moon“: Pink Floyd setzten sich damit für Jahrzehnte in den US-Charts fest, Thorgersons Grafikbüro Hipgnosis konnte sich vor Aufträgen kaum retten. Seine Artworks für Led Zeppelin, Black Sabbath und Genesis prägten die Schallplattenverpackungskunst der siebziger Jahre ebenso stark wie die Fantasy-Gemälde eines weiteren Absolventen der königlichen Kunstschule: Roger Dean, Haus-und-Hof-Grafiker der Progrocker Yes und Meister der bizarren Landschaften. Frodo im Wunderland. Alice in Mittelerde. Sehr britisch jedenfalls.
Hilfreich zudem, dass 1960 die Wehrpflicht abgeschafft wurde, und dass es im Nachkriegsengland sanfte Bestrebungen gab, die „Higher Education“ zunehmend auch jenen angedeihen zu lassen, die ohne goldenen Löffel zur Welt gekommen waren. Dem Seemannssohn John Winston Lennon etwa, und dem Bergarbeiterspross Bryan Ferry. Leuten, denen ein ungeheures Potenzial innewohnen konnte, die jedoch aufgrund ihrer Herkunft im ständisch geprägten Inselstaat nicht die besten Perspektiven genossen – und zwar über Generationen hinweg. Dass Arbeiterkinder erfolgreich im Kulturbetrieb mitmischen, galt als undenkbar, denn was Kultur war, entschied traditionell die Oberschicht. Der Schauspieler Michael Caine erzählte einmal in einem Interview, wie ungewöhnlich es für einen Proletariersohn wie ihn noch in den fünfziger Jahren gewesen sei, an renommierten Theaterproduktionen mitzuwirken. Ihren Shakespeare fest in Beschlag genommen, stammten britische Mimen traditionell aus gut- bis großbürgerlichen Schauspieler-Dynastien, die Namen und Profession an ihre Kinder weiterreichten – und manchmal sogar das Talent. Doch die Poprevolution, losgetreten in den USA, verfeinert in den britischen Art Schools, war von Anfang an proletarisch und mittelständisch geprägt und setzte die gesellschaftliche Umwälzung mit in Gang. Konnten Dialektsprecher aus den Problembezirken bislang bestenfalls im Sport-Dress Prominenz erreichen, funktionierte es jetzt auch auf der Theaterbühne oder mit einer Gitarre um den Hals.
Pop-Aristokraten
Doch der britische Pop wäre nicht er selbst, wenn er zum Working-Class-Rabauken nicht immer auch das exakte Gegenstück im Repertoire gehabt hätte: den Dandy. Hedonistisch, gebildet und mit feinen Manieren gesegnet, eine elegante Erscheinung, amüsant in der Konversation, auch wenn stets ein bisschen Weltschmerz, ein wenig Sarkasmus durchschimmert. Homosexualität ist nicht zwingend erforderlich, wird aber ebenso toleriert wie das Zitieren provokanter Oscar-Wilde-Bonmots oder der möglichst unauffällige Konsum von Kokain. Noch ein Stereotyp, keine Frage, aber eines mit geographischer Herkunft. Und eines, das der britische Pop fast zwangsläufig absorbieren musste. In Anlehnung an Britanniens Klassengesellschaft war schon recht früh von der „neuen „Pop-Aristokratie“ die Rede. Von Musikern also, die aufgrund ihrer Popularität und ihres Wohlstands plötzlich Zutritt zur feinen Bussi-Gesellschaft erhielten und sich deren Gepflogenheiten je nach Lust und Laune anpassten. Es konnte ein Geschäft auf Gegenseitigkeit werden: Upper-Class-Langweiler durften ihre Partys mit crazy Künstlertypen und verruchten Popstars aufwerten, Musiker, die an der Art School waren.
All die Britishness ließ sich seit den sechziger Jahren nämlich auch prima vermarkten. Der bundesdeutsche Show-Ausstatter Heinemann führte „„Original Chelsea Boots“ und „Beathosen (englischer Schnitt)“ im Programm, das Kinopublikum delektierte sich an den finsteren Herrenhäusern, den düsteren Kellergewölben und nebligen Kopfsteinpflastergassen der Edgar-Wallace-Verfilmungen. Die wurden zwarvornehmlich in Hamburg und Berlin gedreht, prägten das Englandbild der Deutschen aber nachhaltig. Die sechziger Jahre waren zweifellos das anglophile Jahrzehnt: Der mythenumrankte und auch Deutschen geläufige Begriff „„Dandy“ verhalf den Kinks 1966 zu ihrem einzigen Nummer-1-Hit in den hiesigen Charts, ein englischer Musikproduzent nannte sich Marquis Of Kensington und besang „„The Changing Of The Guard“, während die New Vaudeville Band auf die „„Winchester Cathedral“ pfiff. Europäische Teenies pilgerten scharenweise zum Klamottenkauf in die Carnaby Street, amerikanische Garagenbands nannten sich The Buckinghams oder The E-Types und spielten auf englischen Vox-Verstärkern. Scotch Whisky war das Modegesöff, Twiggy das Mode-Idol, Mary Quant stellte den Mini zum Tragen her, die British Motor Corporation den Mini zum Fahren. Und James Bond räumte als britischer Held mit finsteren Gegenspielern auf. Alles hip, alles cool. Alles britisch. Selbst die Franzosen, allzu großer Liebe zur Insel im Norden eher unverdächtig, nennen jene Dekade bis heute „epoque yeh yeh“.
Der spezifisch englische Faktor mag seine Rolle als Trendsetter verloren haben, omnipräsent ist er dennoch. Nur muss er nicht mehr zwangsläufig aus England kommen. Die Britpop-Ikonographie aus Targets, Moptops, Fred-Perry-Shirts und vorlautem Ladism ist heute globales Popkulturgut, die dazugehörige Musik darf aber ruhig auch aus Schweden kommen, wenn sie so clever inszeniert ist wie bei Mando Diao. Folkige Verschrobenheit liefert Devendra Banhart aus den USA, und der Kanadier Rufus Wainwright kokettiert nicht mehrdeutig mit androgynem Glamour, sondern ist ganz eindeutig ein bekennender Schwuler, der großartige Songs schreibt. Der Rest der Pop-Welt hat dazugelernt, vieles gar komplett absorbiert. „Things May Come And Things May Go But The Art School Dance Goes On Forever“, prophezeite 1969 der Dichter, Musiker und Kunstschul-Veteran Pete Brown. Gewiss. Aber getanzt wird heute überall.