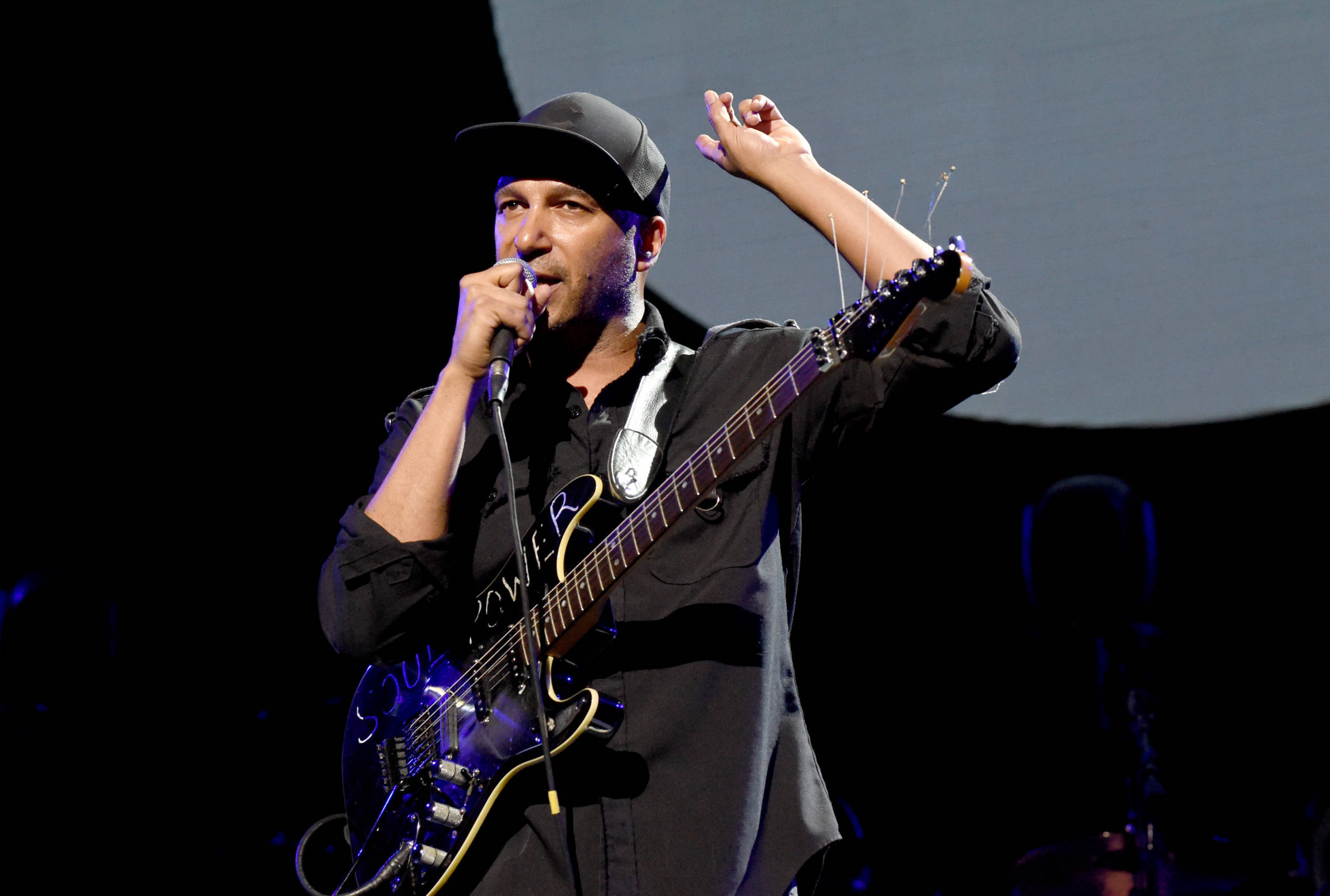Auf den Spuren von Iron John: die rituellen Exorzismen des Jackie Leven
Die Debilisierung der Gesellschaft schreitet fort, das geistige Pygmäentum feiert sich und seinen zunehmenden Einfluß auf die neuere Evolutionsgeschichte – und nirgendwo ist das besser zu beobachten als im Musikbetrieb der neunziger Jahre. So weit, so unbestritten. Jackie Leven nickt vielsagend und grinst. Dann holt er zum Gegenentwurf aus, und in den Gehörgängen des Zuhörers hallt es wider von Mannesmut und Kriegern, von Opfermut und Müttern, von Ehrlosigkeit und ruhmreichen Vorfahren, von verbotenen Liedern, gefährlichen Mythen und todbringenden Schatten. Manches klingt heimatselig, als wäre der Highlander in Luis Trenker gefahren. Doch Jackie Leven ist kein Schrat und gewiß kein Kindskopf, auch wenn seine äußere Erscheinung leichte Zweifel aufkommen läßt: kurze Hosen, die stämmigen Beine in weißen Wollkniestrümpfen, derbes Schuhwerk. Mit 45 schon knorrig wie eine alte Eiche. Zivilisationskritik hat viele Gesichter. Das von Jackie Leven ist ehrlich, und hier oben in Argyll, am Loch Feochan, dem „Loch Of The Gentle Winds“ an der schottischen Westküste, inmitten dieser so kargen wie harmonischen und atemberaubend schönen Landschaft scheint vieles Sinn zu machen von dem, was er mit beinahe missionarischem Eifer zu vermitteln sucht. Die verdrängten Wahrheiten und notdürftig verhangenen seelischen Abgründe, von denen er zu berichten weiß, korrespondieren auf seltsame, magische Weise mit den klaren Seen, zerklüfteten Felsen und sanft geschwungenen Hügelketten. Levens Gedankenwelt ist so archaisch wie seine Wahlheimat, die er vor allem wegen des Menschenschlages schätzt, der hier gedeiht. „Die Leute hier sind noch nicht gekrümmt“, singt er das Hohelied auf den einfachen Mann, „sie sind geradeheraus, und in ihren Adern fließt auch irisches Blut. Das ist einer der Gründe, warum ich hierhergezogen bin. Mein Geburtsort liegt an der Ostküste, wo die Lebensart mehr skandinavisch und protestantisch geprägt ist, und das liegt mir weniger.“ Right place, wrong time. Leven scheint für diese Zeit keine Zeitzu haben. Anstatt sich aber Selbstzweifeln hinzugeben, verzweifelt er lieber an der Welt und an der Würdelosigkeit ihrer Bewohner. Er selbst, sagt er, stamme „front the Kingdom of Fife in Scotland“, und auch sein treuer Mitstreiter, Keyboarder James HallawelL ist nicht einfach nur Engländer oder Brite, nein, er ist Kelte, und seine Heimat ist „the ancient Kingdom ofCornwall“. Dabei ist Jackie Leven alles andere als ein Wirrkopf nach einer Überdosis Tolkien. Er ist ein engagierter Mann. Die persönlichen Katastrophen, die sich wie ein blutroter Faden durch seine Biographie ziehen, waren oft dramatisch und nicht selten auch traumatisch, von seinen frühesten Kindheitserinnerungen über Gewaltakte und körperliche Versehrtheit bis hin zur Rauschgiftsucht. Leven lernte, all die Widernisse als einziges, umfassendes Purgatorium zu begreifen und daraus die nötigen Schlüsse zu ziehen. Sein Heroin-Joch streifte er aus eigener Kraft ab, gründete ob dieses Sieges den „Core-Trust“ und hilft so seither anderen Gestrauchelten. Therapeutischen Charakter hat fraglos auch seine führende Rolle in der Männerbewegung des amerikanischen Poeten Robert „Iron John“ Bly, dessen Gedichte es dem kleinen Jackie bereits im zarten Alter von 14 Jahren angetan hatten. Heute ist Bly für Leven eine Art Übervater und geistiger Guru. „Wir fuhren hundert Männer in die Wildnis“, verkündet er stolz, „and fuck them up with poetry, drumming and stories.“ In der Verweichlichung und Domestizierung des Mannes sieht er allen Ernstes die Ursache für fast alle Übel und setzt auf die „reinigende Kraft“ des rituellen Exorzismus. Mich schaudert. Die Einladung zur Teilnahme an einer solchen Virilitätsorgie lehne ich freundlich, aber bestimmt ab. Auch als Songwriter und Musiker sucht Jackie Leven seinesgleichen. Das war schon so, als er sich Ende der siebziger Jahre in London mit seiner Band Doll By Doll zwischen alle Stühle setzte. Nicht Punk, nicht Schlock zelebrierten Doll By Doll, gleichwohl Rockmusik mit Donnerhall und „Grand Passion“ (Album-Titel). Leven war wild, und die Musik hatte etwas Uriges, Manisches, Gothisches. Die Marketing-Strategen verzweifelten schon damals an ihrer Sperrigkeit, und daran hat sich wenig geändert. Obschon Leven seine musikalische Vision auf dem neuen Doppel-Album „Forbidden Songs OfThe Dying West“ nahezu vollkommen realisiert hat Waren die Songs auf dem vielgepriesenen Vorgänger noch grobe Sketche und Skizzen, so ist das Material der neuen CD bis ins letzte Detail hinein durchdacht und dramaturgisch perfekt umgesetzt. Traumtrunken ist diese Musik, jedoch nie verträumt, schwadronierend, aber selten schwülstig. Die zuweilen beängstigende Nähe zur Esoterik im allgemeinen und zu New-Age-Pomp im besonderen schreckt indes nicht, solange er Zeilen schreibt wie diese: „We sat in a bar, she went for a piss, I confessed the emptiness of every kiss.“ Der Song heißt „Leven’s Lament“. Wie seine eigene Whisky-Marke. Echt.