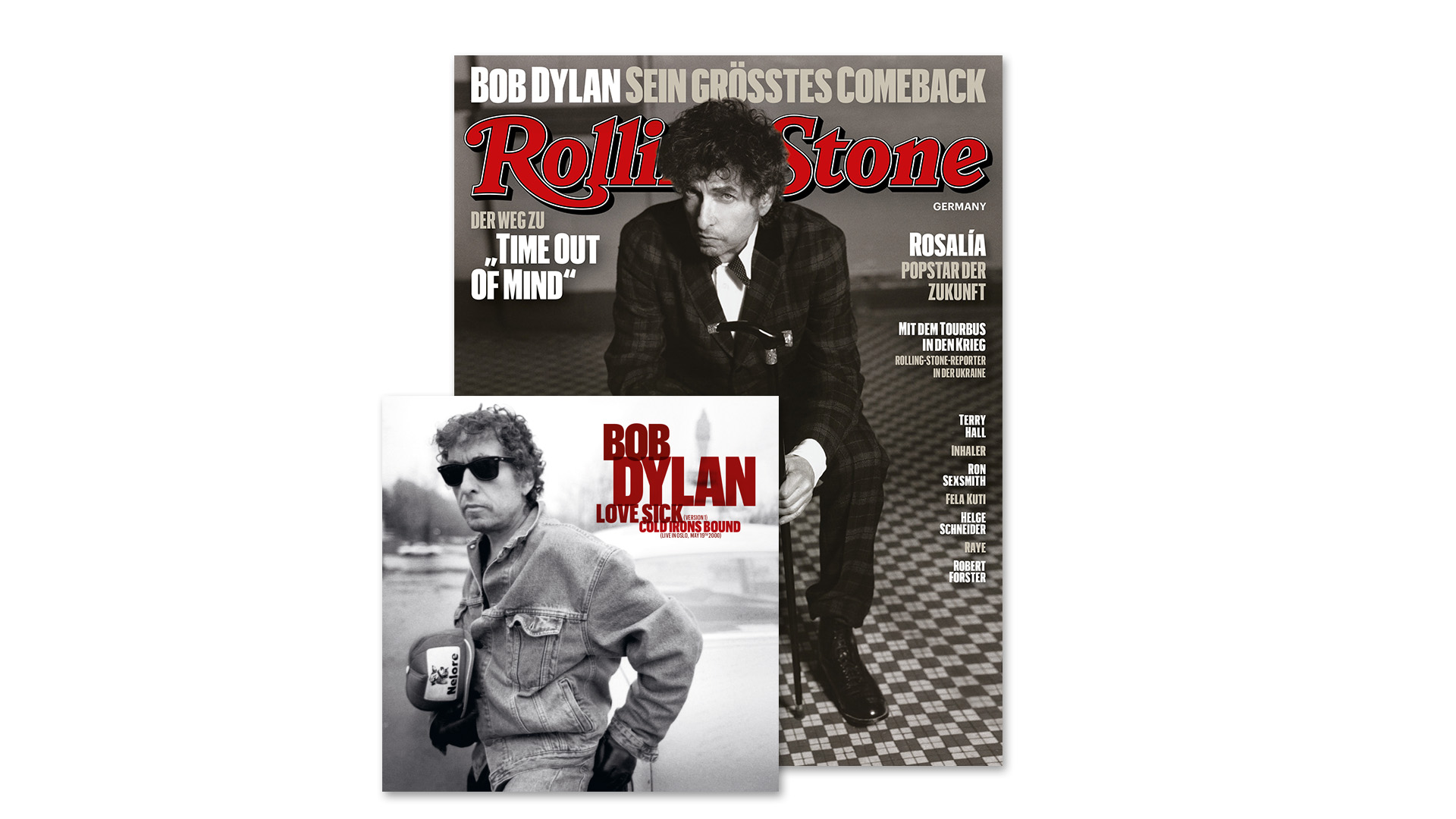And the Beat goes on
Es reicht nicht, diese Musik nur mit dem Kopf zu hören. Was weiß denn unser Verstand von Dingen, die sich viel tiefer abspielen? Wenn eine über zwölfköpfige nigerianische Band vor einem steht und die Trommeln rufen – ausdauernd, monoton, fordernd -, dann klopft in der eigenen Brust das Leben selbst einen synkopierten Beat. Ein halbes Dutzend mit Pailletten und riesigen Federn geschmückte Sängerinnen tänzeln auf die Bühne. Sie drehen dem Publikum keck den Rücken zu, gehen in die Hocke, um dann so lange mit den Hüften zu rotieren, bis einem schwindelig wird. And the beat goes on and on and on… Auch wenn es nur der Sohn war und nicht der heilige Vater: Der Auftritt von Femi Kuti in einem New Yorker Club hatte viel von dem, was gläubige Menschen eine Epiphanie nennen.
Wundert sich da noch jemand, dass Afro-Beat seit 30 Jahren nicht tot zu kriegen ist? Wie jede Spielart der Popmusik die etwas taugt, wurzelt die Mischung aus Yoruba, Funk, Highlife, Jazz und traditionellen afrikanischen Rhythmen und Gesängen in der Unzufriedenheit eines Menschen mit den Zuständen, unter denen er lebt. Der Nigerianer Fela Anikulapo Kuti gründete bereits Ende der Fünfziger die Band Koola Lobitos, aber erst die Begegnungen mit James Brown, Miles Davis und Aktivisten der Black Panthers während eines längeren USA-Aufenthalts 1969 schärften das musikalische und politische Profil des Saxofonisten und Bandleaders. Nach seiner Rückkehr nannte Fela Kuti seine Band „Africa 70“ und gründete die Kalakuta Republic, eine Musiker-Kommune mit angeschlossenem Aufnahmestudio. Bald hatte der frischgebackene Sozialist und Anhänger des Panafrikanismus auch seinen eigenen Club, „The Afrika Shrine“, wo er mit Africa 70 regelmäßig auftrat. Im Verlauf der 70er Jahre wurde Fela Kuti nicht nur zum größten afrikanischen Popstar, sondern auch zum Volkstribun und „Black President“. Die Reaktion der autoritären nigerianischen Regierung ließ nicht lange auf sich warten. Regelmäßig wurden die Kalakuta Republik und ihre politischen Unruhestifter von Razzien heimgesucht. 1977 führte das Album „Zombie“, auf dem die Armee Nigerias als leichenfressende Untote beschrieben wird, zum Großangriff auf die Kalakuta Republic. An die 1000 nigerianische Soldaten brannten den gesamten Komplex nieder, inklusive Studio und „Shrine“-Club.
Fela Kuti und seine Band spielten und kämpften noch zwei Jahrzehnte lang weiter – zornig, beseelt, ungeduldig. Und diese vor Energie vibrierende, ungeheuer dynamische Musik blieb auch außerhalb Afrikas nicht unbemerkt. Einer der ersten und größten Fans des Afrobeat war der ehemalige Cream– und Blind Faith-Schlagzeuger Ginger Baker. Mit seiner Band Air Force, der auch nigerianische Musiker angehörten, spielte Baker bereits 1970 einen von Afro-Beat beeinflussten Crossover-Sound. Ein Jahr später trommelte der nach Nigeria übersiedelte Schlagzeuger dann mit den Musikern der Kalakuta Republic.
In Nigeria gab es zu dieser Zeit eine regelrechte Band-Explosion, denn nach dem Ende des Biafra-Krieges war 1970 eine neue Normalität eingekehrt. Jugendliche aus Lagos verbanden den Sound verzerrter Gitarren, den sie auf den Platten von Led Zeppelin oder den Rolling Stones gehört hatten, mit den schweren Trommel-Rhythmen ihrer Heimat. Neben dem populären, großorchestralen Afro-Beat entstanden auch neue Formen von Highlife. Blues und Psychedelia, wie sich auf den empfehlenswerten Compilations des „Soundway“-Labels nachhören lässt.
In den Achtzigern gaben David Byrne und Brian Eno dem afrikanischen Funk eine neue, postmoderne Wendung, als sie auf dem Album „My Life In The Bush Of Ghosts“ die treibenden Rhythmen mit den Stimmen von Radiomoderatoren und Predigern mischten – von der politisch motivierten Musik Fela Kutis war dieses Album natürlich ebenso weit entfernt wie „Remain In Light“ von den Talking Heads. Seit dem Tod des „Black President“ – der im August 1997 an Aids starb – tragen Weggefährten wie der Schlagzeuger Tony Allen und Sohn Femi Kuti die Fackel weiter. Auch „Soul Explosion“, das Debüt der New Yorker Band The Daktaris, wirkte 1998 wie ein vergessener Schatz aus dem Nigeria der Siebziger – obwohl viele der Musiker weiße Haut hatten. Noch im selben Jahr gründeten einige Mitglieder der Daktaris das Antibales Afrobeat Orchestra, dessen jüngstes Album „Security“ im letzten Jahr von John McEntire produziert wurde. Und auf „Antidotes“, dem gefeierten Debüt der Foals. sind Antibales auch zu hören. Die Sehnsucht nach diesem archaischen und doch so komplexen Sound wird niemals sterben.