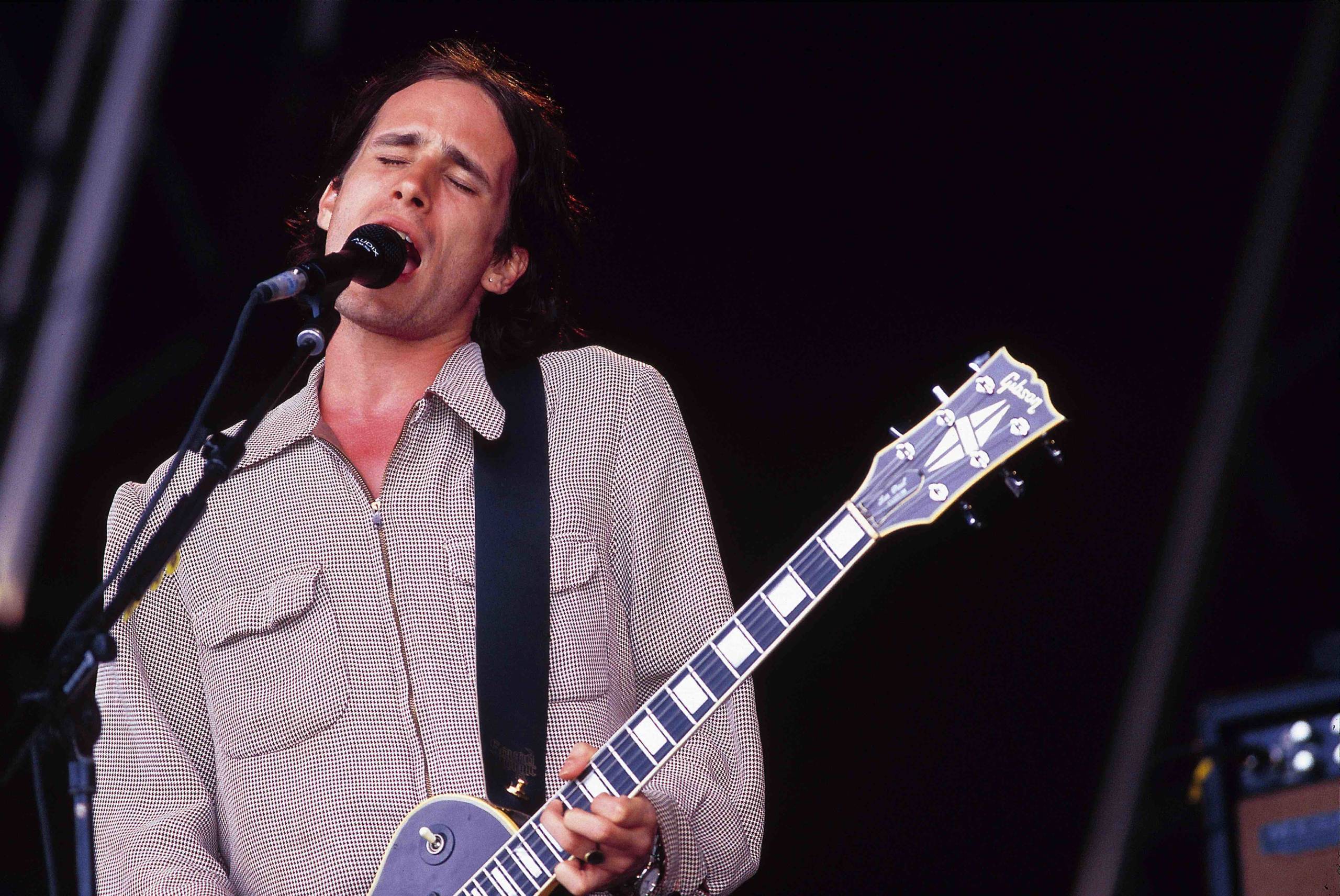Alle Tassen im Schrank?
Ohne das Leitmedium der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wären Rock und Pop nicht das, was sie sind. Das Visuelle war von Anfang an integraler Teil des bestimmenden Kulturphänomens der Nachkriegszeit - und transportierte sich aufs Wirkungsvollste übers Fernsehen. Mit einer Kraft, die sogar Frank Zander und dem Schimpansen von Otto Waalkes trotzte.

Meine erste bewusste Erinnerung an Rock im Fernsehen. Ein diffuses Bild, verschwommen abgespeichert ohne Zeitvermerk: Ein verschwitzter Mann mit nacktem Oberkörper und verklebten langen Haaren, der in ein Mikrophon kräht. Amelodisches Getöse in fremden Klangfarben. Alles ist in rotes Licht getaucht und sieht irgendwie blutüberströmt und sehr hysterisch au… KLICK. Dann wurde natürlich umgeschaltet. Bei uns zu Hause hatte – wie ja wohl in 95 Prozent aller westlichen Haushalte – der Vater die Umschalthoheit über die große, holzfurnierte Telefunken-Kiste im Wohnzimmer. Und weil dies die späten 70er Jahre waren und nur mein technikverspielter Onkel Toni, der Bundeskanzler und Leute in amerikanischen Filmen ein TV-Gerät mit Fernbedienung besaßen, musste sich Pa für jede neue Amtshandlung von seinem Kanapeeplatz erheben, zweieinhalb Schritte zum Gerät hoppeln und einen Knopf drücken, der tatsächlich KLICK machte. Und war dann nach einem länglichen Tag erst auf der Baustelle und dann noch auf dem Feld nicht geneigt, sich allzu ausführlich dem amelodischen Krähen blutüberströmter, halbnackter Männer zu widmen, schon gar nicht auf einem Bein zwischen Kanapee und Fernseher. Ein paar Sekunden Skepsis, erfassen was da abging, ein schnaubendes Geräusch wie von innerem Kopfschütteln – KLICK. Mein Vater war ein großer Musikfreund, aber nicht wirklich Rock-sozialisiert. Ein bisschen Beat und Pop als Teenager in den 60ern, etwas von dem wenigen, das man damals in dem bayerischen Dorf kriegte, hatte er mitgenommen. Dem Phänomen halbnackt schweißverklebter, in amelodische Hysterie getauchter Krähmänner und mit ihm dem überwiegenden Rest dessen, was „Rock“ war und werden sollte, stand er aber jetzt, mit Anfang 30, etwa so ratlos gegenüber wie unsereins später, sagen wir, dem Treiben der amerikanischen Pro-Wrestler: Was soll das? Wer zieht sich das rein? Und – ganz ohne Zorn und Eifer gefragt: Können die ernsthaft alle Tassen im Schrank haben?
Ich weiß bis heute nicht und werde es auch nicht mehr erfahren, was für ein Sänger welcher Band dieser verschwitzte Mann war (ich würde auf etwas aus der Ecke New Wave Of British Heavy Metal tippen) und im Rahmen welcher Sendung auf welchem der sagenhaften fünf Programme, die uns zur Verfügung standen (zwei mehr als fast überall sonst in der Republik, weil wir noch „den Österreicher“ mit rein bekamen) wir an ihm vorbeigezappt hatten. Vielleicht gibt es diesen speziellen Sänger auch gar nicht und sein verschwommenes Bild und die wilden Geräusche, die es unterlegten, sind nur eine Chimäre, ein Komposit aus verschiedenen frühen televisionären Kurzbegegnungen mit dem Rock’n’Roll – und es waren mangels rockendem großem Bruder oder ähnlichem „„Umfeld“ in der Tat meine ersten solchen Begegnungen überhaupt -, die sich zu diesem Bild wie aus einem wiederkehrenden Traum verdichteten. Ein Bild, das mir in seiner Rätselhaftigkeit und Bedrohlichkeit eher Grusel einjagte als mich zu entflammen. Es sollte noch ein wenig dauern, bis ich begriff, dass sich das mit dem Rätsel und der Bedrohung und dem nicht jederzeit sämtliche Tassen im Schrank Haben so gehört im Rock und im Pop. Unter anderem.
Der Rock’n’Roll und der Pop, wie wir sie kennen, und das Fernsehen als Massen- und Leitmedium sind in etwa gleich alt. Und ja, ich würde auch sagen: Das kann kein Zufall sein. Noch 1946 besaßen gerade mal ein halbes Prozent der amerikanischen Haushalte einen Fernseher, 1954 waren es bereits knapp 56 Prozent. Als Elvis Presley am 9. September 1956 zum ersten Mal in der Ed Sullivan Show – einer Variete-Show mit Schwerpunkt Musik, ein Jahr zuvor waren schon Bill Haley Et The Comets da gewesen mit ihrem Rock’n’Roll-Urhit „„Rock Around The Clock“ – auftrat, saßen 60 Millionen Amerikaner vor ihren Fernsehern, das größte bis dahin dagewesene Fernsehpublikum. Und ein paar von denen saßen da sicher einzig und allein aus dem Grund, weil sie das Songwriting einfach süperb fanden und die Lieder hören wollten. Die restlichen 99,99 Prozent aber wohl zuvörderst, weil sie zu diesen Liedern diesen Kerl sehen wollten, dem sie entweder schon seit seinen vorangegangenen Auftritten etwa in der Steve Allen-Show verfallen waren oder von dem sie gehört hatten. Wollten sehen, wie er aufs Skandalöseste seine Hüften herumwarf – ob nun, um sich daran oder um sich darüber zu erregen. Rock’n’Roll, Pop war von Anfang an nicht mehr einfach nur Musik. Dem Schauwert eines Acts, der sich mit dem neuen Medium plötzlich direkt vermitteln und gaaanz nah an die Leute respektive Kunden heran transportieren ließ, kam mit einem Mal ein völlig neuer Stellenwert zu. Das junge Medium und die junge Musik kamen sich näher, blickten sich tief in die Augen, es funkte – bumm: Synergieeffekt.
„People will look at anything“, wusste Andy Warhol. Die Leute wollen schauen, gucken. Halt denen was hin, und sie glotzen drauf, so wie Hunde eben überall mit der Nase dran müssen, um zu begreifen, was da genau los ist. Der Mensch ist ein Augentier, immer und nur allzu gern zu haben für visuelle Reize. Und nun war da diese neue Musik, die wie keine zuvor ihre Protagonisten und Performer und deren Aussehen, Gebaren und Inszenierung zum integralen Bestandteil machte, aurale und visuelle Komponenten quasi in Wirkungseinheit verknüpfte. Und da war das Medium, das all dies erst möglich machte und katalysierte, ja: den Boden für die Welteroberung bereitete. Diese Revolution wurde tatsächlich im Fernsehen übertragen. So viele Livekonzerte hätte Elvis in einer Lebenszeit nicht geben können, um nur annähernd den meteoriteneinschlagsgleichen Effekt zu erzielen wie sein heißes, „schockierendes“, bei Fan wie Feind Phantastereien von Unzucht und Anarchie evozierendes Tänzchen zu „„Hound Dog“ im Sonntagabendprogramm. Und wie glorreich wäre wohl die British Invasion verlaufen, wenn die Beatles im Februar 1964 ihre Antrittsvorstellung in den USA mit einem Auftritt bei einem Radiosender absolviert hätten und nicht bei – wiederum – Ed Sullivan? 73 Millionen saßen an den Fernsehern und ziemlich sehr viele davon waren ganz aus dem Häuschen darüber, wie grandios der Charme und die Coolness und die Knuffigkeit dieser vier jungen Männer – Gott, waren die süß! – aus Old Europe mit ihrer Musik zusammenging. Am nächsten Tag hatten sich die USA eine ausgewachsene Beatlemania eingefangen. Change we can believe in.
In der deutschen Provinz dauerte das natürlich alles etwas länger. Meine Mutter schaffte es trotzdem, Beatles-Fan zu werden, war als solcher freilich alles andere als verwöhnt. Zusammen mit Schwester und Bruder besaß sie ein paar Beatles-Singles, jedoch keinen Plattenspieler – die Platten wurden zu Freunden getragen, bei denen so was im Wohnzimmer stand. Allerdings schafften ihre Eltern 1963 einen Fernseher an, nachdem man bis dahin für einen Blick in die weite Welt zum technisch avancierten Nachbarn hinübergepilgert war. Die Rock’n’Roll-Revolution kam deswegen aber noch lange nicht ins Haus: Eine eigene Plattform für Popmusik gab es bis Mitte der 60er überhaupt nicht im deutschen Fernsehen, und wenn mal irgendwie, irgendwo ein Pilzkopf durchs Bild lief, schallten Alarmrufe und die Teenager des halben Dorfes liefen zusammen – da hatte aber meist schon wieder ein sorgfältig gescheitelter Sprecher seine Moderation fortgesetzt. Im Herbst 1965 dann eröffnete bei Radio Bremen der „„Beat-Club“, die erste Musiksendung im deutschen Fernsehen, die für junge Leute konzipiert worden war. Was für ein Vögelchen den ARD-Gewaltigen da wohl was von Marktanalyse und demographischen Zahlen gezwitschert hatte? Endlich konnten vom grassierenden Beatfieber angewehte deutsche Teenager alle vier Wochen am Samstagnachmittag lebende, atmende, Frisuren schüttelnde Rocktypen und Beatfetzen auf der Mattscheibe bewundern. Mein Großvater aber fand – wie weite Teile der irritierten Elterngeneration, die die Machtübernahme der Hottentotten für besiegelt halten musste – das alles nicht hinreichend erheblich und vorenthielt Mike Leckebusch und Uschi Nerke weite Teile ihrer potenziellen Zuschauerschaft in der Bergstraße, Freutsmoos, Obb.
Das Fernsehen ist ja – wie alle aufregenden Dinge – unter anderem auch erfunden worden, damit man mehr verpassen kann im Leben. Ein paar großartige, „kultige“, seltsame und bescheuerte Musiksendungen, die ich weitgehend nie gesehen habe:
1. „Musikladen“. Folgte nach der Schließung des „Beat Club“ 1972 und wurde weiterhin moderiert wn Uschi Nerke sowie Manfred „Sexy“ Sexauer. An dessen Starsky-&-Hutch-Haarhelm und aufgeknöpftes Hemd erinnere ich mich zumindest aus Wiederholungen im Nachtprogramm in den 9Oern. Musikalische Gäste schienen immer nur Showaddywaddy und Sailor gewesen zu sein, aber vielleicht habe ich nicht gut genug aufgepasst.
2. „„disco“. Jahrzehntelang kannte ich’s nur vom Hörensagen. Der spinnenbeinige llja Richter, „„Licht aus, Spot an“, etc. Voll Kult eben. Seit YouTube ahne ich, was bzw. wer meine ein paar Jahre älteren Kollegen traumatisiert haben muss, die bis heute sehr allergisch auf die Kombination Humor + Musik reagieren.
3. „„Vorsicht, Musik“. Fragen Sie nicht. Ich habe noch nie von dieser Sendung gehört, geschweige denn sie gesehen. Ich lese nur eben auf Wikipedia, sie sei von 1982 bis ’84 von Frank Zander moderiert worden, Zitat: „„Co-Moderator war ein Hund namens Herr Feldmann (mit der Stimme von Hugo Egon Balder), der frech und vorlaut war und Zander regelmäßig ins Wort fiel“. Es drängt sich der Gedanke auf, die beim ZDF hatten da irgendwie was falsch verstanden.
4. „„Bananas“ Es gab da offenbar eine Zeit in den frühen 80ern, als es öffentlich-rechtlichen Fernsehmachern undenkbar schien, Popmusik aufzutischen, ohne – zur Sicherheit? – puppenlustige Sketches mit Frank Zander beizupacken. Man kann aus heutiger Sicht nur noch mutmaßen, welche Bedenken dem zugrunde lagen.
5. „„Rockpalast“. Die selben Kollegen, die von llja Richter und Frank Zander traumatisiert wurden, erzählen von Zusammenrottungen in elterlichen Wohnzimmern und nächtelangen „Rocknächten“ mit Liveübertragungen aus der Essener Grugahalle. Wie jener im März 1981, die bis in die Morgenstunden ging, weil die Grateful Dead vor lauter LSD nicht mehr aufhören konnten zu spielen, während man selber, zurückgeworfen auf Berentzen und Bier, in den Seilen hing. Ich bin länger, als mir lieb ist, aus dem Alter raus, in dem man solche Eskapaden super finden dürfte. Trotzdem bin ich rückwirkend neidisch. Da scheint ein Bedürfnis ungestillt geblieben zu sein. Der Rock als identitätstiftendes Gemeinschaftserlebnis und das Fernsehen, das moderne Lagerfeuer, um das sich abends die Sippe sammelt: Eine Kombination made in heaven, eigentlich. Und praktisch. Es konnten ja schließlich nicht alle her und nach Essen fahren.
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Es gab ja mal Zeiten, da mussten die Leute, wenn sie ein Remmidemmi mitkriegen wollten, zu dem Remmidemmi hinfahren. Mein Cousin Florian und ich hatten Ende der 80er weder die finanziellen noch die logistischen Möglichkeiten, zu einem Konzert der uns faszinierenden Band Pink Floyd zu fahren. Wir hatten uns da in eine Fanschaft gewissermaßen hineingesteigert: Die musste man offenbar gesehen haben. Wie dankbar waren wir, als es hieß, das Konzert in Venedig würde vom ZDF live übertragen (ohne Anmoderation von Frank Zander!). Die Verheißung des Fernsehens würde eindrucksvoll eingelöst zu werden: Wir würden dabei sein, zumindest irgendwie, nach Kräften. Die dramatischen Beschränkungen des Mediums – hier in Gestalt einer Bildregie, die nicht unsere Prioritäten teilte – wurden uns bewusst, als wir in naiver Erwartung der Vollverflashung durch die grandiose Lightshow, von der wir so viel gelesen hatten, dann gefühlt viertelstundenlange Nahaufnahmen von dem solierenden David Gilmour – Zoom auf die rote Stratocaster! – erdulden mussten.
Das abgefilmte Konzert ist ja längst ein eigenes, galoppierend inflationiertes TV-Genre mitnurmehrzweifelhaftem Magie-Faktor. Heute stauen sich Mengen von Livekonserven bei den Sendern an – die könnten noch jahrelang weitersenden, wenn ab morgen keine Konzerte mehr stattfinden würden. Schätzungsweise jeder zweite Rockgig im Raum Köln wird irgendwann irgendwie vom WDR versendet. Die TV-Auswertung des „„Rock-Am-Ring“-Festivals, die heute einen Gutteil des „Rockpalast-Programmes ausmacht, zieht sich in der Zeit nach dem Festival im Spätprogramm hin und hin und hin, und noch mal The Offspring und Killswitch Engage um drei Uhr früh, und falls dann immer noch jemand nicht im Koma liegt, noch die Söhne Mannheims hinterher – bis die Leute schon wieder die Kofferräume fürs nächste Festival-Wochenende vollpacken, um vor Ort drei Tage lang gewissermaßen das Saalpublikum für die Konzertmitschnitte des nächsten Jahrgangs zu geben.
Wir wollten seit Mitte der 80er vom Fernsehen in Sachen Popmusik vor allem eins: Musikvideos sehen. Dass die Bebilderung von Songs mittels origineller Kurzfilme, die sinnfälligste Zusammenführung von Musik und der Zeigequalitäten des Fernsehens war und ein Feld aufmachte, auf dem die Kreativität Purzelbäume schlagen konnte und oft genug famose Kunst entstand, war uns so eher egal. Wir wollten halt einfach Musikvideos sehen. Während Klassenkameraden im zehn Kilometer entfernten Trostberg, das Kabel-TV-Projektstadt war, längst Tele 5 – in seiner ersten Inkarnation Ende der 80er ein Gipsender – glotzten, versorgten wir uns mühsam wie die Eichhörnchen mit dem begehrten Gut Musikvideo: Die heute als Mütterchen aller Clipsendungen hierzulande gepriesene „Formel Eins“ gab’s nur einmal die Woche. Die Reize des herben Rockerbraut-Charmes von Stefanie Tücking blieben uns weitgehend verschlossen, die Zeichentricktöle Teasy nervte. Aber die Show stimulierte schon von der ganzen lärmigen Aufmachung her die Wahrnehmung, dass hier was poppte und rockte – wir ahnten, dass wir auf dem richtigen Weg waren, wenn mein Vater, der am Montagabend nun seine Umschalthoheit vorübergehend abtrat, wieder mal ein ebenso mitleidiges wie mitleidheischendes „„Sag, müssen wir das wirklich anschauen?“ hören ließ. Die Quellen waren karg. Im ORF präsentierte der U-Musik-Schnurrbart Peter Rapp in der Sendung „„Wurlitzer“ diverseste Zuschauer-Wunschvideos, und da fiel zwischen „Patrona Bavariae“ und Franz Klammers Olympiasieg 1976 auch mal ein Krümelchen für uns ab (fragen Sie mich übrigens nicht, WAS das eigentlich für Musik war, die uns damals gefiel. Ich müsste mich auf Erinnerungslücken berufen, wie ein dahergelaufener Skandalpolitiker). Und dann war da noch der vermaledeite Schimpanse Ronny, der offenbar genügsamer war als Frank Zander und deshalb jetzt beim ZDF in „Ronny’s Popshow“ Videoclips präsentierte – eine dreiviertel Stunde im Monat, mit der Stimme und dem Musikgeschmack von Otto Waalkes. Auch nicht so richtig der Hit.
Und eines Tages im Jahr 1990 begab es sich: Da schraubte mein Vater eine Satellitenschüssel auf unser Dach, und von einem Tag auf den anderen war ich mit meinen Schwestern ins „MTV-Zeitalter“ katapultiert. Mit dem Personal der ersten Stunde von MTV Europe – Leuten wie Pip Dann, Ray Cokes, Paul King, Steve Blame und the real rockerbraut Vanessa Warwick, wer kennt die Namen noch? – ging’s jetzt oft bis tief in die Nächte hinein. Immer noch ein Clip mehr, den nächsten warten wir noch ab … bis um halb vier die Augen zufielen. Und es hätte sich an diesem so einfachen wie knackigen Angebot – Fernseher an: Musik – für meine Begriffe nie mehr etwas zu ändern brauchen. Allein, der Markt wollte es offenbar so, dass der goldene Teil des MTV-Zeitalters auch bald schon wieder dem Ende zuging. Erst kam die Diversifikation der Clipsender – Viva, Viva Zwei, VH-1, MTV, MTV 2, Viva Plus, bla – dann die langsame Implosion des „Segments“. So viel ist gejammert worden in den letzten Jahren vom Niedergang des Musikfernsehens und dass es
kaum noch M gibt im MTV. So viel, dass man sich vorkommt wie Opa, der lamentiert, früher sei die Milch fetter gewesen. Ich hab’s trotzdem einfach nie verstanden: „„Euro Sport“ zeigt doch auch immer noch Fußball, Skirennen und Kugelstoßen und keine Ekel-Spielshows und „„Reality“-„Formate“, in denen eingeölte Springbreak-Typen mit Paris-Hilton-Lookalikes verkuppelt werden. Oder doch?
Vielleicht schau ich zu wenig fern. Spätestens seit dem erzwungenen Ende von Charlotte Roches „Fast Forward“ ist mein Verhältnis zum Musikfernsehen endgültig zerrüttet. Und Pop/Rockmusik suppt und soßt heute ohnehin, gleichsam vom Feind vereinnahmt, durch sämtliche Ritzen und Niederungen der großen Quatschlandschaft TV, als Universal-Anstrich für alle Fälle und Unfälle. Wenn Oliver Geissen irgendwann in der „Ultimativen Chartshow“ auf RTL die „„15 mysteriösesten Hardrock-Performances aller Zeiten!“ präsentiert und meinen halbnackten Phantomshouter aus den 70ern aus dem Hut zieht, dann schließt sich wenigstens der Kreis hier. Allein: Ich werde nicht dabei sein. Weil ich mir meine Kicks in Sachen Popglotzen längst bei Youtube hole. Wenn das okay ist.