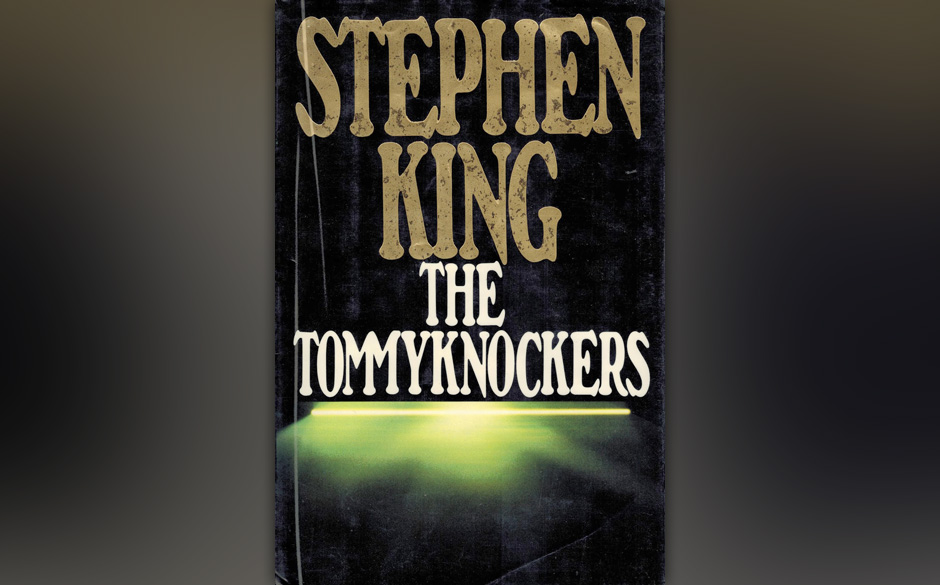Jochen Distelmeyer :: Otis
Homer revisited: Die literarische Ambition des Blumfeld-Sängers ist bereits bei seinem Debüt hoch – aber als Erzähler verläuft er sich in Berlin-Mitte
Ein Roman von Jochen Distelmeyer. Den hat man kommen sehen. Spätestens nach dem Ende seiner Band Blumfeld 2007 rechneten alle damit. Dabei ist er ja – im Gegensatz etwa zum herrlichen Schwadroneur Sven Regener – bisher weder in seinen Liedern noch in seinen Interviews als großer Erzähler in Erscheinung getreten. Umso erstaunlicher, dass er sich für „Otis“ den ersten und immer noch größten aller Sänger, Songwriter (im weitesten Sinn) und Storyteller der Geschichte zum Vorbild genommen hat: Homer, den alten Griechen, genauer gesagt dessen „Odyssee“; die Irrfahrten des Bürgersohns Odysseus, der sich erzählend selbst zum archaischen Helden stilisiert.
„Otis“ folgt den Spuren des mittelalten Junggesellen Tristan Funke – ein Name wie von Martin Walsers Gnaden, davon gibt es einige hier: Ole Seelmann, Carola Frohgemut … Tristan wurde vor drei Jahren von seiner Freundin Saskia verlassen, hat daraufhin seinen Job in der Personalabteilung eines Hamburger Verlags gekündigt und ist nach Berlin geflohen. Hier, in der Stadt, in die, wie es bei Blumfeld heißt, die Leute aus Heimweh ziehen, will er einen Roman schreiben: eine aktualisierte Form von Homers „Odyssee“ (und somit natürlich auch von James Joyce’ „Ulysses“). Es geht um den drogen- und tablettensüchtigen Programmierer Otis Weber, der die illegale Filesharing-Plattform Megamovie betrieb und – Frau und Kind zurücklassend – auf eine Mittelmeerinsel flüchtete, als man ihm auf die Schliche kam.
Alles, was hier erlebt wird, findet eine Entsprechung in Homers „Odyssee“
Dieser Otis – benannt nach einer List des Odysseus, der sich gegenüber dem ihn gefangen haltenden riesenhaften Zyklopen Polyphemus als „Outis“, Griechisch für „Niemand“, ausgegeben hatte – dient Tristan Funke jedoch nur als Vorwand, um über seine eigene Irrfahrt nach dem Ende seiner zehn Jahre währenden Beziehung zu reflektieren. Lange Zeit identifiziert er sich mit dem auf dem Weg nach Hause in schicksalhafte Fahrwasser geratenen Odysseus, der ja – auch wenn er im Innersten immer an die bürgerliche Familie glaubte – doch ein rechter Schwerenöter war, besessen von den Frauen (und sie von ihm), von Bett zu Bett hüpfte und die ganzen Seeungeheuer, komischen Völker und tobenden Götter vermutlich nur erfand, um eine Ausrede zu haben fürs lange Fortbleiben.
Auch Tristan hat die eine oder andere Liebelei und glaubt doch recht bürgerlich an die eine große Liebe. Für alles, was er erlebt, findet er eine Entsprechung in Homers Epos – all die Begegnungen und Affären erscheinen ihm wie Nymphen, Zauberinnen und Götterboten, und auch die Weltgeschichte fügt sich in den narrativen Rahmen der „Ilias“ und der „Odyssee“: die Wulff-Affäre, die Femen, die in der Hauptstadt zur Schau gestellte Erinnerungskultur, die die Vergangenheit in Mahnmale einsperrt, um in der Gegenwart guten Gewissens wieder Militäreinsätze führen zu können – und in den Dartspielern im Sportfernsehen erkennt er die antiken Speerwerfer, die ihren Kriegshunger im Spiel sublimieren.
„Otis“ spielt an wenigen Tagen im Februar 2012. Tristan trifft seinen Onkel Cornelius Wegener, der ihm hilft, während des Buchprojekts finanziell über die Runden zu kommen, und mit seiner Tochter auf Berlinbesuch ist. Doch der erfolgreiche Anwalt muss bald berufsbedingt abreisen und bittet seinen Neffen, sich derweil ein wenig um das junge Goth-Mädchen zu kümmern und mit ihr ins Theater zu gehen. Tristan stimmt schuldbewusst zu, obwohl er sich eigentlich vorgenommen hatte, in Ruhe an seinem Roman zu arbeiten; zudem steht die Abschiedsparty seines besten Freundes, Ole, an, eines Musikers, der mit seiner Frau, der Künstlerin Ellen, und den Kindern nach Ashburn/Virginia zieht.
Die Figuren sind aus Stereotypen zusammengesetzte Pappkameraden
Ein Erzähler wird aus Distelmeyer bei der Schilderung dieser eher schlichten Handlung allerdings nicht. Die Sprache changiert zwischen Phrasen, Klischees und fast schon komischen poetischen Überhöhungen: „Alle nahmen sie teil an den komplexen Segnungen und Gewissheiten der Metropole, die sich bereitgemacht hatte, auch an diesem Tag die ganze Pracht ihrer Errungenschaften zu entfalten.“ Die szenischen Einschübe zwischen den zahlreichen mythologischen, historischen, politischen, biografischen und, ja, zoologischen Abschweifungen sind oft blutleer und flach (auf einen Exkurs über den Hades folgt etwa ein Gang in den Keller), die Dialoge mitunter bemüht, die Monologe steif, die Verschwörungstheorien humorlos, die Deutungen fad und die Figuren aus Stereotypen zusammengesetzte Pappkameraden wie etwa der türkischstämmige, in Kreuzberg aufgewachsene Busfahrer Yilmaz Özcan, der sich auf der Love Parade in die Tochter eines türkischen Grillrestaurantfilialbetreibers aus Neukölln verliebt, weil sie ihn an eine Prinzessin aus „Tausendundeine Nacht“ (!) erinnert, oder die schöne Nora Thränhardt, eine jener Frauen, so glaubt Tristan, „die sich, ihrer Attraktivität überdrüssig, nach nichts mehr sehnen als danach, ihrer Persönlichkeit wegen und nicht bloß für ihr Äußeres geliebt zu werden“. Alle „schönen und geistreichen Frauen“, erfahren wir übrigens anderswo, „sind von eher unsicherem Naturell“. Aha.
Nehmen wir mal an, all das hat Methode und Distelmeyer, ein intelligenter und belesener Mann, hat dieses papierne Berlin aufgebaut, um unseren sprachlichen und gesellschaftlichen Strukturen den Spiegel vorzuhalten, er hat die Geschichte dieses old nobody Tristan Funke entworfen, um mittels literarischen Crossmappings zwischen Antike und Gegenwart einige Deutschland, die Hauptstadt und die Kunst betreffende Diskurse zu triggern: Dann wäre „Otis“ die in jedem Sinn prosaische Fortsetzung seiner Lieder. Die Magie steckt also wohl doch in den Akkorden.