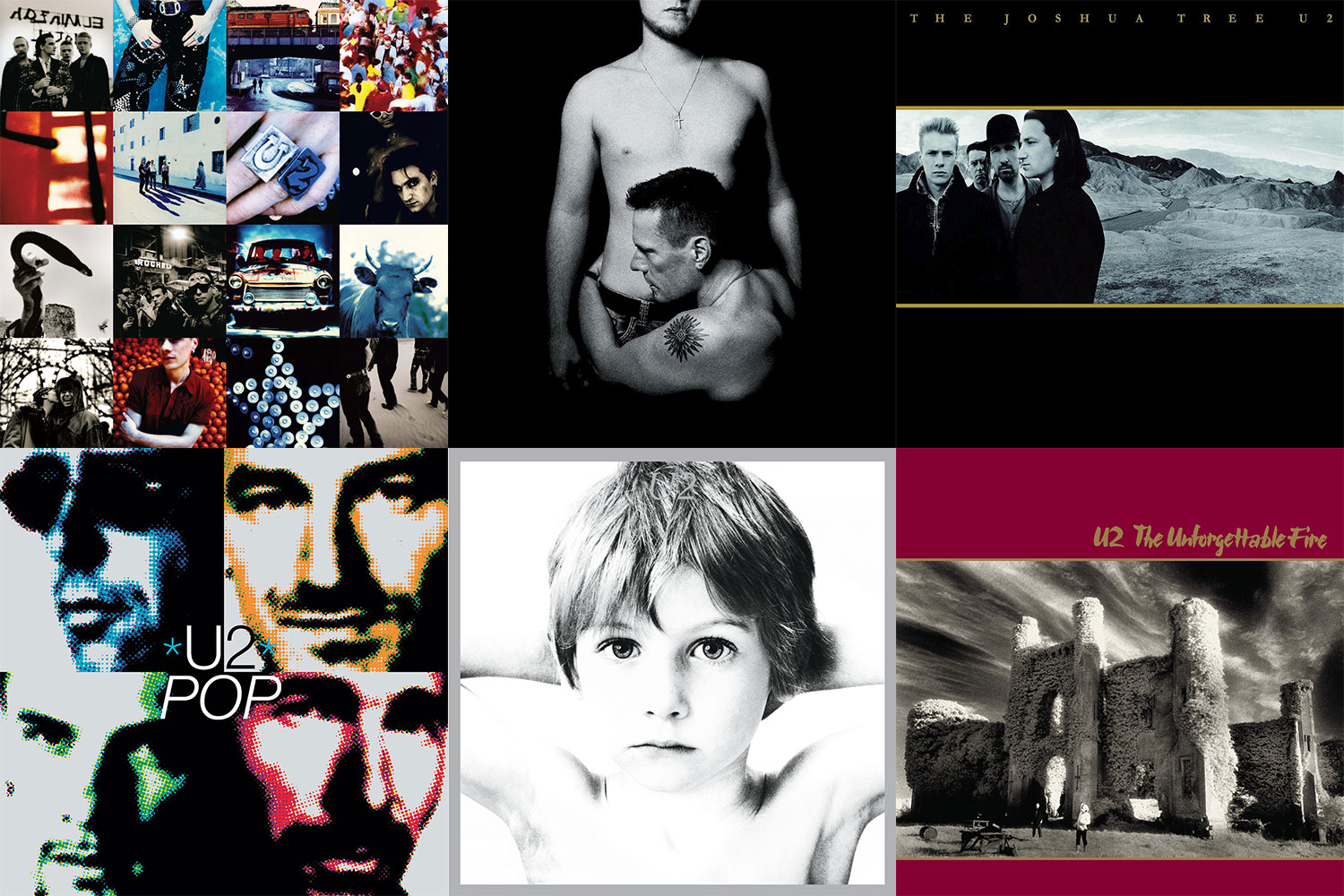Elvis Perkins
„In Dearland“
Leicht hat Elvis Perkins es nie gehabt. Dass er bei einem ehemaligen Bassisten von The Knack das Gitarrespielen lernen musste, war wohl noch das kleinste Übel. Er hatte einen berühmten Vater- Anthony – der viel zu früh an AIDS starb, seine Mutter kam bei den Anschlägen vom 11. September 2001 ums Leben.
All die privaten Tragödien flossen ein in sein Debüt „Ash Wednesday“, das klingen sollte wie „Astral Weeks“ von Van Morrison, doch Perkins bekam nur den Schlagzeuger von „Moondance“. Hat dem Album jedoch nicht geschadet, es wurde zu Recht gelobt, die Songs tauchten in Soundtracks auf, und Perkins war als vielleicht größter Trauerkloß der amerikanischen Musik seit Paul Simon etabliert.
Sein zweites Album eröffnet Perkins jedoch dylanesk, mit Mundharmonika und „John Wesley Harding“-Beat. Dazu zapft er den guten alten stream of conciuousness an und kehrt er ein Nina Simone-Zitat ins Tragikomische: „Yellow is the color of my true love’s cross bone/ Yellow is the color of the sun/ Black is the color of a strangled rainbow/ Black is the color of my love.“
Die schwebend-ätherische, verjazzte Stimmung des Debüts ist auf „In Dearland“ verflogen. Produzent Chris Shaw ist – das zeigte er unter anderem bei den letzten Bob-Dylan-Alben – ein Meister des spontanen Live-im-Studio-Sounds und inszeniert Perkins‘ Tourband als tighte, aber durchaus verspielte Einheit, die den immer noch arg leidenden und quengelnden Sänger von der einsamen Klause in die Straßen von New Orleans führt.
Da wo auf dem letzten Album noch Elegien erklangen und Lust am Leid herrschte, hört man jetzt beschwingte Beerdigungsmärsche, Blues, Gospel und Folk- an einer Stelle auch eine „Graceland“-Huldigung, die allerdings auf der anderen Seite des Atlantiks, in Dresden, beginnt. „Glory glory, hallelujah“ jubiliert Perkins da. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. (Beggars)
Maik Brüggemeyer