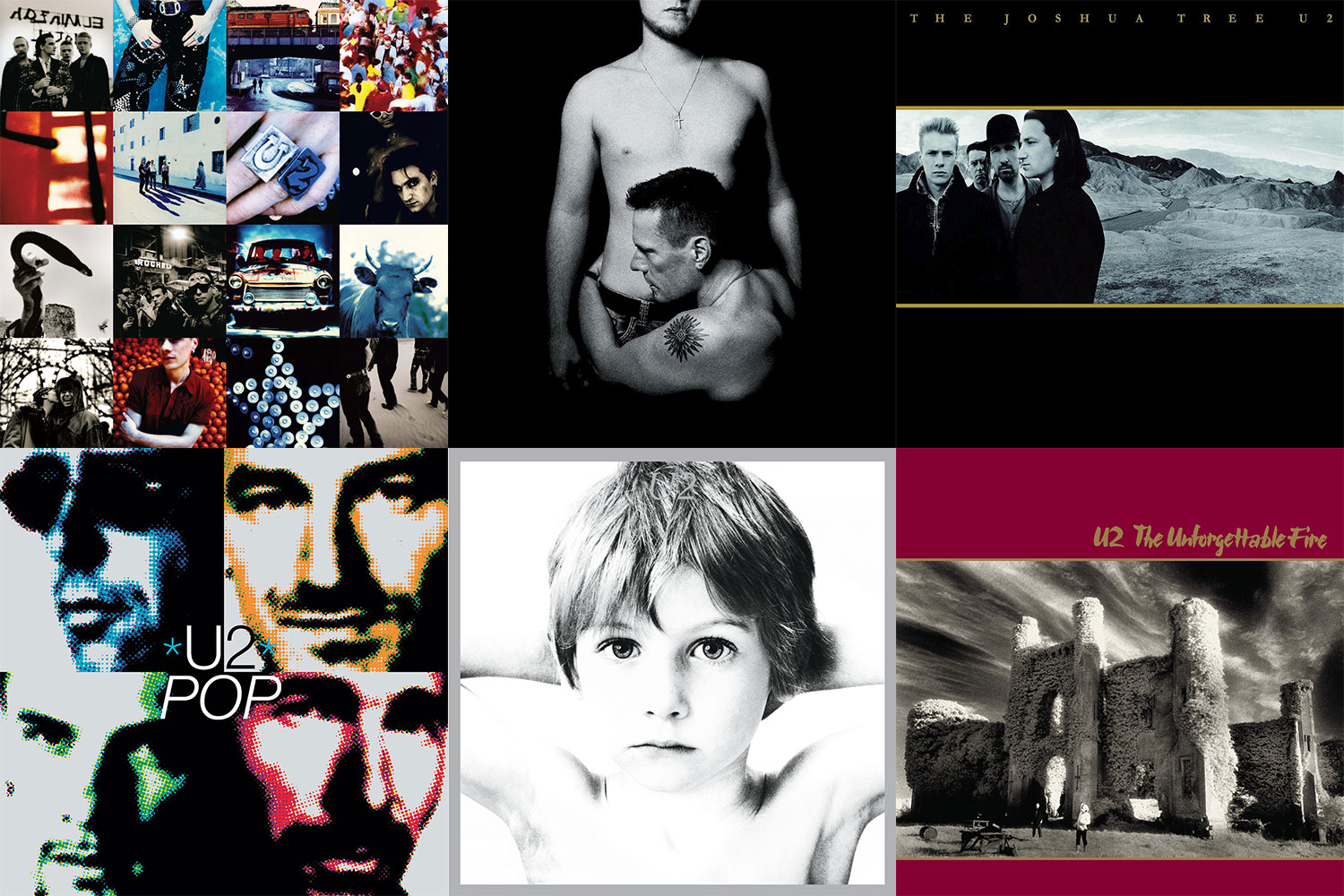Jakob Dylan
Seeing Things
So richtig zu verstehen ist es nicht, warum Jakob Dylan nach fünf Wallflowers-Alben unbedingt allein ins Studio gehen wollte. Es war ja nie so, als drohte die Band ihn unterzubuttern oder als erstickte ihr wuchtiger Sound seine Stimme. Tatsächlich stand der Sänger doch immer im Vordergrund, aus dem einen oder anderen Grund.
Er wollte sich mal ganz auf die Lieder an sich konzentrieren, behauptet Dylan. Nun hat Rick Rubin das Solodebüt produziert, und da ist Kargheit quasi Gesetz. Der „Mangel an Sound“ sollte der Sound des Albums werden. Gesang, Gitarre, ein bisschen Schlagzeug, viel mehr ist auf „Seeing Things“ nicht zu hören. Gleich das erste Stück, „Evil Is Alive And Well“, demonstriert die Vor- und Nachteile dieser Herangehensweise. Dylans Stimme ist unverkennbar, und seine Art, immer ein wenig verschlafen und doch eindringlich zu singen, hat nach all den Jahren nichts von ihrem Reiz verloren. Aber was er so textet, schrammt manchmal doch nicht mehr am Klischee vorbei. Bei „Valley Of The Low Sun“, einer Geschichte von verlorener Jugend und sinnlosem Krieg, bekommt er originellere Metaphern hin, wenngleich das Sujet recht abgegriffen ist. Und, natürlich, wir sind besonders streng mit dem Armen, so sehr wir versuchen, ihn nicht mit seinem Alten zu vergleichen. Andererseits: Warum sollte es Jakob Dylan besser gehen als den meisten Songschreibern? An Bob müssen sie sich ja alle messen lassen.
Das Schicksal des kleinen Mannes ist momentan Jakob Dylans Lieblingsthema. Im lässigen „All Day And All Night“ fährt der emsige Arbeiter Doppelschichten („Bees make honey, I’m making mine/ Good men are busy all the time“), bei „Will It Grow“ sorgt sich ein Farmer um seine Ernte. Es sind hübsche kleine Momentaufnahmen, doch die diffuseren Bilder oder allgemeine philosophische Betrachtungen wie „Everybody Pays As They Go“ (mit einer aparten Sängerin im Hintergrund, die leider im Booklet nicht aufgeführt ist) liegen Dylan besser. Zu „War Is Kind“ schlägt er die Gitarre besonders bestimmt an, und der resignative Gesang passt so perfekt zur trostlosen Lyrik, dass es eine Art hat: „Mother, war is kind/ Of like hell but I am fine…/ Daughter you wear my name/ Those are my eyes keep’em raised/ I may have scars but I give more than I take/ Daughter war is safe/ Where you are, far away.“ Umso erstaunlicher, dass danach „Something Good This Way Comes“ folgt, ein beschwingtes, optimistisches Stück. „Hoffnung und Humor“ wohnen all seinen Songs inne, sagt Dylan, und hier merkt man das auch – genau wie sein Talent für Melodien.
Einmal gehört, bekommt man manche Verse – wie die vom abschließenden „This End Of The Telescope“ – tagelang nicht aus dem Kopf. Mit „It’s feast or famine, you eat what you kill/ There’s no need to bring God into this“ ist das so, und auch mit diesem schönen Zweizeiler: „Lousy lovers do well with their hands/ But I’ll reach you like nobody can.“ Er singt das so entschlossen und ohne den Schatten eines Zweifels, dass man ihm sofort glaubt. Jakob Dylan muss jetzt keinem mehr etwas beweisen, und dieses Album strahlt bei aller Zurückhaltung vor Selbstbewusstsein. Es ist sicher kein Zufall, dass der einstig ständig Grummelnde auf Promotionfotos jetzt auch mal lächelt. Wenn er sich am Ende also selbst zur Disposition stellt („You can have me or leave me alone“), ist klar, welche Wahl zu treffen ist. Bin sicher, die Wallflowers denken genauso.
Birgit Fuß