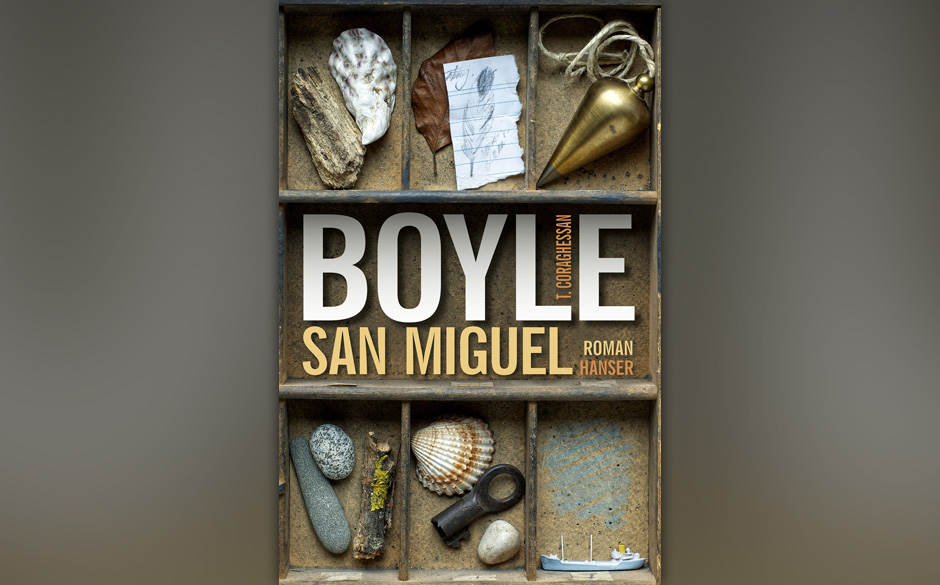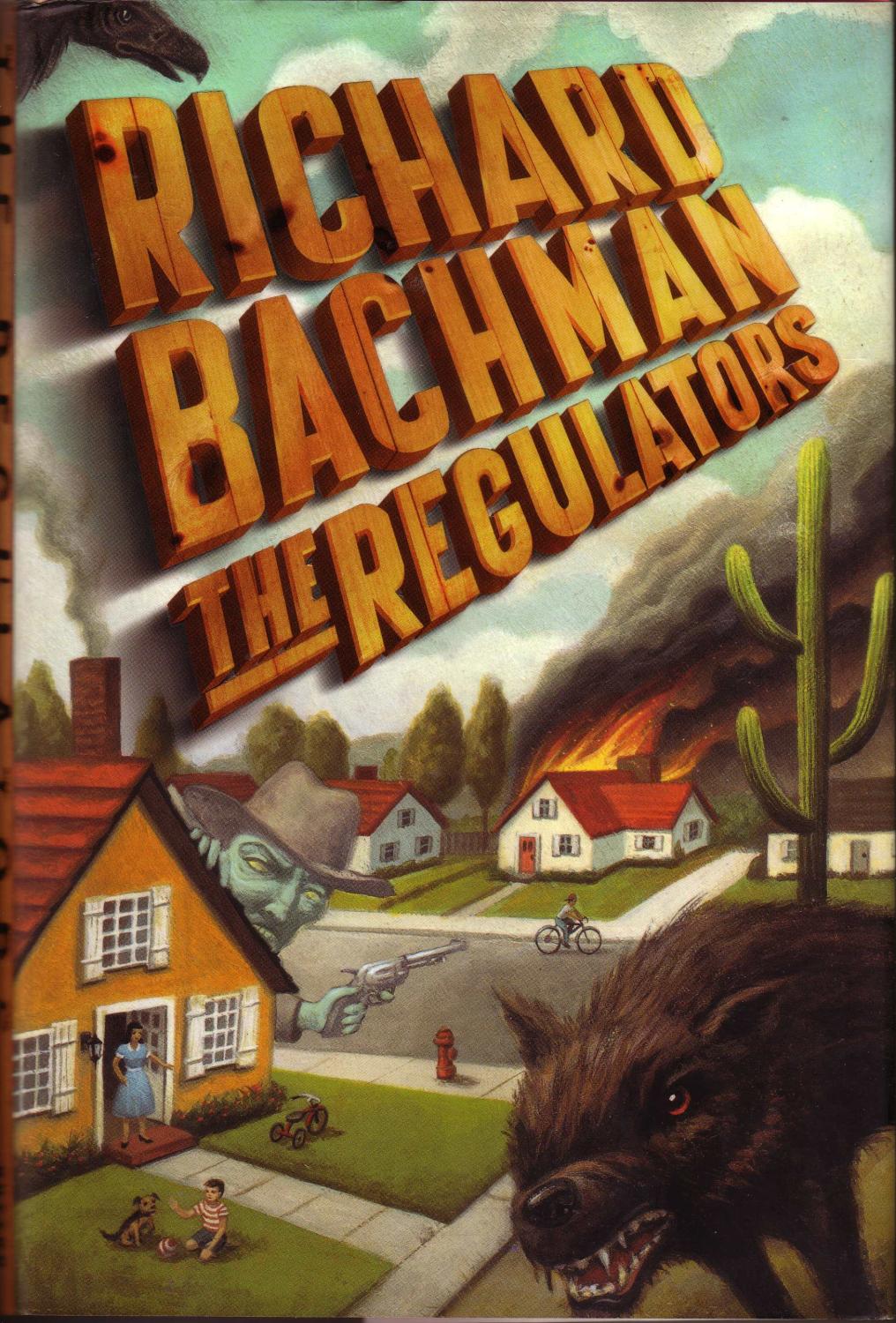T.C. Boyle :: San Miguel
Boyles neuer Roman liest sich wie eine Mischung aus den letzten beiden. Er erzählt seriell die mehr oder weniger ineinander verwobenen Lebensgeschichten dreier Frauen (vgl. „Die Frauen“). Und die Handlung spielt auf einer kleinen unwirtlichen Insel vor Santa Barbara, die selbst zum eigentlichen Akteur avanciert (vgl. „Wenn das Schlachten vorbei ist“). Und das in den letzten neun bis dreizehn Romanen immer wieder durchgearbeitete Thema, der Antagonismus zwischen Natur und menschlicher Kultur, liefert auch hier einmal mehr die Kontroversen, die das Erzählen am Laufen halten. Boyles Narrationsmaschine schnurrt denn auch einmal mehr reibungslos davon. Seine Naturbeschreibungen sind saft- und kraftvoll. Bis in die Nebenfiguren ist die Geschichte mit richtigen dreidimensionalen Menschen besetzt. Geschickt verklammert er die Biografien der drei Frauen aus drei Generationen, die sich auf San Miguel mit unterschiedlichem Erfolg gegen Wind und Wetter und die Zeitläufte behaupten, bis sie alle irgendwann doch wieder die Flucht ergreifen, über Reprisen und Leitmotive (der Flugsand, die Mäuse, der Jähzorn der Kriegsveteranen, die Japaner). Und für die bildungsbürgerliche Leserschaft gibt es auch noch ein paar Anspielungen auf Shakespeare, Emily Brontë, Theodore Dreiser dazu. Alles wie immer also. Aber mittlerweile kennt man das eben allzu gut. Man durchschaut das Erzählschema sofort, dechiffriert jede Vorausdeutung fast schneller, als er sie setzen kann. Boyle kann nicht mehr überraschen. Und so fallen auch die handwerklichen Schwächen stärker auf. Etwa die überdeutlich wertenden Charakterisierungen seines Erzählers. Der selbstherrliche Inselkönig flucht hier wie ein Kesselflicker und stinkt aus dem Mund. Das ist auf dem Niveau eines Hollywood-Blockbusters. HBO-Serien lösen das längst komplexer.