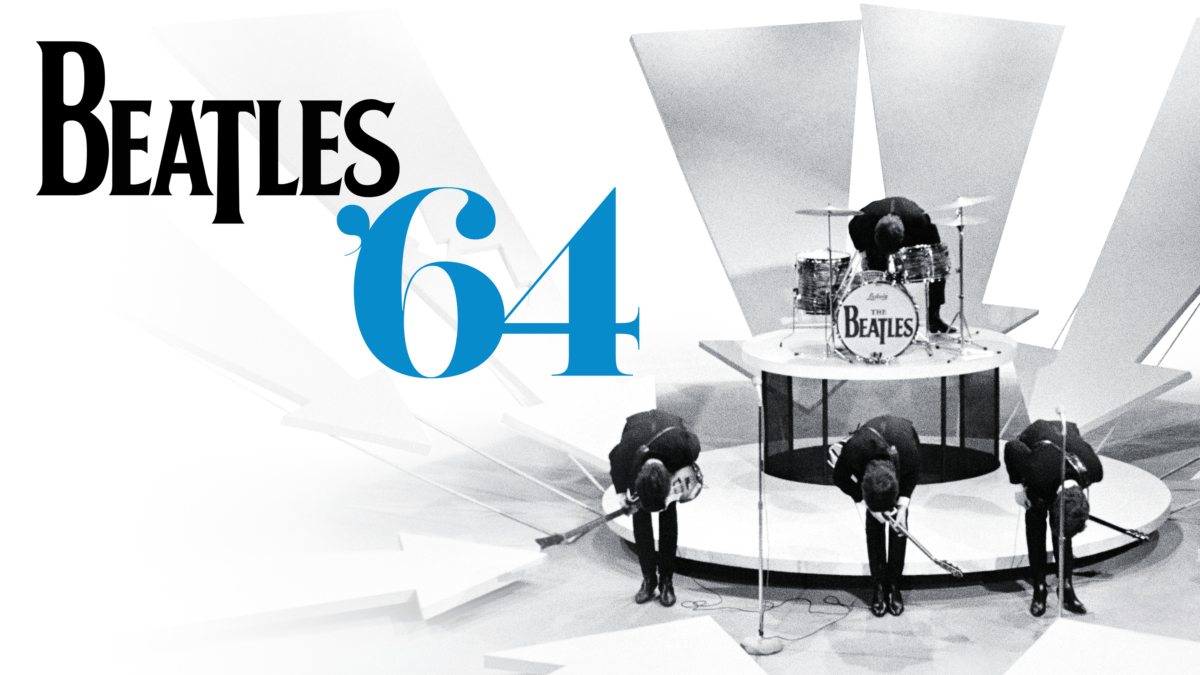John Grant
Pale Green Ghosts
Bella Union/Cooperative
Er ist der stille Verzweifelte, der hochsensible Ich-Erzähler, der Depressionen vertont, sich selbst schonungslos bloßstellt. Einer, der in atmosphärischen Soundlandschaften zwischen Elektro, Folk und Pop herumirrt, weil er sich offenbar noch nirgendwo richtig heimisch gefühlt hat. Wie schon auf „Queen Of Denmark“ versammelt John Grant auf „Pale Green Ghosts“ dunkelgetönte autobiografische Pop-Kostbarkeiten – auch wenn Grants Solodebüt in Texas mit Midlake und der Nachfolger nun in Reykjavik mit Birgir Porarinsson von Gus Gus aufgenommen wurde, mehr nach den 80er-Jahren, elektronisch infizierter und kühler klingt.
Zum stotternden Synthie in „Pale Green Ghosts“ beginnt die Reise in die Dunkelheit. Grant erzählt von sich als einem, der der Kleinstadt entfliehen, die Welt erobern will und die höhnenden Stimmen der Vergangenheit hört („Don’t come crying when you’re forced to learn the truth“). Es ist ein verstörender, mit dissonanten Blechbläsern und in Halbtonschritten abwärts schleifenden Streichern inszenierter Assoziationskosmos, der sich vor einem auftut. Grant mutete einem auf „Pale Green Ghosts“ später mit seiner samtweichen Stimme so viele intime Bekenntnisse über Einsamkeit und verlorene Liebe („You Don’t Have To“), seine Homosexualität („Glacier“) und seinen positiven HIV-Befund („Ernest Borgnine“) zu, das man es kaum ertragen kann. Und die Liebe taugt bestenfalls als Kriegsgebiet: „Your silence is a weapon/ It’s like the nuclear bomb/ It’s like the Agent Orange/ They used to use in Vietnam“, singt er in „Vietnam“, das trotz Burt-Bacharach-Wehmut ein Dokument der Ernüchterung ist.
Zwar flüchtet Grant manchmal auf die Tanzfläche, liefert mit „Sensitive New Age Guy“ und vor allem mit „Blackbelt“ zwei extrovertierte Dancetracks ab. Doch es dauert nie lange, bis er sich wieder in stiller Verbitterung an ein Du wendet, das ihn einst geliebt hat: In „GLC“, das sich musikalisch zurück in die 70er-Jahre bewegt, in „You Don’t Have To“, durch das ein Moog-Synthesizer blubbert, und vor allem in „Why Don’t You Love Me Anymore“, in dem er sich in düster-verwunschener Klangarchitektur verkriecht und sich schließlich in größtmöglicher Innigkeit dem Selbstmitleid hingibt.