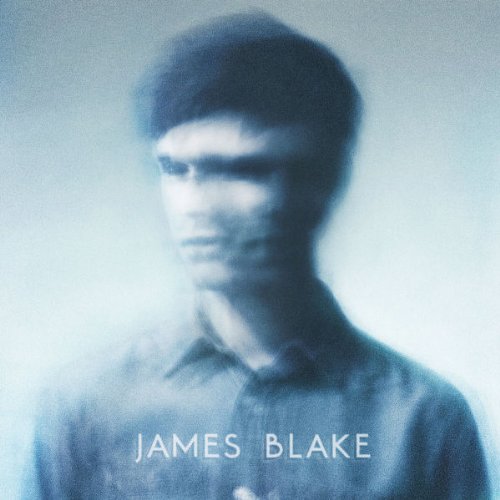James Blake :: James Blake
Dem DJ-Wunderkind gelingt ein erstaunliches Pop-Mash-up.
Das Beste an James Blake ist seine Jugend. Oder besser: das Erstaunlichste. Gerecht kann es jedenfalls nicht sein, wenn jemand mit 21 bereits ein derartiges Talent, eine solch souveräne Könnerschaft beweist wie der britische Produzent und Musiker. Blake wuchs mit Soul und R&B auf, spielt Klavier, seit er sechs ist, studierte Musik, arbeitete als DJ – ein Wunderkind.
So oder ähnlich fangen in diesen Tagen viele Artikel über James Blake an, den derzeit am höchsten gehandelten Newcomer des UK. Seine Musik ist ein clever montiertes Mash-up aus Jazz, Soul, Folk und Dubstep, das allerdings nur Idioten Post-Dubstep nennen. Im Prinzip macht Blake moderne Popmusik mit dem Selbstverständnis eines DJs. Man denkt an Antony, Otis Redding, Radiohead, aber auch an Minimal Techno. Im Vergleich zu Dubstep-Dekonstrukteuren wie Mount Kimbie, für die er Remixe anfertigte, geht Blake einen Schritt weiter aufs Massenpublikum zu.
Im Prinzip ist Blake ein Soulman, der den Gospel in der elektronischen Kirche des 21. Jahrhunderts spielt. Hierfür bedient er sich der Produktionstechniken der Club-Musik: gepitchte Vocals, analoge Synthesizer, Vocoder, R&B-Samples und dergleichen. Blake ist also ein weiteres Beispiel für den zunehmend unverkrampften Umgang junger Musiker mit starren Genre-Grenzen und Codes.
Keine Missverständnisse: Auch wenn Blake einen beeindruckenden Konsens schafft, im direkten Sinne massentauglich sind seine Songs nicht. Ihre eindringliche Atmosphäre verdankt seine Musik dem Kontrast zwischen der klirrenden Isolation der Beats und Sounds und der periodisch aufflackernden Wärme seines ansonsten Cut-up-artig zerhackten Soul-Vortrags. Immer wieder bleibt die Stimme, wie bei „To Care (Like You)“, nackt und schutzlos im Raum stehen, nur untermalt von einzelnen Klaviertupfern.
In solchen Momenten schafft Blake durch Repetition eine berückende, beinahe unangenehme Intensität. Auch „Measurements“ und „I Never Learnt To Share“ sind stilistisch und atmosphärisch von beeindruckender Tiefe – worüber man beinahe die kompositorischen Mängel übersieht. Jene werden einem erst durch den Umstand bewusst, dass die vielgelobte Cover-Version von Leslie Feists „Limit To Your Love“ tatsächlich der beste Song dieses Albums ist. Aber der Mann ist ja noch jung. (Atlas/Universal) Torsten Gross