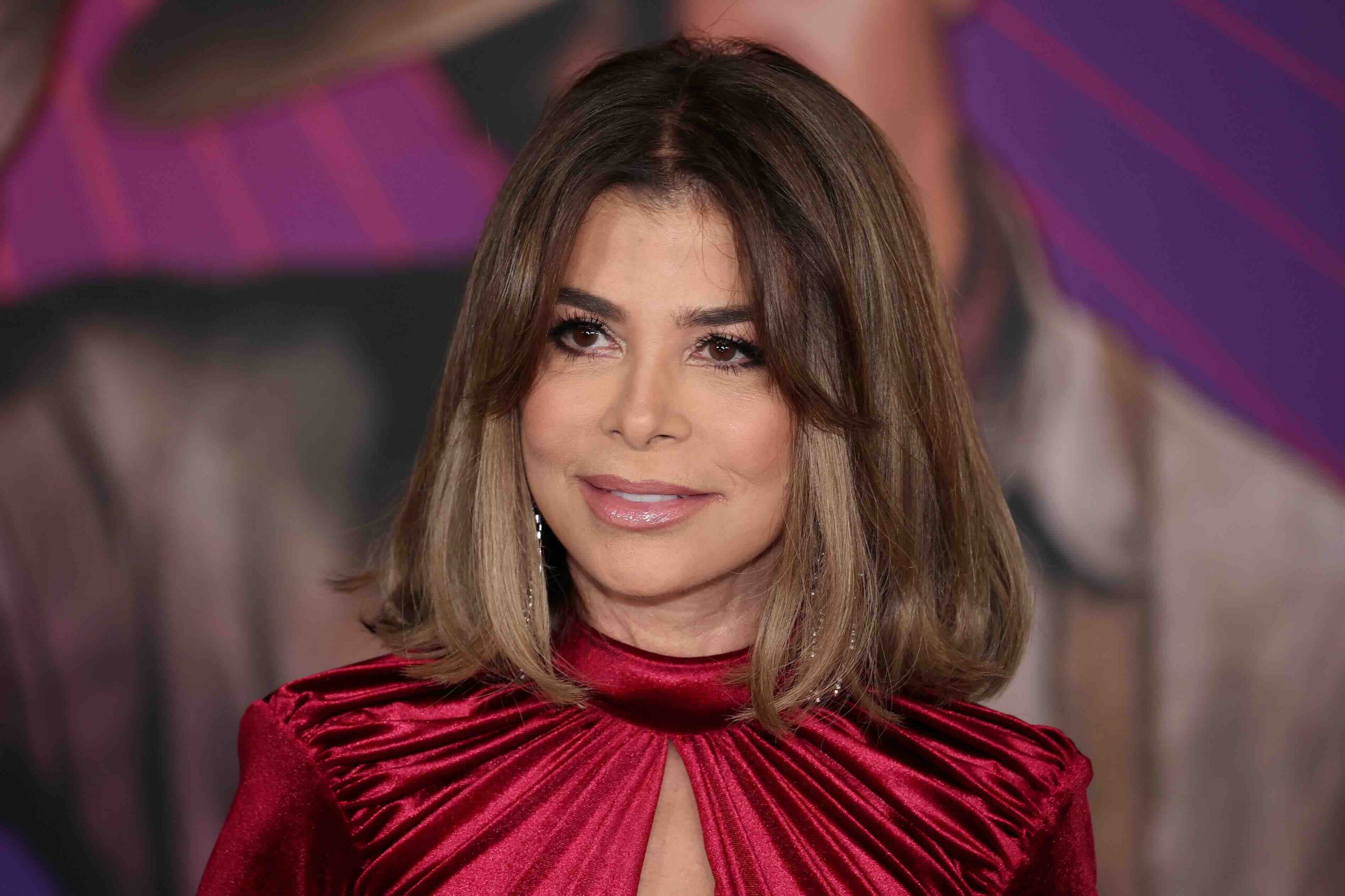Kevin Devine – Put Your Ghost To Rest
Es ist wieder eine dieser Geschichten, in der ein begabtes Rotkäppchen vom bösen Wolf einer großen Plattenfirma gefressen wird. Aber Kevin Devine hat es überlebt. Glücklicherweise war er kein argloses Kerlchen, das fröhlich singend ins Unglück rennt, sondern schon immer ein Kämpfer. Das sommersprossige Babyface täuscht da leicht.
Nach seinem dritten Album „Split The Country, Split The Street“ (2005) sollte die Karriere des New Yorkers richtig losgehen. Im Herbst 2006 wurde „Put Tour Ghost To Rest“ in Amerika bei Capitol veröffentlicht, dann mischte sich EMI ein – und Kevin Devine war den Major-Vertrag gleich wieder los. Jetzt ist er also zurück bei Defiance, und das Album bekommt in Europa eine zweite Chance. Immerhin: Den Produzenten Rob Schnapf (Beck, Vines, Elliott Smith) hatte der Songwriter noch von Major-Geldern bezahlen können, so dass die Songs jetzt besonders schön strahlen.
Es geht diesmal nicht so sehr um den Zustand seiner Heimat und die gottlose Welt, es geht mehr um das Innenleben und die Suche nach einer Identität, die sich nicht nach den Vorstellungen anderer richtet. Gleich in „Brooklyn Boy“ stellt sich Devine gegen die Erwartungen, die alle immerzu haben, und verteidigt das Stubenhocker-Dasein: „For now, I want to be this way/ This was a choice, this was never a mistake.“ Wieder klampft er dazu so liebreizend, dass man die eine oder andere Spitze leicht überhört. Er kann die traurigsten Verse so entspannt singen, dass sie einem noch viel näher gehen, wenn man sie erst mal verstanden hat. So reißt einen der zarte Schwungvoll „You’ll Only End Up Joining Them“ langsam mit, noch bevor man merkt, dass es hier um einen geht, der dem Selbstmord gerade noch von der Schippe springt. Ähnlich wie Conor Oberst hat Devine das Talent, die Moral von der Geschichte mit prägnanten Zwei- bis Vierzeilern zu beschreiben, die sich für E-Mail-Signaturen so gut eignen wie für Poesie-Alben. Einer der schönsten unter den trübseligen taucht in „Less Yesterday, More Today“ auf: „A roller-rink I stumble through waiting for the songs to stop/ And I used to drown it out with empty space I found/ But I turned my back and my life got too crowded/ So it’s really hard to do that now.“ Freunde und Bekannte tummeln sich in vielen Songs, aber oft nützt alle Empathie und Toleranz nichts: überall Lügen und falsche Sehnsüchte, nur manchmal etwas Zuversicht („Heaven Bound & Glory Be“).
Aber ganz hat sich Devine noch nicht in sich selbst zurückgezogen, er spuckt auch wieder einen Song wie „The Burning City Smoking“ aus, der brennt vor Wut und dessen Strophen kaum enden wollen. Amerika ist hier nur noch eine Filmkulisse, Uncle Sam ein schlechter Schauspieler, und der Sänger wird am Ende natürlich vom Drehort entfernt, weil er nur stört mit seinen Grüblereien: „If our constant choice is skimming past the writing on the wall/ Then I’m sad to say we’re lost and I’m embarrassed for us all.“
Kevin Devine ist gerade 27, da bleibt noch genug Zeit für einen dritten, vierten oder fünften Karriere-Anlauf. Ausruhen wird er sich vorerst nicht, die Geister geben einfach keinen Frieden.