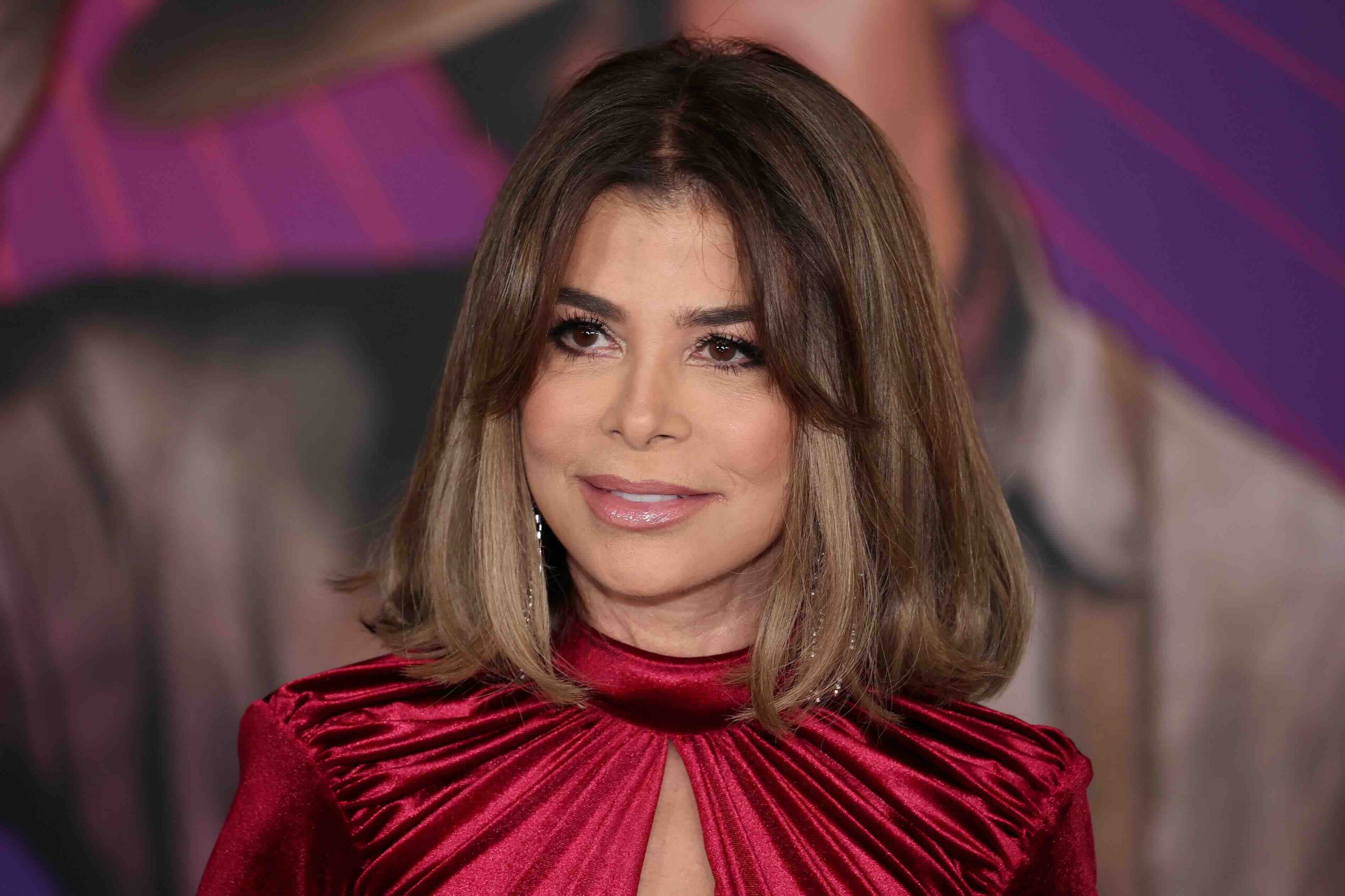Secret Machines – Ten Silver Drops
Stierende Langeweile und klirrende Spannung sind schärfste Gegensätze, haben aber eins gemeinsam: Im Leben, in der Kunst gibt es sie beide nur, wenn im besagten Moment eigentlich nichts passiert. Das erklärt trotzdem nur halb, wie es sein kann, daß sich die Secret Machines aus New York nach dem absolut und nachhaltig phantastischen „Now Here Is Nowhere“-Album von 2004 jetzt einen so schlimmen Flop leisten: An den langen Stücken, der Monotonie, der Banalität der Akkordfolgen kann es nicht liegen, denn all das war auf der ersten Platte des Schwarzhaar-Trios auch schon so, aber eben nicht öde, sondern aufregend bis zum Platzen. Die kühle, coole Wiederholung, durch die Stumpfheit hindurch bis zur neonblitzenden Brillanz, wie die Krautrocker oder Led Zeppelin.
Die neue Platte klingt dagegen, als hätten die Secret Machines beim ersten Mal eigentlich schon den ganzen Witz verraten. Die verwirrende Balance, die auf „Now Here“ alles in der Schwebe gehalten hatte, ist zerstört – Space-Rock-Gitarren klingen dieses Mal meist wie Waldfanfaren und Nebelhörner, der Sänger röchelt betont, man hört sonderbares Wetterleuchten, vorhersehbare Klein-Explosionen und am Ende sogar das begehrte Lennon-Klavier. Es könnte einzig und allein an Produktion und Abmischung liegen, daß einen die Secret Machines hier verstörend oft an fischkalte Eighties-Keyboard-Rockbands wie Mr. Mister oder Cock Robin erinnern, obwohl sie in der Glanzzeit doch auf die geduldige Beat-Meditation, die Produktion elektrischer Blitze durch reine Konzentration aus waren.
Am besten klingen die zwei Balladen-Stücke am Schluß, die für die Band zwar untypisch sind, aber ein schön geschwungenes Prog-Rock-Pathos aufbauen, während der große Rest im Banalen feststeckt. Ein wenig, als ob eine der tausend Coldplay-Kopisten-Bands versuchen würde, Bowies „Heroes“ nachzuspielen. Hypnotisch ist das am Anfang schon, aber nach sechs Minuten hiervon müßte der gesunde Hypnose-Patient eigentlich eingeschlafen sein.