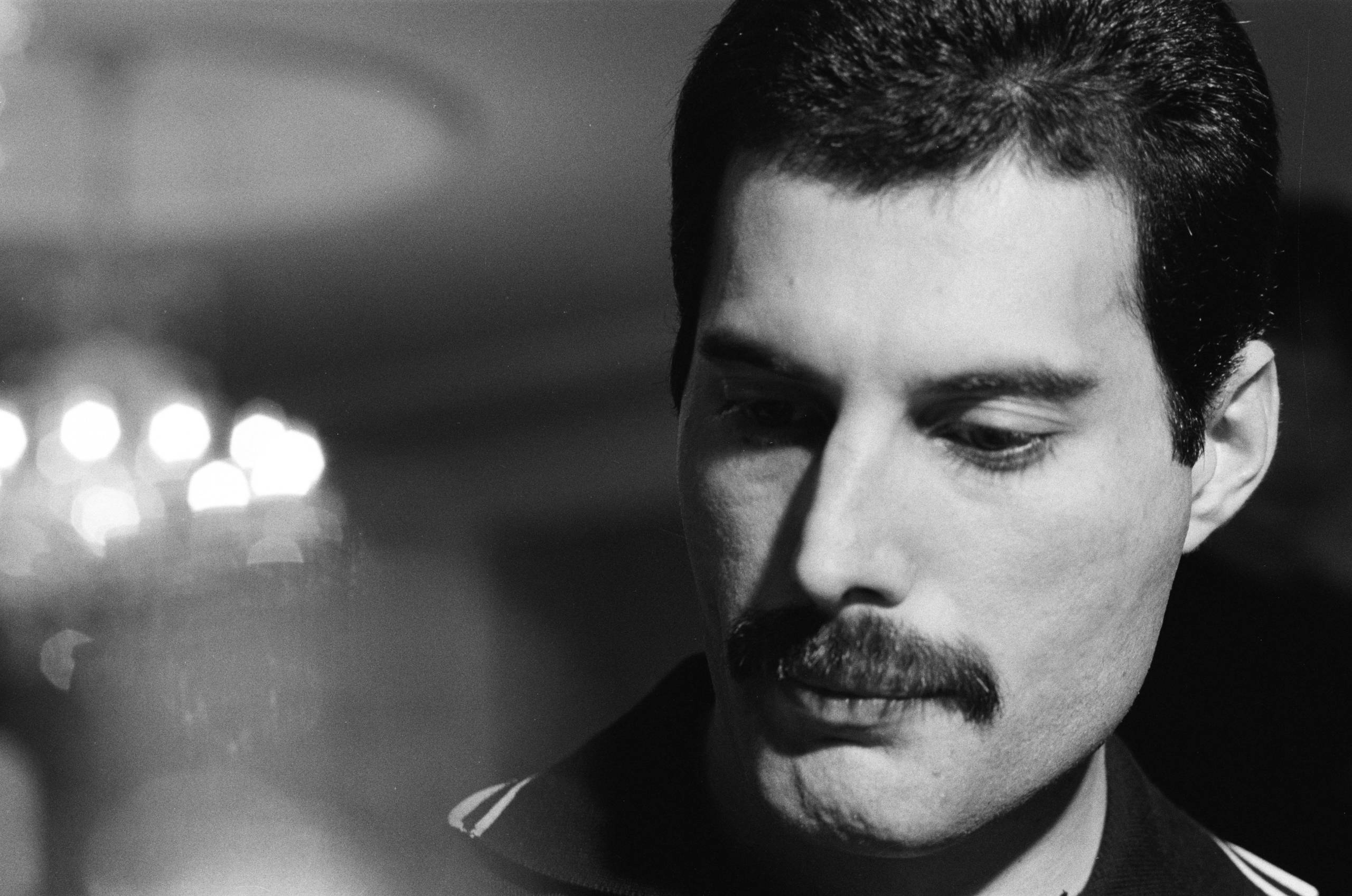Rory & Ita
„Rory & Ita“ von Roddy Doyle erzählt eine „irische Geschichte“, die seiner Eltern, die im ersten Drittel des letzten Jahrhunderts geboren wurden, in ländlicher Umgebung aufwuchsen – und ein dermaßen durchschnittliches, unspektakuläres Leben fristeten, daß man ein Sittenbild der Zeit in den Händen zu halten glaubt. Mein ganzes Leben lang“, sagt Ita, „habe ich nur in zwei Häusern gewohnt, habe nur zwei Jobs gehabt und einen einzigen Ehemann. Ich bin eine sehr interessante Person.“
Doyle bescheidet sich mit der Transkription und Montage der Gespräche, faßt höchstens mal einen längeren Passus zusammen oder fügt eine erklärende Fußnote hinzu. Ein grundsympathisches Unterfangen also, das leider auf ganzer Linie scheitert. Schon nach ein paar Seiten sind die verwirrenden Verandtschaftsverhältnisse der beiden nicht mehr auseinanderzuhalten, die politische Geschichte Irlands wird einfach vorausgesetzt, aber sonst alles ganz umständlich beschrieben, noch der Pißpott unter dem Nachtschrank bekommt eine Aufmerksamkeit, als handele es sich hier um einen antiken Tonfund. Die beiden Plaudernden können nichts dafür, sie erzählen ja nur, wie das damals war, und wollen nichts vergessen. Doyle hätte eingreifen müssen, die Anekdoten straffen, Beschreibungsredundanzen streichen und den Stoff grundsätzlich dramatisieren. Aber offenbar ist dem Nachgeborenen die Familiengeschichte so wertvoll, daß ihm das Gespür für die Ökonomie gänzlich abhanden kommt. Vielleicht ist er auch einfach befangen, mag seinen Eltern nicht nachträglich über den Mund fahren. Sozialhistoriker müssen das natürlich lesen, aber die bekommen schließlich Geld dafür. (21,50 Euro)