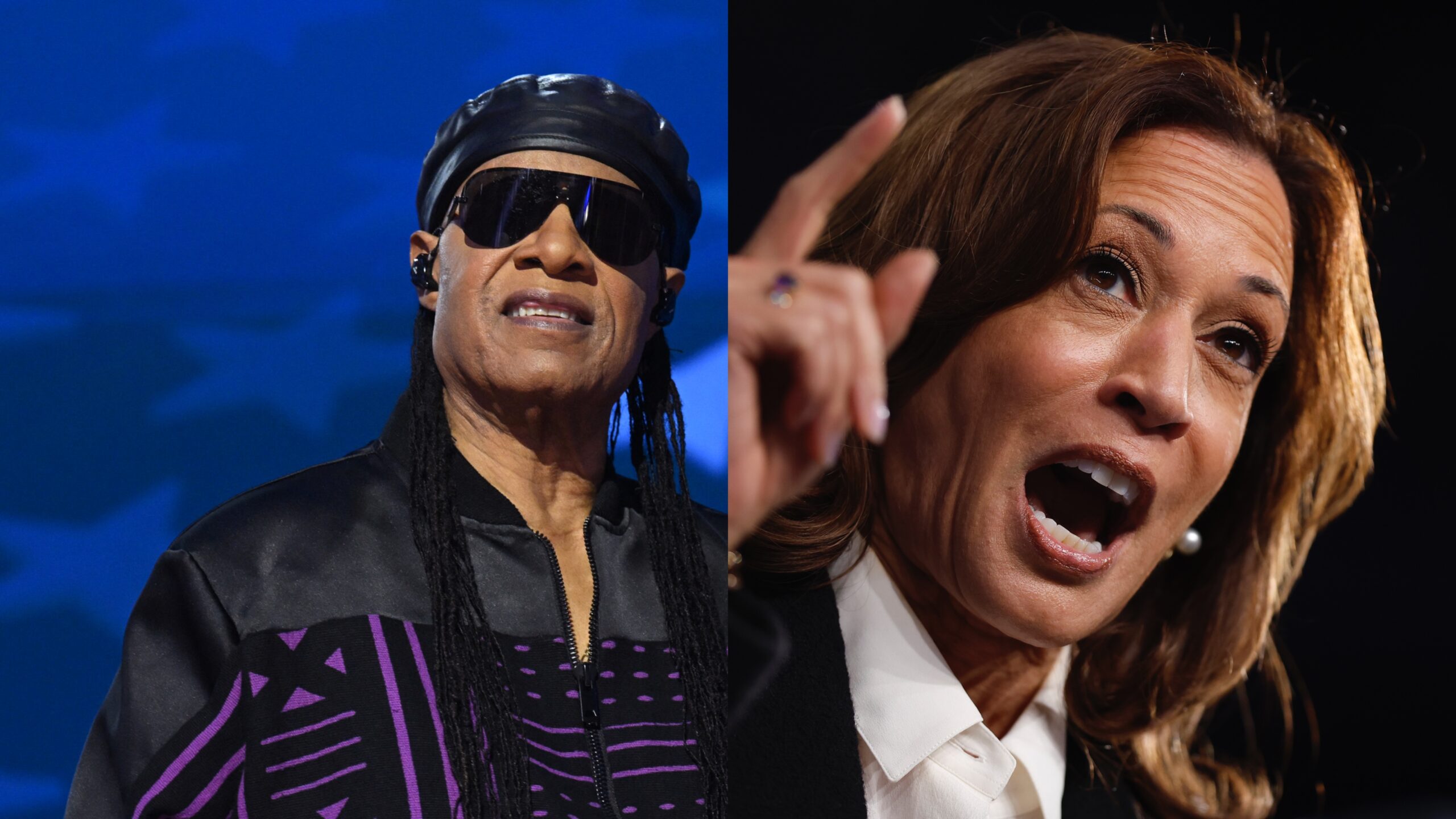It’s Showtime
Regie: Spike Lee (Start 10.5.) „Vergiss den Arsch Spike Lee“, sagt der angelsächsische Anzugträger in der Chefetage eines TV-Senders zu seinem afroamerikanischen Angestellten und tätschelt dessen Knie. „Tarantino hatte Recht: Nigger ist nur ein Wort. Warum soll ich es nicht benutzen?“
Nein, zur Selbstironie hat Spike Lee noch nie geneigt, und deshalb ist die Frage für ihn auch nicht berechtigt, sondern eben das Problem. In mehr als einem Dutzend Filmen ist der kleine, schmale Regisseur schon der schwarzen (Lebens-) Kultur und dem amerikanischen Alltagsrassismus nachgegangen, entwarf mit „Do The Right Thing“ exemplarisch ein Eskalationsszenario, zeigte die vergebliche Liebe zwischen einem Afro-Amerikaner und einer Italo-Amerikanerin in ,Jungle Fever“ und setzte dem radikalen „Malcolm X“ ein episches Denkmal, wie es Hollywood für seine Kriegshelden tut Von jeher gilt ihm die Integration von Schwarzen in die dominante weiße Gesellschaft als neuzeitliche Versklavung und Ausbeutung. Man könnte aber auch sagen, er sei ein Miesmacher. Letztlich arbeitet er auch mit Weißen und mit schwarzen Schauspielern zusammen, die sich in weißen Filmen besetzen lassen. Wie man sich dabei nicht verkauft und seine Identität verrät und ob das überhaupt möglich ist, davon handelt „It’s Showtime“.
Pierre Delacroix (Dämon Wayans) ist ein afroamerikanischer Aufsteiger. Er hat in Harvard studiert, redet manieriert wie in einem Stück von Shakespeare und schmeichelt höfisch seinen weißen Kollegen auf dem Flur. Der elitäre Wichtighuber denkt sich Formate aus für eine Fernsehstation, deren Quoten im Keller sind. Seine letzte Sitcom floppte, weil „parallel ,Seinfeld‘ lief“ – meint er. Seinem Boss Dunwitty (völlig irre: Michael Rapaport) aber sind die Sachen zu „weiß“, also zu sauber, unverbindlich. Er wolle „schwarzen Stoff“. Im Büro des gedankenlosen Schwätzers hängen Poster von Jesse Owens, Muhammad Ali und Karem Abduhl Jabbar, er ist mit einer Schwarzen verheiratet und hat zwei „Mischlingskinder“, wie er sagt. „Bruder, ich bin schwärzer als ihr!“
In der Nacht hat Delacroix die Idee für eine Show, „die größer als ,Ally McBeal‘ wird“ und die wortwörtlich ins Schwarze trifft: Mark Twain. Onkel Tom. Eine „New Millennium Minstrel Show“ aus dem dunklen Kapitel „uramerikanischer Unterhaltungstradition“. Diese begründet sich auf Theater aus Musik, Tanz und Sketchen, wofür sich Weiße im 19. Jahrhundert mit verbranntem Kork die Gesichter schwärzten und ab sogenannte „Black Faces“ die Sklaven als faul, dämliche Hühnerdiebe und verfressene Kannibalen parodierten. Nach dem Bürgerkrieg übernahmen Schwarze die Minstrel-Methode und gaben so später auch in Hollywood-Filmen den Clown, etwa indem sie grotesk die Augäpfel verdrehen. Roberto Blanco macht das noch heute.
Delacroix holt den Steptänzer Manray (Savion Glover) und dessen Kumpel Womack (Tommy Davidson) von der Straße, nennt sie Mantan und Sleep’n‘ Eat und lässt sie in Kasper-Kostümen rassistische Witze reißen. „It’s showtime“, murmeln sie vor jedem Auftritt – denn die Sendung ist ein Hit und macht sie reich, selbst die Kritiker sind angetan. Natürlich gibt es auch heftige Proteste. „Wer will schon PC“, verteidigt sich Delacroix dann im Namen der Kunstfreiheit und erklärt gar, seine Satire würde „die Wunden des Rassismus heilen“. Auf dem Gipfel des Erfolgs endet dann alles wie eine griechische Tragödie.
Mit klugen Dialogen, zweideutigen Wortspielen und Seitenhieben schält Spike Lee hier das gewachsene Dilemma heraus. Ist Liberalismus nur anerzogen, wenn Delacroix von seinen Gagschreibern fordert, sie sollten für die „Mohren-Show ihre weiße Angst erkunden“? Und als der Rapper Julius (Mos Def) seiner Schwester Sloan (Jada Pinkett-Smith, die Frau von Will Smith) vorwirft, sie mache „Haussklaven-Karriere“, sagt sie: „Ihr seid ignorant, ihr würdet sogar mich aus meinem Job rausbomben.“ Einmal fragt Delacroix seinen Vater, der in schwarzen Clubs über Weiße herzieht, warum auch er „Nigger“ sage – und der hat darauf keine Antwort. i