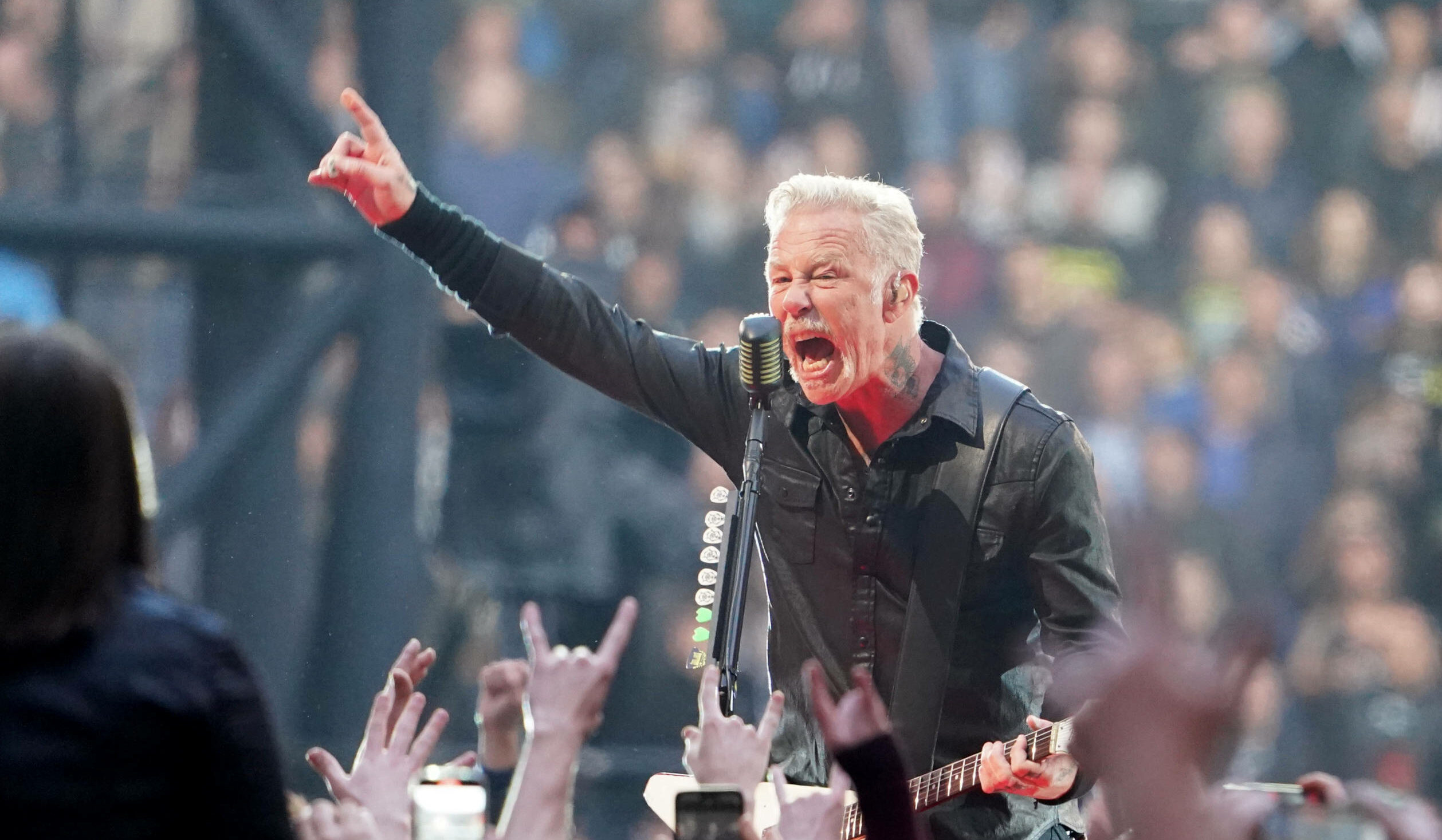Motörhead
We Are Motörhead
One more fucking time: Lemmys Band haut wieder imposant auf die Glocke
Vor beinahe zwei Jahrzehnten las man im „Musik-Express/Sounds“ eine Besprechung der aktuellen Alben von Krokus und Motörhead. Der Rezensent vertrat darin die allemal bedenkenswerte Auffassung, dass selbst die beste Krokus-LP immer noch schlechter sei als die schlechteste von Motörhead, weil diese Band wie keine zweite die Sündhaftigkeit, Dummheit, Vi- und Brutalität etc. des Heavy Metal verkörpere, dieses musikalischen Abbilds der alles vernutzenden industrialisierten Gesellschaft – oder so.
Wie wahr das gesprochen war, zeigt nicht zuletzt der Umstand, dass sich in den vergangenen 20 Jahren nichts, aber auch gar nichts daran geändert hat. Immer noch muss die – seit einiger Zeit wieder zur klassischen Trio-Formation verschweißte – Barbarenband mit Lemmy „Let me kill, Mister!“ Kilmister am Bramarbass als Personifikation des Genres herhalten. Zwar sind Metallica, Pantera und Konsorten als Gewährsmänner hinzugekommen, aber wer gedroschenen, dumpfen, martialischen Schweine-Metal mit einer gewissen militanten Rabiatesse meint, der sagt wohl doch immer noch zuerst Motörhead.
Wie kann man damit leben? Kann man damit leben? Ja. Wenn man dumm genug ist. Und wenn man anstatt der Weiterentwicklung die Variation als legitime künstlerische Aufgabe für sich anzuerkennen vermag. Motörhead sind zunächst mal Meister der Variation. So wartet denn auch das Titelstück ihres neuen Albums „We Are Motörhead“ mit jener Riff-Mücke auf, die schon früher – bei den Standards „Overkill“, „Bomber“, „Ace Of Spades“ usw. – zu einem ausgewachsenen, vor Wut trompetenden Song-Elefanten mutierte. Fünf weitere Hochgeschwindigkeitsgeschosse sorgen für den guten Schnitt, darunter das nicht sehr inspirierte Sex Pistols-Cover „God Save The Queen“ und der anschlagsfleißige, mit mehrstimmiger Chorusmelodie nachgerade eingängige Riffer „Stay Out Of Jail“. Der Rest ist Double-Bass auf Speed wie üblich, aber immer noch imposant, zumal wenn die drei Hand in Hand den Takt in seine Sechzehntel zerstückeln. Avancierter freilich kommt die gut fünfminütige, also eigentlich überlange Midtempo-Keule „Wake The Dead“ daher.
Einmal mehr gibt es auch Balladeskes, eine Ode an die Vergänglichkeit („One More Fucking Time“), bei der Lemtnys tiefer, heiser-gequälter Kompressorgesang sich plötzlich aufhellt, schon beinahe transparent wird und brüchig, ja verletzt das Leiden der Kreatur beklagt – bis es ihn schließlich doch wieder so empört, dass er einen ganzen Chorus lang Zeit braucht, um sich den Ingrimm von der Seele zu schreien.