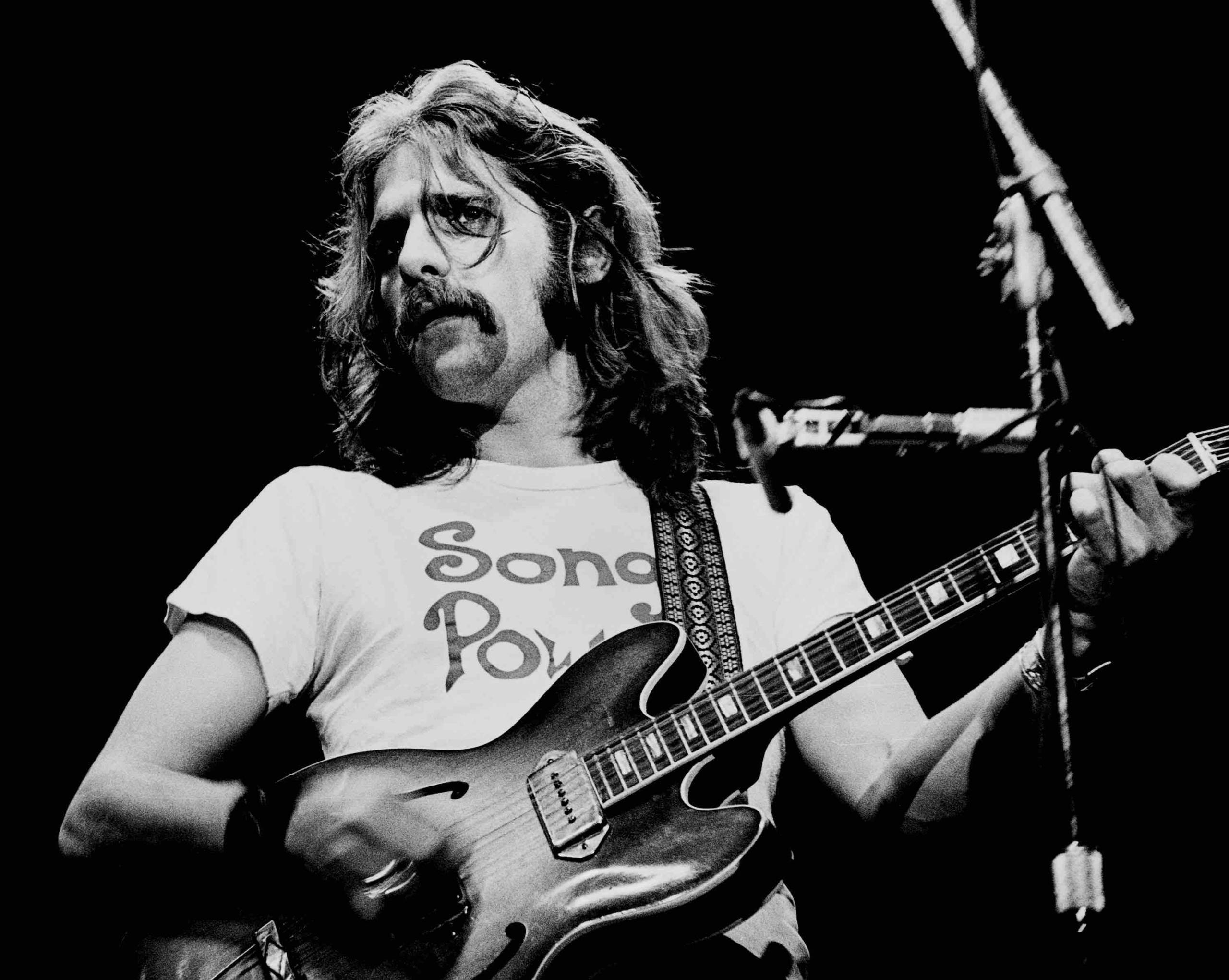Sheryl Crow :: The Globe Sessions
Was bisher geschah: Ein Mädchen aus Missouri schüttelte ihre Locken und schürzte ihre vollen Lippen in einem lasziv-launigen Video, in dem es nur darum ging, was dieses Mädchen zweifellos am allerliebsten mag, nämlich… ahm… „Spaß haben“. MTV spielte mit, packte den Clip namens „All I Wanna Do“ auf High Rotation und machte Sheryl Crow nach harter Lehrzeit über Nacht zum Stat Soweit die Legende.
Natürlich fallt dabei gern unter den Tisch, daß Sheryl Crow, die mit 25 Jahren nach L.A. zog, um ihr Glück als Singer/Songwriter zu versuchen, zunächst einmal als Background-Sängerin bei Michael Jackson jobbte. Erste Aufnahmen führten 1991 ins Leere, weil ihr damaliger Produzent, die 80er-Jahre-Legende Hugh Padgham, keinen Blick für Sheryls Glamrock-Konzept hatte und die ganze Angelegenheit zu den Akten legte.
Es brauchte zwei weitere Jahre, bis „All I Wanna Do“ erschien und kräftig einschlug. Das zugehörige Album hieß „Tuesday Night Music Club“ und enthielt ein Kompendium aus Songs, die Sheryl im Laufe der Zeit zusammengetragen hatte. Ein ebenso typisches wie sympathisches Debüt-Album voller kleiner emotionaler Höhepunkte wie „No One Said It Would Be Easy“.
Für ihren kleinstädtischen Charme und ihre musikalische Professionalität bekam sie fünf Grammies und etablierte sich als so eine Art Alanis für Ältere im vereinnehmenden Boom der übersensiblen Rock’n’Roll-Frauen. Was das hieß? Sheryl Crows kühle Abgeklärtheit schlägt sich in ihren Texten oft in sarkastischen Schnoddrigkeiten nieder, was die oft naive Entflammbarkeit der Damen McLachlan und Co. natürlich um einiges an Lebensweisheit übertrifft. Aber: ein langweiliges Image. Sheryl selbst gefiel sich offenbar auch nicht so recht als all american girl und änderte fiir das zweite, selbstbetitelte Album ihr Outfit in vermeintlich hippen Heroin-Chic Musikalisch wurde Country wieder mit Glam vertauscht, und textlich übte sich Frau Crow in Reflexion: der schnelle Erfolg und die Schattenseiten des Biz etc.
Und jetzt? Um Popularitätseinbußen muß sie sich kaum noch Gedanken machen. Als Superstar werden ihr sogar Peinlichkeiten wie ihr Beitrag zum Bond-Film „Tomorrow Never Dies“ verziehen. Nach gelungener Imagekorrektur käme als nächster Programmpunkt nun also die Konsolidierung der eigenen Tiefe und songschreiberischen Qualität in Frage. Und richtig: Im Beiblatt wirbt sie damit, auf der neuen Platte „ihr Innerstes nach außen zu kehren“. Die Songs seien persönlicher als alles, was sie jemals geschrieben habe und es sei ihr, als stünde sie nackt auf der Bühne. Nun ja. Ahnliches hört man ja nun doch öfter von Künstlern, die gerade ihr drittes Album zusammengebastelt haben. Äußerungen dieser Art stehen längst auf dem Index und gelten als Phrasen und Worthülsen, die aus lauter ‚Verlegenheit herbeigezerrt werden. Problem ist nun Vbn einer Plattenfirmen-Marionette ohne eigenen Willen kennt man nichts anderes – von Sheryl Crow allerdings, die bisher noch immer alles nach ihrer Nase hat tanzen lassen, erwartet man irgendwie mehr.
Was ist denn überhaupt da? „The Globe Sessions“ heißt das dritte Crow-Album. Produziert hat sie es (wieder) selbst, für den Endmix holte sie sich den hippen Kalifornier Tchad Blake (The Dandy Warhols, Soul Coughing) und „Alternative-Koryphäe Andy Wallace. So weit, so hochwertig. Auch die Gästeliste liest sich gut: Indigo Girl Lisa Germano, Prince-Girl Wendy Melvoin, Petty-Keyboarder Benmont Tench, Stones-Saxophonist Bobby Keys oder Jay Bennett von Wilco.
Wie persönlich und intim die Songs gemeint sind, kann man nur mutmaßen. Sicher: Die Aufarbeitung der eigenen Unsicherheiten und Fehler kommt durch, wenn man sich die Texte von Songs wie „My Favorite Mistake“, „It Don’t Hurt“ oder „Anything But Down“ anhört. Mit der von ihr schon gewohnten Selbstironie schafft sie jedoch eher Distanz als die von ihr gewünschte Nähe.
Erschwerend kommt hinzu, daß die bewußt auf klangliche Perfektion ausgelegte Produktion alles killt Die „Globe Sessions“ klingen weniger nach Sessions als nach glattgebügelter L.A.-Studioroutine. Vor lauter Freude über den mittelmäßigen Bob-Dylan-Song „Mississippi“, den der Altmeister nicht auf „Time Out Of Mind“ haben wollte, vergißt Sheryl, das Geschenk angemessen „folky“ zu instrumentieren. Als „unplugged“-Versionen, nur von ihr selbst am Piano oder Keyboard begleitet, wäre so manches Stück des Albums schon jetzt ein Klassiker, ganz besonders die Balladen „Riverwide“ und „Crash And Burn“.
Bleibt also die profane Erkenntnis, daß zuviel auch wirklich zuviel ist und weniger manchmal mehr. Immerhin: Sheryl Crow profiliert sich mit ihrem überambitionierten Drittwerk als arrivierte Songschreiberin und Produzentin, hat aber scheinbar jeden Mut zur Schräge verloren. Ihre „Globe Sessions“ erinnern oft an ermüdende Manierismen, die man von den Solo-Versuchen eines Don Henley, Roger McGuinn oder Dion in den 80er Jahren kennt. Die aber, so munkelt man ja schon etwas länger, erleben ohnehin gerade ein Comeback.