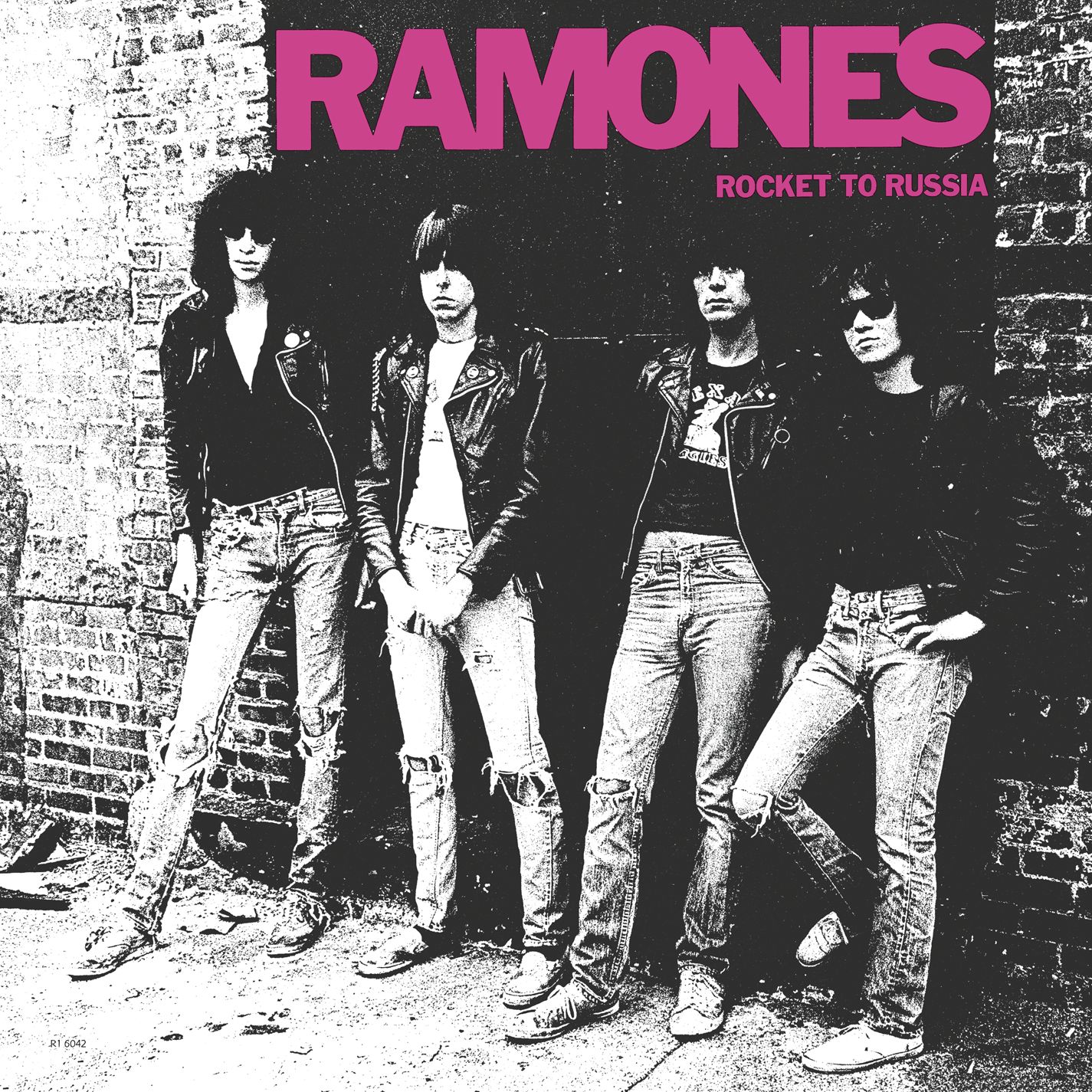Mannic Street Preachers – Everything Must Go
Vom Ausgang her betrachtet, gab es sowieso keine Hoffnung für Richey James Edwards, den Mann, der sich auslöschen wollte. Dem letzten Album der Manic Street Preachers von 1994, “ The Holy Bible“, hatte Edwards, der Designer und Ideologe der Band, einige Sentenzen aus Octave Mirbeaus „The Torture Garden“ vorangestellt: „It is that permanent contradictjon between your ideas and desires and all the dead formalities and vain pretenses of your civilization which makes you sad, troubled and unbalanced. In that intolerable conflict you lose all joy of life and all feeling of personality.“ Das Wort wurde Fleisch, und so geschah es: Edwards verlor erst jede Freude, dann verlor er sich selbst. „The Holy Bible“ blieb sein Testament.
Ein bedrückendes, beeindruckendes Album – Dokument eines Selbsthasses, der in einer letzten Anstrengung auf die Welt projeziert wird: Die Amerikaner waren plötzlich schuld („If White America Told The Truth For One Day Its World Would Fall Apart“, so ein monströser Songtitel), die Tyrannen und Massenmörder („lebensraum, kulturkampf, raus, raus“ – „Revol“), die „Archives Of Pain“, der „P. C.“-Terror. Edwards hatte viel gelesen, aber seine Weltverneinung blieb unausgegoren, emotional und hilflos. Die hybride Identifikation mit Jesus, der pubertäre Todeskitsch, die Zeichnung einer fetten Frau auf dem Cover, das alles kann die Psychologie mit Kompensation und Projektion natürlich sofort wegerklären, so offensichtlich, so maßlos, so blöd und so tragisch.
Aber diese Fotos neben dem Text von „Die In The Summertime“: Kinderfotos der vier Musiker, wie sie in jedem Familienalbum gesammelt sind, die schmutzigen Farben, die Unscharfen, die Porträts vor neutralem Hintergrund, die Strand-Kulisse, die Fritten auf dem Pappteller, und die Gesichter, die noch nichts wissen. „Childhood pictures redeem, clean and so serene.“ Davor versagt die Erklärung.
Die Manic Street Preachers hatten immer feuchte Augen vor Wut, aber nun sehen sie auf fast allen Abbildungen verheult aus, und sie empfinden keine Wut mehr, sondern Demut Der Rezensent saß vor vier Jahren Nicky Wire, dem Bassisten, gegenüber. Wire war 21, das Debüt „Generation Terrorists“ gerade erschienen, „Motorcycle Emptiness“ ein Hit, und Wire grinste und kicherte verlegen und ein bißchen debil, ruderte mit den Armen unter dem Tisch herum und nestelte wie ein Mädchen an einem Anhänger über einem T-Shirt mit Traci-Lords-Bildnis. Was sollte das sein? Punk? Glam? Schwuchtelige Whimps als Motorrad-Rocker? Jedenfalls kamen sie aus Wales und wollten die Revolution. Doch damals, im Büro der Plattenfirma, war die Revolte ein Wimmern, kein Schrei.
Später wünschte Nicky Wire in einem törichten Akt Michael Stipe die Aids-Seuche an den Hals, das machte dann Schule. Wire schrieb auch den Text zur Comeback-Single der Manics, „A Design For Life“, eine Hymne auf den Stolz und die Unbeugsamkeit der Arbeiterklasse, aus der er stammt „We don’t talk about love/ We only want to get drunk.“ James Bradfield singt das mit einer gepreßt heiseren Stimme, die an den fröhlichen Proletarier Rod Stewart gemahnt, die Gitarren klingen wie ein Sieg, und der Song wurde Nummer zwei in England. Der „melancholische Triumph“, den Wire hier zum Tönen bringen wollte, ist geglückt; trotzdem ist „A Design For Life“ bei aller Wucht das schwächste Stück auf „Everything Must Go“.
Kein unverschlüsseltes Wort über das Verschwinden von Richey Edwards, kein Hinweis – bloß vier Texte, die der Freund hinterlassen hat. Anders als auf „The Holy Bible“ geht es nicht gegen übermächtige Feinde und Windmühlen – die Lyrics von „Elvis Impersonator: Blackpool Pier“, „Kevin Carter“, „Small Black Flowers That Grow In The Sky“ und „Removables“ kommen von der anderen Seite seines Schmerzes: Sie sind voll empathischen Gefühls, voll Trauer und – das geschundene Wort – Menschlichkeit Edwards litt mit dem Fotografen, dessen in Afrika aufgenommenes Bild eines Kindes im Todeskampf vor einem Geier mit dem Pulitzer-Preis belohnt wurde und der sich das Leben nahm; er litt mit den gefangenen, vernachlässigten Gorillas im Zoo; er litt mit dem übergewichtigen Elvis-Darsteller auf dem Amüsier-Pier in Blackpool. Und er litt an den „Removables“: „Aimless rut of my own perception/ Numbly waiting for voices to teil me.“
Die Songs, die das Trio für diese Beobachtungen des Elends komponiert hat, sind ihre kohärenteste, gleißendste, bewegendste Rockmusik. Nichts ist Resignation auf diesem Album, alles Überleben. James Dean Bradfield war immer ein guter Songschreiber; er ist ein großartiger, wenn er den Melodien Raum gibt, den Krach zurücknimmt (die Harfe in „Small Black Flowers“, die Trompete in „Kevin Carter“, die Streicher bei „Everything Must Go“!). Eine pathetische Musik aber mit den besten Gründen der Welt. Im letzten Song des Albums, „No Surface All Feeling“, resümiert Nicky Wire ihr Schicksal und ihre Grandezza: „What’s the point in always looking back/ When all you see is more and more junk/ It was no surface but all feeling.“
Auf den Halden der Verzweiflung feiern die Manie Street Preachers triumphal die Tragödie der Existenz. „It’s so fucking funny“, würde Richey Edwards sagen, „it’s absurd.“
4 REAL.