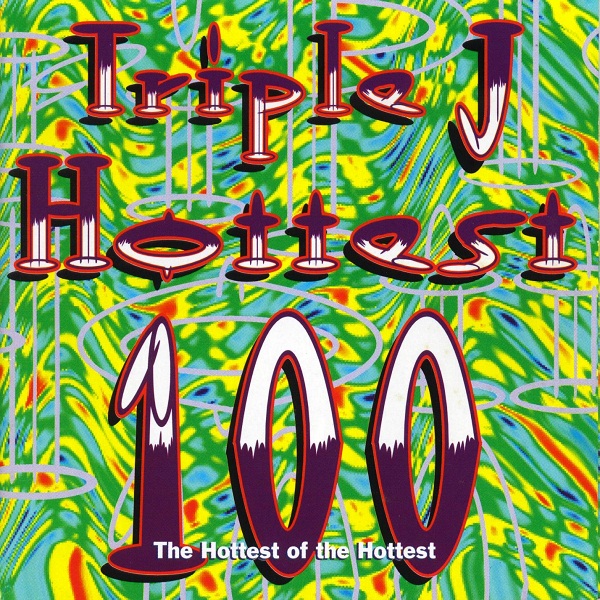Dave Graney & The Coral Snakes – Night Of The Wolverine
Der Australier, so er musizierend seinen Lebensunterhalt zu bestreiten versucht, gilt gemeinhin und nicht ganz zu Unrecht als das entscheidende Quentchen „anders“. Doch egal, ob die Triffids oder Big Whiskey, ob Kim Salmon mit den Beasts Of Bourbon oder Tex Perkins mit The Cruel Sea, ob R&B-Hitze oder Country-Melodram – stets hallte bei den Akteuren vom fünften Kontinent das Echo US-amerikanischer (Musik)-Mythen nach oder bot doch zumindest hinreichend Reibungsflächen zum Abarbeiten. Manche Australier müssen dafür nicht mal verreisen.
So wie Dave Graney. Die Geister von Ray Manzarek und Lou Reed spuken, beispielsweise, durch die zwölf Songs von „Night Of The Wolverine“, bleiben aber immer nur das: Geister. Zuweilen leicht pastoral, aber immer erstaunlich gelassen musiziert er sich mit seinen vier Coral Snakes durch ein Stil-Spektrum, das vom knappen Talking Blues („You Need To Suffer“) bis zur Mini-Oper in vier Akten reicht, die als zentrales Titelstück in zwei Folgen die Zweifel und Sehnsüchte des Künstlerlebens serviert. Viel Sehnsucht überhaupt, aber stets mit Distanz vorgetragen – in die Vergangenheit („I Remember You“) gerichtet wie auch in die Zukunft, wenn in „I’m Just Havin‘ One O‘ Those Lives“ kurz und ironisch der Gedanke an Wiedergeburt gestreift wird.
„All of a sudden you can’t look at the world in the same way“, singt Graney abschließend in „Out There (In The Night Of Time)“, und später noch: „You imagined a reality…“ Das Spannungsverhältnis unterschiedlicher Wahrnehmung ist ein zentrales Motiv vieler seiner Songs, und nicht selten bleibt der Triumph der Imagination über die „Wirklichkeit“ doch nur ein trauriger Pyrrhussieg – wie in „Maggie Cassidy“, wo’s bei Muttern nur zum Bier vorm Fernseher reicht? Selbst da, wo er sich eines lakonischen Realismus bedient, wie in der Country-Glosse „Three Dead Passengers In A Stolen Second Hand Ford“, ist die Fiktion nicht ganz aus dem Spiel. Oder gibt es in Australien überproportional viele (also mehr als zwei oder drei) Frauen, die – wie die Dahingeraffte – Modell-Guillotinen sammeln?
Fellow-Australian Simon Bonney (Crime & The City Solution) hingegen – ohnehin viel zwischen Berlin, Los Angeles, Wien und London gereist – packte für ,JLveryman “ wieder mal seine Koffer, diesmal, um quer durch die USA zu pilgern. Und wir ahnen schon: Der Trip soll auch zu sich selbst fuhren. Gewiß ein altes, schon vielfach erprobtes Thema. Doch schon das Cover mit Frau und Sprößlingen gibt Aufschluß über die Beweggründe: Wenn die Kinder kommen, kommen eben auch die großen Fragen (wieder). Wo komme ich her? Wo will ich hin? Und was mache ich in der Zwischenzeit? Richtig: „Looking For A Life I Can Explain“. Da darf die Religion nicht ganz fehlen, schließlich sind wir „All God’s Children“, und so wirft er sich einen “ White Suit In Memphis“ über und huldigt en passant gleich noch Johnny Cash, der ja immer noch Schwarz trage ob all des Leids in dieser Welt.
Zwischen Texas und Kalifornien konnte Bonney einen ganzen Haufen erstklassiger Musiker für seine (bedeutungs-) schwere Mission gewinnen, von Co-Autor J. D. Foster (Green On Red, Alejandro Escovedo) über die Gitarristen Chuck Prophet und Jon Dee Graham (Ex-True Believers) bis zu Dwight-Yoakam-Orgler Skip Edwards, Jerry-Jeff-Walker-Drummer Fred Kre und Lyle-Lovett-Cellist John Hagen. Mit diesem Personal muß er nicht gerade kleckern – und klotzt denn auch manchmal arg drauflos. Diese Überproduktion rührt sicher aus Bonneys Vorsatz, kein „authentisches“ Roots-Album machen zu wollen. Doch hätte blieb schon sein Pathos im Vortrag gereicht, um die angemessene Distanz zur heimeligen Wurzelbehandlung zu wahren.
So muß man Simon Bonneys abstrakt-düstere Cover-Version von Fred Roses „Blue Eyes Crying In The Rain“ nicht unbedingt goutieren, um festzustellen, daß sie immerhin ihr Ziel erreicht: Die Traditionalisten schütteln den Kopf.