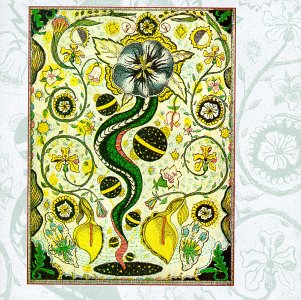Steve Earle – I Feel Alright
Zwischen 1991 und 1994 kursierten vermutlich mehr schlechte Witze über Steve Earle in Nashville, als dort schlechte Songschreiber ihr banales Handwerk tun. Und das will was heißen in einer Stadt, die vor allem der Mediokrität vom Co-Writing-Fließband huldigt. Die öffentliche Demontage des widerspenstigen Hardcore-Romantikers folgte dabei dem bewährten Prinzip, wonach für den Spott nicht groß sorgen muß, wer erstmal den Schaden im Haus hat.
Und davon hatte Earle reichlich: sechs Ehen mit fünf Frauen, woraufhin er sich selbst kokett zum „serial husband“ kürte; drei teils pubertierende Kinder, die mit dem Verlust ihres Vaters konfrontiert wurden; zwei Monate Knast wg. Heroinbesitz ironischer-bzw. fatalerweise erst zu einem Zeitpunkt, ab Earle gerade clean war. Während der Texaner als ausgemergelter Schatten seiner selbst in den Gossen von South Nashville herumirrte, konnte sich das werte Publikum an einer ausgewachsenen Soap-Opera zwischen Betten, Booze & Ballermännern laben.
Mit dem Indie-Akustik-Album „Train A Comin“ kehrte Earle dann im vergangenen Jahr in den Ring zurück, doch ein Comeback im eigentlichen Sinne stellt erst dieses Album dar. Mehr noch: „I Feel Alright“ ist ein persönlicher und künstlerischer Triumph. Anders als viele andere nämlich, die einem vergleichbaren Martyrium entkommen konnten, gefällt sich Steve Earle mit „I Feel Alright“ (dem durchaus trügerischen Titel zum Trotz) nicht in der faden Selbstgenügsamkeit des endlich doch noch Geläuterten, der den Blick in den Abgrund als ebenso stilvolle wie billige Peep-Show inszeniert. Anders als viele andere auch feiert Earle nicht bloß lächelnd die Wiederkehr, sondern impliziert schön, spannend und ja: aufrichtig mit einem dicken Grinsen, daß da nach wie vor nur ein winziger Schritt zwischen Licht und Schatten liegt. „Hurtin Me, Hurtin You“ beispielsweise, eine schmucklose Soul-Ballade, die auch Otis Redding Freude bereitet hätte, zeigt Earle verletzlich jenseits bloßer Egozentrik; und grandios gar gerät „Valentine’s Day“, ein spätes Geschenk an seine (aktuelle) Frau, umrahmt nur von einem dunkel raunenden Galeeren-Chor. Doch Earle hat darüber das Austeilen keineswegs verfemt. Im Titelsong und besonders auch mit dem garstig-programmatischen „The Unrepentant“ verhöhnt er jene, die sich trauten, ihn moralisch eilfertig zu richten. Ähnlich wie Heiner Müller muß es Steve Earle vor Menschen ekeln, die vorgeben, ohne Schuld zu sein.
Dann die Katharsis: Mit „CCK-MP“ („Cocaine Cannot Kill My Pain“), einem suggestiv-düsteren Talking-Blues, gelingt Steve Earle das Kunststück, gleichermaßen Anziehungskraft wie Ausweglosigkeit der Sucht zu beschreiben, ohne sie unnötig zu glorifizieren. Musikalisch orientiert er sich, seiner vorübergehenden Stadion-Rock-Ambitionen offenbar überdrüssig, am konzisen Country-Rock des Frühwerks, in einem allerdings rustikaleren, deutlich reduzierten Roots-Sound, der die aufregende Essenz aus Townes Van Zandt und Buddy Holly mustergültig einfangt „You’re Still Standin‘ There“, ein erhabenes Duett mit Lucinda Williams, läßt den Zwölf-Song-Reigen so ausklingen, wie er mit dem Titelsong begonnen hat: Optimistisch, aber kaum bloß selbstzufrieden.
Und sonst? Eine schöne Legende besagt, Bruce Springsteen habe gleich zehn Exemplare von Steve Earles Album „Guitar Town“ erworben, um sie an Freunde weiterzuverschenken. Der Plattendealer seines Vertrauens ist gut beraten, schon mal einen kleinen Stapel von, „I Feel Alright“ beiseite zu legen. Diesmal läßt sich Bruce wahrscheinlich gleich 20 CDs eintüten – und nicht nur wegen Earles netter Verbeugung vorm eigenen Frühwerk („Rosalita“) in „Hard-Core Troubadour“.