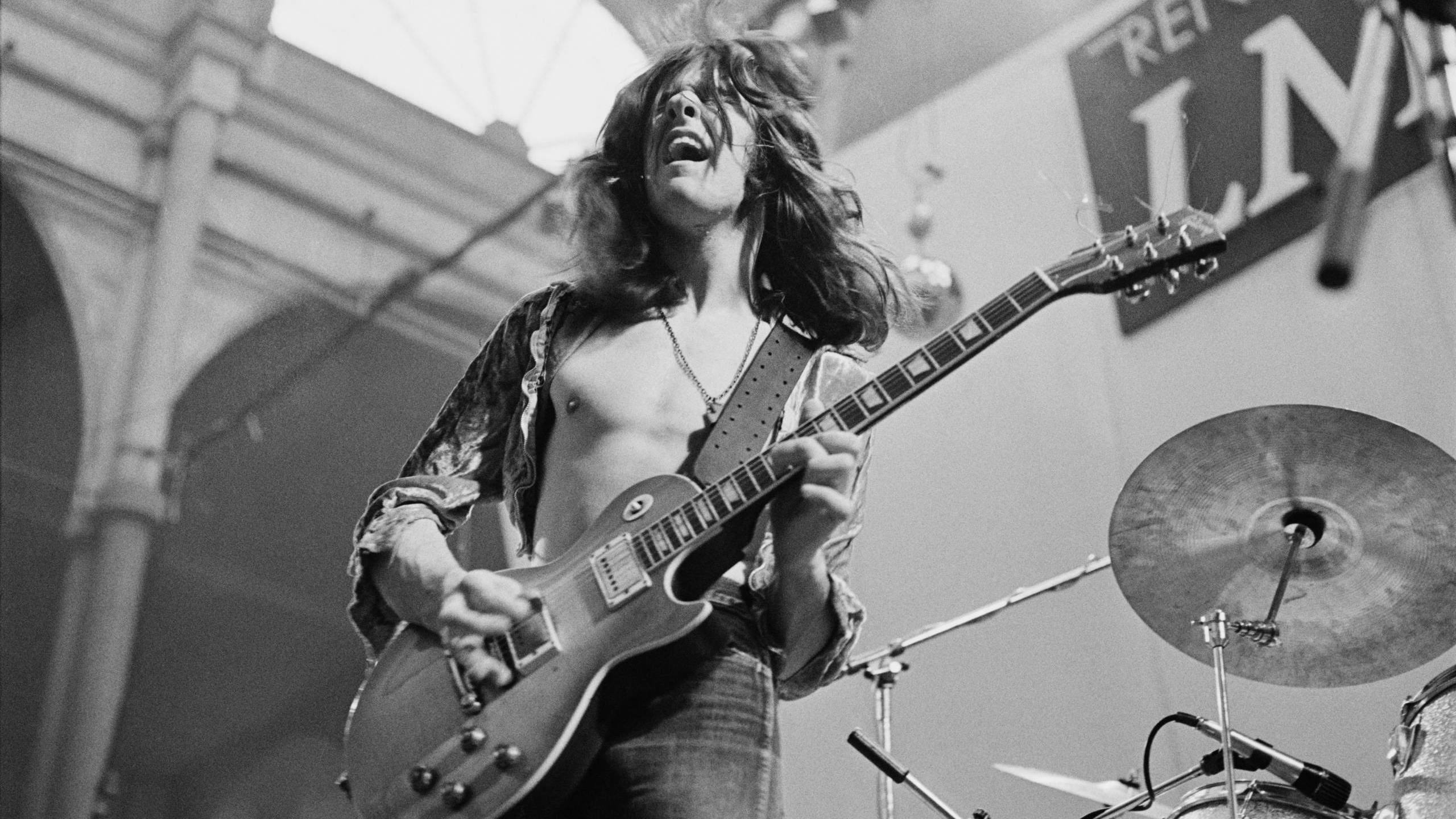Thin Lizzy – Wild One
Vergegenwärtigt man sich den Tribut-Kotau, der heute selbst Randfiguren der Pop-Geschichte zuteil wird, sind die Gunstbezeugungen für Thin Lizzy und den irischen Valentino Phil Lynott vergleichsweise bescheiden geblieben. Zumindest über den Rocker-Dunstkreis ä la Def Leppard und gelegentliche Einsätze von „Whisky In The Jar“ im Radio-Vormittagsprogramm hinaus. Immerhin: Die Smashing Pumpkins rangen dem schwärmerischen Celtic-Soul von „Dancing In The Moonlight“ ein trauriges Gesicht ab. Anthrax hingegen konnten dem „Cowboy Song“ kaum eigene Nuancen abgewinnen. Und Adam Clayton frisierte sich auf den Spuren des verehrten Dublin-Cowboys sogar einen bescheuerten Afro. Aber das war’s auch schon fast Pünktlich zum zehnten Todestag von Lynott (verhaften Sie die üblichen Verdächtigen…) liegt nun immerhin ein „Best Of im guten, altmodischen Sinne vor: Keine obskuren Ausgrabungen, keine nachbehandelten Archiv-Trümmer, die einem als „neu“ angedient werden, dafür 19 Tracks, die durchaus den Anspruch erheben können, einer Karriere in Höhen wie auch manchen Tiefen gerecht zu werden. Auch wenn sich über einzelnes natürlich streiten läßt Der Schwerpunkt des Sets liegt zu Recht auf der Lizzy-Sternstunde, die nach vorangegangenem Tasten und Positionieren zwischen 1976 und 79 schlug. „Live And Dangnrous“ ist mit zwei Tracks (darunter die Slow-Orgie „Still In Love With You“) eher unterrepräsentiert Aber wer auf den Geschmack kommt, muß diesen großen Konzertmitschnitt von 1978 ohnehin komplett im Regal haben. Hier entschied man sich deshalb für die Studio-Versionen diverser Lynott-Klassiker, die jetzt fast rührend diszipliniert und understated wirken. Dennoch: Songs wie „The Boys Are Back In Town“, „Jailbreak“ und „Bad Reputation“ formulierten mit präziser Wucht eine renitente, düstere Außenseiter-Romantik, die auch heute noch den nervös-erwartungsvollen Horizont jener Jahre aufscheinen läßt. Nicht nur in Londoner Gossen lag etwas in der Luft „Black Rose“, das letzte gute Lizzy-Album aus 1979, ist mit drei Tracks angemessen vertreten. Wenn auch der Rezensent eher für „Got To Give It Up“ als „Sarah“ (die damals frischgeborene Lynott-Tochter) plädiert hätte.
Zur vorletzten Jahrzehnt-Wende war dann die Luft raus. Ein Abschied auf Raten, der hier im direkten Vergleich zu Glanz & Gloria deutlicher markiert erscheint. Lynott verlor sich in Killer-Klischees, die ständig umbesetzte Band in leerer Metal-Pyromanie, während die gefiirchtete Twin-Guitars-Attacke zusehends stumpfer wurde. Und dem freundlich verbundenen Egomanen Gary Moore wurde mehr Auslauf gewährt, als es ratsam ist Thin Lizzy und Phil Lynott hatten ihre Zeit gehabt, danach fiel langsam der Vorhang. Irgendwann dann leider auch endgültig.