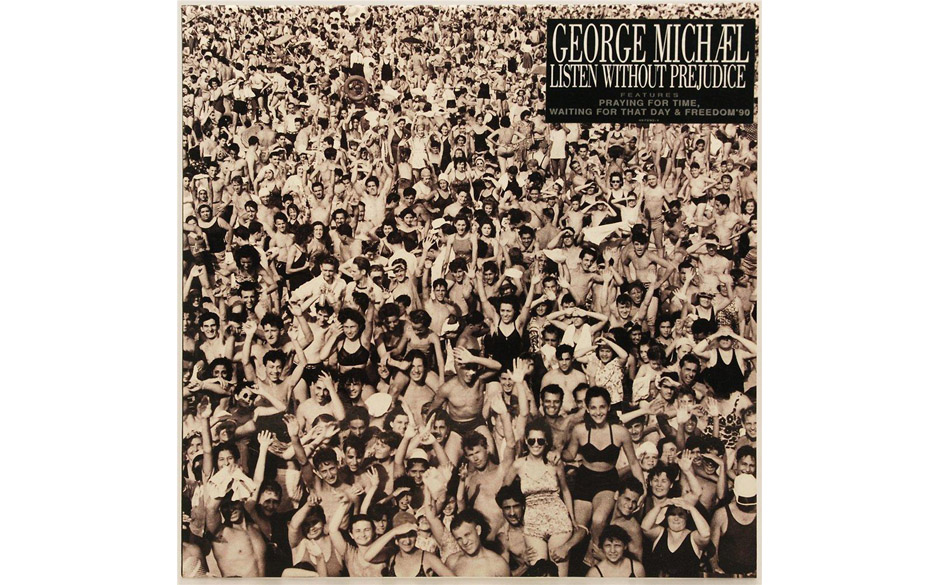Exklusives Pre-Listening: The Waterboys – „Modern Blues“
Hören Sie bei uns exklusiv und vorab die neue LP der Waterboys: "Modern Blues".

ROLLING STONE präsentiert exklusiv und vorab das neue Album der Waterboys: „Modern Blues“:
Der zweite Blues
Mike Scott über das Comeback der WATERBOYS, Auftritte in der DDR und das Schöne am Punkrock
Von Max Gösche (ROLLING STONE 01/2015)
„Die wollten mich zuerst in so ein Zimmer stecken“, murmelt er in verschwörerischem Flüsterton, als würde die Stasi noch immer mithören. Mike Scott schaut durch ein Panoramafenster auf eine Großbaustelle in der Nähe vom Berliner Alexanderplatz, wo Kräne ächzend durch den nebeligen Wintermorgen manövrieren. Die Hotelleitung brachte ihn auf seinen Wunsch hin in einem ruhigeren Teil des Gebäudes unter. Das kalte Grau dreht seine Erinnerung jetzt um 24 Jahre zurück, genauer: zum 3. Oktober 1990. Damals landete Scott mit den Waterboys in Berlin, um tags darauf ein Konzert zu geben. Was er nicht wusste: Die Stadt befand sich gerade im kollektiven Taumel.
Es war der erste Tag der Deutschen Einheit. „Ich erinnere mich an all die Würdenträger auf der Bühne vor dem Reichstag und an die Massen, die gekommen waren. Überall auf den Straßen wurde billiger Sekt verkauft, und Anarchisten rannten mit schwarzen Flaggen herum.“ Und weiter reicht der Erinnerungsfaden: bis 1984, als die Waterboys in Ostberlin spielten. Mit „A Pagan Place“ hatten sie im Juni desselben Jahres eine der besten Platten der Achtziger aufgenommen, und Mike Scott schien der Sänger der Stunde zu sein: optisch eine Mischung aus Bob Geldof und Syd Barrett, musikalisch zwischen Van Morrisons frühen Versenkungen und springsteenschem Überschwang.
Doch der Titel „Church Not Made With Hands“ muss den DDR-Genossen für popkulturelle Umtriebe unverdächtig gewesen sein: Die Auftrittserlaubnis wurde prompt erteilt. Ausflüge in die eigene Vergangenheit unternimmt Scott oft und ohne Bitterkeit. Er hat es immerhin zu einer, wie man so sagt, respektablen Karriere gebracht. Wäre da nicht der fahle Beigeschmack des Wortes „respektabel“, bei dem man immer auch denkt: Verkanntes Genie. Oder: Hat nie den Ruhm geerntet, der ihm gebührt. Und bei all dem Erfolg, den Scott durchaus hatte: Hätten nicht „Church Not Made With Hands“ und „The Whole Of The Moon“ die Welthits werden müssen, die „With Or Without You“ und „Don’t You (Forget About Me)“ geworden sind? Kein Anzeichen von Zustimmung. „Ich gönne jedem seinen Erfolg“, sagt Scott reserviert. Der passionierte Hut- und neuerdings Brillenträger ist nicht gerade berühmt für weitschweifige Antworten.
Mittlerweile hat er sich auf einer Couch niedergelassen, neben sich eine bunte Tasche, auf die ein kleiner britischer Pkw gedruckt ist. Manchmal mustert er einen mit süffisantem Grinsen, als wüsste er schon genau, worauf man hinauswill, hätte jedoch keine Lust, weiter darüber nachzudenken. Dann wieder kramt er ein Pfefferminzbonbon hervor und zerknuspert es genüsslich unter dem Vorwand, nachdenken zu müssen. Zerknuspert die Stille. Zerknuspert die Frage.
Ziemlich zerknuspert klingt denn auch das neue Waterboys-Werk, „Modern Blues“, das ein bisschen unentschlossen zwischen Bluesrock, Soul und Folk-Balladen schwankt. Aufgenommen wurde es in Nashville. „Ich habe so viele Alben in Großbritannien und Irland gemacht, ich wollte diesmal etwas anderes probieren“, erklärt Scott. „Und da ich ohnehin viel Zeit in meinem Apartment in New York verbringe und in den vergangenen Jahren viel in den USA auf Tour war, wollte ich eine rein amerikanische Platte machen.“ Um dem Projekt die nötige Glaubwürdigkeit zu verleihen, verpflichtete er den aus Memphis stammenden Keyboarder Paul Brown und Session-Bassist David Hood, der früher der legendären Crew des Muscle Shoals Sound Studios angehörte und für Aretha Franklin spielte. Doch warum ausgerechnet Nashville? „Weil diese Stadt praktisch auf Musik gebaut ist. Das Business ist dort noch intakt, während andere Städte den Niedergang ihrer Studios mit ansehen mussten.“ Na ja, und die Kosten seien eben nicht so hoch wie in New York oder London, schiebt er mit einem Augenzwinkern hinterher.
„Modern Blues“ wurde in den Sound Emporium Studios eingespielt, wo schon Willie Nelson und Al Green Alben aufgenommen haben und R.E.M.s „Document“ entstand. Elvis hat zwar nicht dort gewirkt, erfährt aber auf „Modern Blues“ eine späte Würdigung. Einer von Scotts Freunden erzählte einen Witz über den Tod, darüber, dass er im Licht am Ende des Tunnels Elvis Presley vermute. Daraus wurde der Song„I Can See Elvis“, eine humorvolle Verbeugung vor einigen von Scotts Idolen. Neben Elvis werden unter anderem Charlie Parker, John Lennon und Marvin Gaye genannt. Wobei man bei Scott vorsichtig sein sollte, wenn man von Idolen spricht. „Niemand von diesen Leuten zählt zu meinen Helden oder Idolen. Elvis hat viel für die sexuelle Befreiung getan und dazu beigetragen, dass weiße und schwarze Musik zusammenfinden. Andererseits war er ein rassistischer, sexistischer Redneck.“
Also keine Idole? Nicht mal Patti Smith, für die er einst „A Girl Called Johnny“ schrieb? Oder Bob Dylan, den er als „great lyricist“ verehrt und dessen „Girl From The North Country“ er coverte? Scott wischt diesen letzten kläglichen Versuch, ihn auf einen Einfluss festzunageln, mit verächtlichem Schnauben vom Tisch. „Ein Held ist für mich der Dalai Lama, weil er Gewalt mit Frieden begegnet.“ Puh, das sitzt. Aber dann versucht er sich doch noch an einer Erklärung, woher seine Einstellung zu Vorbildern rührt, die man nicht mit Arroganz oder Selbstverliebtheit verwechseln darf: „Ich wuchs mit Punkrock auf. Da waren die Musiker auf einer Ebene mit den Fans. Die Leute sollen mich nicht als Idol anhimmeln, sondern mich als Künstler sehen. Denn das ist mein Job.“
Wie viele Songschreiber seiner Generation erlebte der 1958 im schottischen Edinburgh geborene Michael Scott seine popmusikalische Initiation, als er die Beatles mit „All You Need Is Love“ im TV sah. „Ich wuchs in den Sechzigern auf. Damals wurden viele Türen aufgestoßen. Menschen öffneten ihr Bewusstsein in viele Richtungen“, erklärt Scott. Dann kamen die Siebziger, die einige von diesen Türen wieder verschlossen, aber immerhin noch Punk für die nächste Generation bereithielten. Mit 19 schrieb Scott sich an der Uni von Edinburgh in Philosophie und Literatur ein, studierte aber nach eigener Aussage so gut wie gar nicht, sondern nutzte seine einjährige Abwesenheit vom Campus, um ein Punk-Fanzine zu betreiben und an eigenen Songs zu basteln.
Mit Another Pretty Face tauchte er erstmals auf dem Radar der britischen Musikpresse auf, bevor er 1981 die Waterboys gründete. Den Namen hatte er in Lou Reeds „The Kids“ aufgeschnappt. Als Songwriter und Sänger schien Scott von Anfang an derjenige zu sein, der das lose Gebilde namens Waterboys zusammenhielt. So stieg etwa Keyboarder Karl Wallinger nach „This Is The Sea“ aus, um es mit seiner eigenen Band, World Party, zu versuchen. Andere folgten Wallingers Beispiel – mit unterschiedlichem Erfolg. Kein Wunder, dass Scott heute behauptet, die permanente Band-Rotation sei das Konzept der Waterboys gewesen. Er begreife gerade das als großes Glück, weil es ihm niemals versiegenden Input garantiere.
Im Rückblick wirkt die „Big Music“-Trilogie, bestehend aus den ersten drei Waterboys-Alben, wie ein fremdartiger Monolith in der Pop-Landschaft der 80er-Jahre. Diese mächtigen Hymnen, getrieben von einer Armada aus Akustikgitarren und jubilierenden Fanfaren! Dass er das nicht adäquat auf die Bühne bringen konnte, frustrierte Scott so sehr, dass er sich drei Jahre lang zurückzog, um nach einem dynamischeren, spirituelleren Sound zu suchen.
Das Album „Fisherman’s Blues“ sollte 1988 ein Befreiungsschlag werden, ein Rausch aus Country, irischer Folklore, Soul, Gospel, Traditionals und Cover-Stücken, angefeuert von Mandoline, Saxofon und Steve Wickhams Fiddle. Doch die Plattenfirma ließ nur die Veröffentlichung einer fragwürdigen Auswahl zu. Erst 2013 erschien ein Box-Set mit über 120 Songs, die Scott damals mit zahllosen Musikern aufnahm. Es sind die unfasslichsten, sehnsüchtigsten Serenaden, die man seit Springsteens „The Promise“ gehört hat. Und auch wenn es an Majestätsbeleidigung grenzt: Dagegen klingen Dylans komplette „Basement Tapes“ wie Rudis Reste Rampe.
Mit einem Album wie „Fisherman’s Blues“ wäre Scott heute der König unter all den hippen Indie-Folkies, die glauben, ihre kreative Potenz steige proportional zum Gesichtsbewuchs. „Folkmusik bewegt sich nun mal in Zyklen“, erklärt Scott etwas allgemein. „Sie kommt und geht.“ Nur scheinen sich seine Zyklen konträr zu anderen Folk-Strömungen zu bewegen. Als Ende der Neunziger die sogenannte handgemachte Musik wieder Konjunktur hatte, verlegte Scott sich sowohl solo als auch mit den Waterboys auf muskulösere Rock-Töne. Erst 2011 gelang ihm mit „An Appointment With Mr Yeats“ noch einmal ein großer Wurf, der wiederum vom ingeniösen Geigenspiel seines treuen Freundes Steve Wickham – der vielleicht einzigen, auf jeden Fall aber wichtigsten Konstante im Line-up der Waterboys – beseelt ist. „Zwischen uns gibt es eine Art von Verbindung, etwas Unzerstörbares, das ich in meinem Leben sehr selten gefunden habe“, sagt Scott über den Mann, dem auch auf „Modern Blues“ wieder ein paar berückende Momente gehören.
Ein minimaler Zusammenhalt ist also selbst bei den Waterboys vonnöten. „Ich hasste es, in den Neunzigern als The Mike Scott Band auf Tour zu gehen. Ich vermisste die Waterboys, und ich vermisste das Waterboys-Publikum, das definitiv größer war.“ Und jedes Mal wenn ihm der Bandname über die Lippen kommt, scheinen ihm wieder die Zeilen aus dem Lou-Reed-Song zuzufliegen: „And I am the Water Boy/ The real game’s not over here/ But my heart is overflowing anyway.“