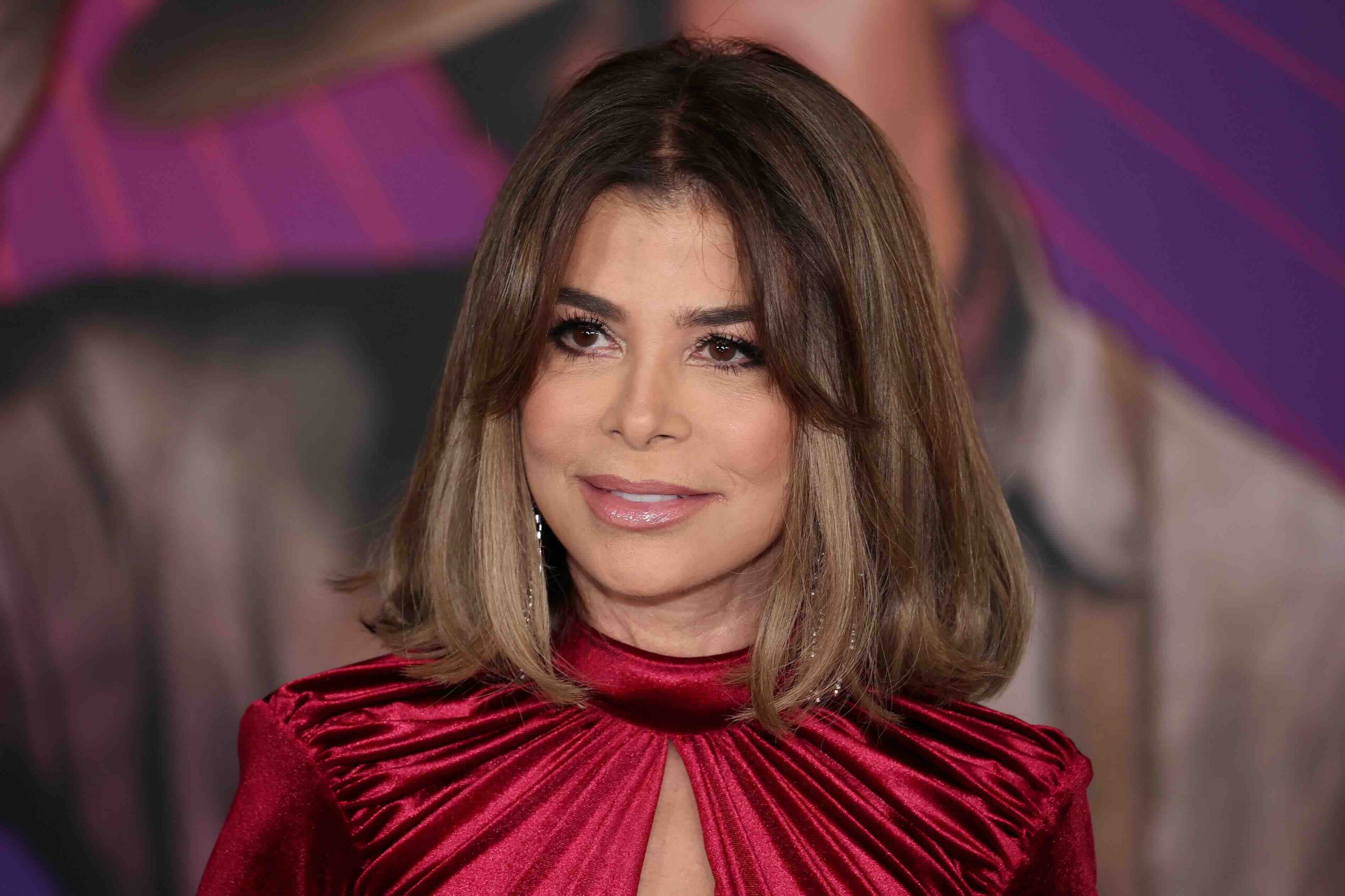Filmstart der Woche: „Mr. Nobody“
Jared Leto und Sarah Polley in einem tragikkomischen, furios montierten Melodram über die Schicksalhaftigkeit des Lebens. Regie führte der Belgier Jaco van Dormael. Hier gibt es die Kritik von Oliver Hüttmann samt Trailer.
Er habe keine Angst vor dem Sterben, krächzt der Greis. Er heiße Nemo Nobody, werde aber auch Mr. C.R.A.F.T. genannt: „Can’t remember a fucking thing.“ Dabei schlägt seine zittrige Stimme in ein glucksendes Lachen um. In wenigen Stunden, am 9. Februar 2093, wird er 118 Jahre alt. Er ist der letzte Sterbliche in einer Welt, in der die Menschen sich durch Zellteilung erneuern. Der Fortpflanzungstrieb ist dadurch überflüssig geworden. „Damals“, so viel ringt er seiner Demenz dann doch noch ab, „vögelten wir ständig.“ Woran soll man sich auch sonst erinnern.
Geburt, Sex und Tod – das sind die Prämissen, anhand derer der belgische Regisseur Jaco van Dormael ein vor kühnen Volten strotzendes, tragikomisches, visuell berauschendes Melodram über das Glück, die vielen Zufälle und den Sinn des Lebens erzählt. Bestimmt die Liebe unser Handeln? Was wäre, hätte man sich in einer Sekunde anders entschieden? Sind wir Herr unseres Schicksals? Und wenn nicht, was lässt uns so werden, wie wir sind? Eine präzise Antwort darf man natürlich nicht erwarten, aber einen Parforceritt durch Philosophie, Wissenschaft und Kitsch, der die ganzen Wirren des menschlichen Daseins vorführt.
Der alte Nemo diktiert schließlich einem jungen Reporter seine Erinnerungen. Wobei hier der märchenhafte Umstand, dass Babys sich ihre Eltern aussuchen können, die unwiderruflichen Momente des Lebens ironisch vorwegnimmt. „Wir können nicht zurück. Das macht die Wahl so schwer“, sagt Nemo – eine Erkenntnis, die bis zum letzten Atemzug gilt und van Dormaels Versuchsanordnung erst ermöglicht. So steht Nemo als kleiner Junge bei der Trennung seiner Eltern am Scheideweg. Ob er mit der Mutter in die Großstadt zieht oder in der Provinz beim Vater bleibt, hat so oder so einschneidende Konsequenzen, denen er sich zu diesem Zeitpunkt gar nicht bewusst sein kann. Und die nicht nur ihn betreffen.
Denn von da an stehen Anna, Elise und Jeanne, die den Bub bereits vorher interessierten, für drei mögliche Lebensentwürfe. Liebeskummer oder Familie, zwei oder drei Kinder, Ehekrise oder Happy-End, Reichtum, Krankheit, Unglücksfälle: In brillant montierten, sehr komplexen Rückblenden dekliniert van Dormael durch, wie der freie Wille den Umständen unterworfen ist, wie wir vom Schmetterlingseffekt beeinflusst werden und jede Existenz seit dem Urknall von Raum und Zeit abhängt. Und alles, ohne sich zu verheddern.
Das faszinierende Mosaik aus Bildern, Schnitten, Wendungen und Informationen ist verspielt und witzig wie die Filme von Jean-Pierre Jeunet, manchmal jedoch auch arg sentimental. Dennoch ist es eher ein intellektuelles als ein emotionales Erlebnis. Welche Version die richtige sei, fragt der Reporter am Ende, und Nemo antwortet: „Jedes Leben, jeder Weg. Es hätte auch anders kommen können.“ Wer aber aufpasst, wird Fragmente entdecken, die auf das richtige in den vielen falschen Leben hinweisen.
![]() Oliver Hüttmann
Oliver Hüttmann