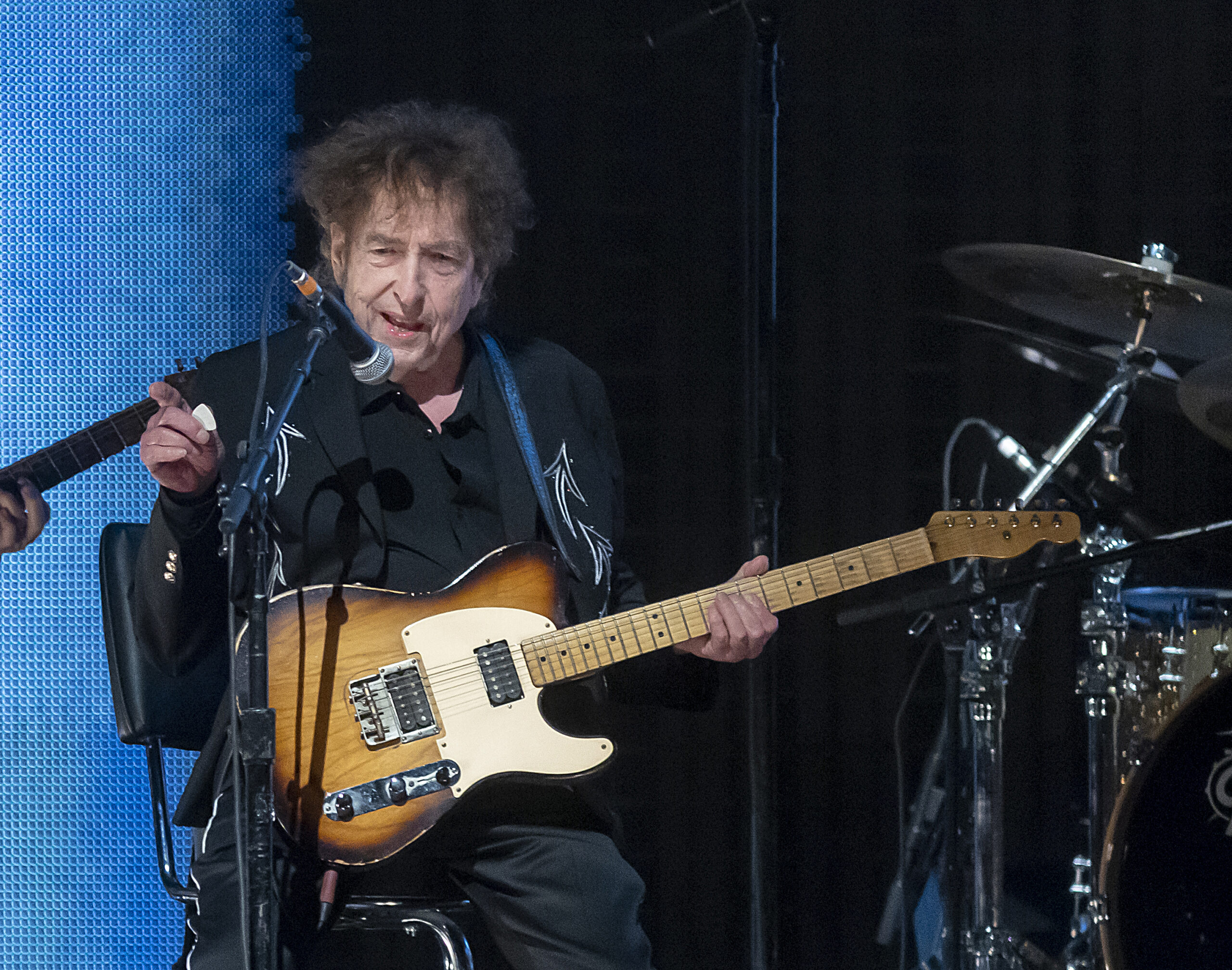R.E.M.
„Up“
Warner
Es gilt als das Album, mit dem alles schlechter wurde. Dabei vereint „Up“ die letzte große Songsammlung von R.E.M.
Populärer als das Album selbst ist der Vergleich mit dem Tier: Die Band sei nach dem Weggang des Drummers Bill Berry wie ein dreibeiniger Hund, sagte Sänger Michael Stipe damals. Kunstpause. Aber auch ein dreibeiniger Hund, schob Stipe hinterher, könne noch laufen.
Vielleicht liegt es an dieser etwas missglückten Eigen-PR, dass viele Fans dachten, die Band fange an zu humpeln. „Up“ wurde der erste Misserfolg von R.E.M.
Das Songmaterial? Absolut erstklassig. Ob Stipe, Peter Buck und Mike Mills selbst im Studio noch komponiert hatten? Die Aufnahmen sollen höchst konfrontativ verlaufen sein, der Stress ist den Liedern jedoch nicht anzuhören – Stipe hatte sich durchgesetzt und mit dem Hidden Track „I’m Not Over You“ ein persönlich auf der Gitarre eingespieltes Stück vorgestellt, das so friedlich klang wie selten etwas zuvor. Kam bei den Kollegen aber nur mittelmäßig an. Bucks Kommentar damals: „Bei diesem einen Song an der Gitarre bleibt es dann aber auch.“
Und dann kam die Platte, am 26. Oktober 1998, endlich in die Läden. Täuschte die Band mit der vorab veröffentlichten, wunderschönen Single „Daysleeper“ den klassischen R.E.M.-Folk-Modus vor, gingen viele der 14 Tracks in ganz unerwartete Richtungen.
AmazonEs ist eine – mehr oder weniger bittere – Ironie der Bandgeschichte, dass mit gerade dieser Personalnot am Schlagwerk ihr rhythmisch flexibelstes Werk überhaupt entstand. „Up“ vereint Instrumente an Stellen, die für die 1980 gegründete Band äußerst ungewohnt waren: Die Leonard-Cohen-Hommage „Hope“ lief über einen Drumcomputer, „Airportman“ klang nach Bontempi im Calypso-Modus, „Suspicion“ konfrontierte die Maschine mit einem echten Schlagzeug; der zeitgeistige Song erinnerte mit seinem Vibraphon an die Lounge-Ära der Sechziger, die Ende der Neunziger ein Revival feierte. Manchmal, wie in „Why Not Smile“, hört man vor allem nur viele Rasseln.
Wie aus der Maschinenhalle

„Why Not Smile“ und das bezaubernde „At My Most Beautiful“ (immer noch ihr schönster Vers: „I count your eyelashes secretly / With every one, whisper I love you. / I let you sleep./ I know you’re closed eye watching me, Listening. / I thought I saw a smile)“ unterstreichen vor allem Gitarrist Peter Bucks Liebe zu den Beach Boys. Sind die Hörner in „ …Beautiful“ noch klassisches Brian-Wilson-Arrangement, ist Bucks Schreddern am Ende von „Smile“ die bis heute immer noch perfekte Variation: schön, aber angekratzt, betörend und zugleich schrill, ein Liebeslied, gesungen wie aus einer Maschinenhalle.
„Up“ war also einerseits Hommage an die Sechziger, andererseits auch Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Michael Stipe und der damals aufstrebende Thom Yorke der „OK Computer“-Ära konnten nicht genug voneinander bekommen, man lobte sich in einem fort. So folgte auf „Airbag“ von Radiohead sogleich „Airportman“ von R.E.M., und darauf wiederum, im Jahr 2000, „Everything In It’s Right Place“ von Radiohead.
Viele Käufer hatten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von „Up“ genug von R.E.M. Die Band war außerstande, den Erfolg von „Automatic For The People“ (1992) mit den darauf folgenden Alben zu wiederholen. Das fuzzrockige „Monster2 (1994) mochte man trotz seiner fast durchweg miserablen Lieder, weil es ja die Band im Psychedelic-Look zeigte, Stipe seit langer Zeit wieder die Mütze abnahm und darunter besser aussah denn je, und alles so ganz anders klang als die Kammermusik von „Automatic“. „New Adventures in Hi-Fi“ (1996) ließ man durchgehen, weil es – trotz launischer Kompositionen – mutige Singles präsentierte und mit überdurchschnittlichen Songlängen und grobkörnigen Landschaftsaufnahmen das Prädikat „Amerika-Epos“ vor sich her trug.
Mutig waren R.E.M. nach dem Misserfolg von „Up“ nicht mehr. Ihre auffallendsten Lieder waren ab dann entweder kurze Punkrock-Singles á la „Supernatural Superserious“ oder Balladen, für die Stipe zunehmend seine Samtstimme in den Vordergrund mischen ließ – auf einem Stück wie „I’ve Been High“ fragt man sich, ob da nun er singt oder Chris De Burgh.
Sechs Jahre Pause zwischen zwei Alben warn in den 1990er-Jahren ungewöhnlich, heute sind sie es bei Bands dieser Größe nicht mehr. Wäre „Up“ also als erste Platte seit 1992 erschienen – vielleicht hätte sie heute einen besseren Ruf.