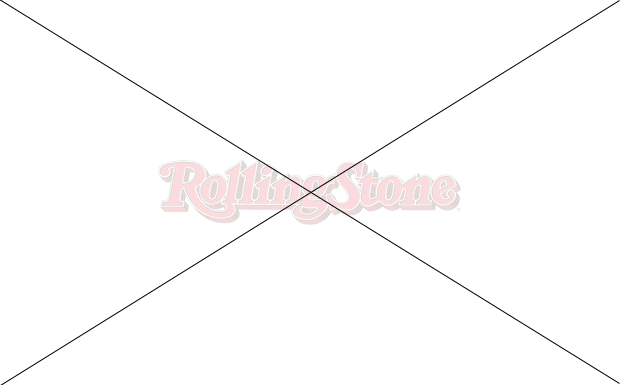Wie viel Surf in den Beach Boys steckt
Die Beach Boys feiern mit Tour und Album ihr 50. Jubiläum - Anfang August sind sie in Deutschland. Ein guter Anlass für uns, die großen Fragen zu klären, was verschiedene Autoren in unserer aktuellen Ausgabe getan haben. Wir werden die zehn Texte bis zu ihrem Tourstopp bei uns auch auf rollingstone.de veröffentlichen.
Wie intoniert man den blauen Pazifik im Gegenlicht? Welche Musik beschreibt ein dynamisches Dahingleiten durch Schaumkronen? Wie klingt das Gefühl, auf Wellen zu reiten? Mit solch poetischen Fragen beschäftigte sich Anfang der 60er-Jahre die Szene an der südkalifornischen Westcoast. Regionale Bands wie die Surfaris, Surftones oder Chantays übersetzten das Strandleben in perlende Instrumental-Songs, die wiederum Gitarrist Dick Dale mit seinem hoppelnden Hochgeschwindigkeits-Sound auf die Spitze trieb. Ein Underground-Phänomen, das gerade dabei war, seine Unschuld zu verlieren. Denn parallel zu den musikalischen Ansätzen hatte auch Hollywood mit dem Billig-Genre „beach movies“ den Spaß am Surfen entdeckt. Die schnell produzierte „Gidget“-Reihe machte bereits 1959 den Anfang, später setzten tolldreiste Filmchen à la „How To Stuff A Wild Bikini“ oder „The Beach Girls and the Monster“ auf Oberweiten, Romanzen und Badehandtuch-Gefummel. „Beach Party“ (1963) mit den wohlgeformten Teenie-Sternchen Annette Funicello und Frankie Avalon traf den Nerv des Mainstream-Publikums. Aus der Subkultur wurde ein Malibu-Ballermann. „Die Plots, die Hollywood in die frühen ,Surfer-Filme‘ einpflanzte, waren unfassbar flach“, konstatiert Leonard Lueras in seinem Standardwerk „Surfing, The Ultimate Pleasure“.
Die Wilson-Brüder, von denen eigentlich nur der schöne Dennis echte Strandqualitäten mitbrachte, begannen genau an der Schnittstelle zwischen Underground und Ausverkauf. Unbeirrt davon, dass Carl für den Körperkult von Los Angeles zu pummelig und Brian ein regelrechter Anti-Surfer war, setzten sie seit den Garagenaufnahmen zur ersten Single „Surfin’“ darauf, dieser speziellen Welt ihre eigene Aura zu verpassen. Und als Brian Wilson und Mike Love im Frühsommer 1963 die euphorische Zeile „Catch a Wave – and you are sitting on top of the world“ dichteten, war die Marschrichtung längst klar: luftige Soundschichten, überwölbt vom mehrschichtigen Harmoniegesang, der besonders in melancholisch-getragenen Songs wie „Surfer Girl“ oder „In My Room“ zur Perfektion geraten war. Aufgemotzte Hot Rods und herzige Romanzen machten den kalifornischen Kosmos komplett. Das lichtdurchflutete Surf-Image wurde bei dieser Kultivierung jedenfalls nie angekratzt. Das Dunkle und Aggressive, das in späteren Jahrzehnten bei den betonrampensurfenden Enkeln aus der Skaterszene oder auch in Katherine Bigelows Film „Point Break/ Gefährliche Brandung“ (1991) auftauchte, war ihre Sache nicht. Die Abwendung der Beach Boys vom Strand fiel zusammen mit dem Abklingen der Surfwelle seit Sommer 1965. Nicht nur musikalisch folgte eine Zeitenwende. Die mittelständische und rein weiße Spaßkultur Südkaliforniens sah im Zuge der Unruhen von Watts und der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den Südstaaten plötzlich schrecklich naiv aus. Und als für Dennis Wilson mit Charles Manson die böse Seite von Los Angeles ins Spiel kam, verstaubten ihre Surfbretter längst in der Asservatenkammer. Die Sonne war vom Himmel gefallen.
The Beach Boys live: „Celebration – The Beach Boys‘ 50“
03.08. Berlin, o2 World
04.08. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
05.08. Mönchengladbach, HockeyPark
–
In unserer aktuellen Ausgabe können Sie bereits alle zehn Texte inklusive eines aktuellen Interviews mit Mike Love lesen.
Das könnte Sie auch interessieren: