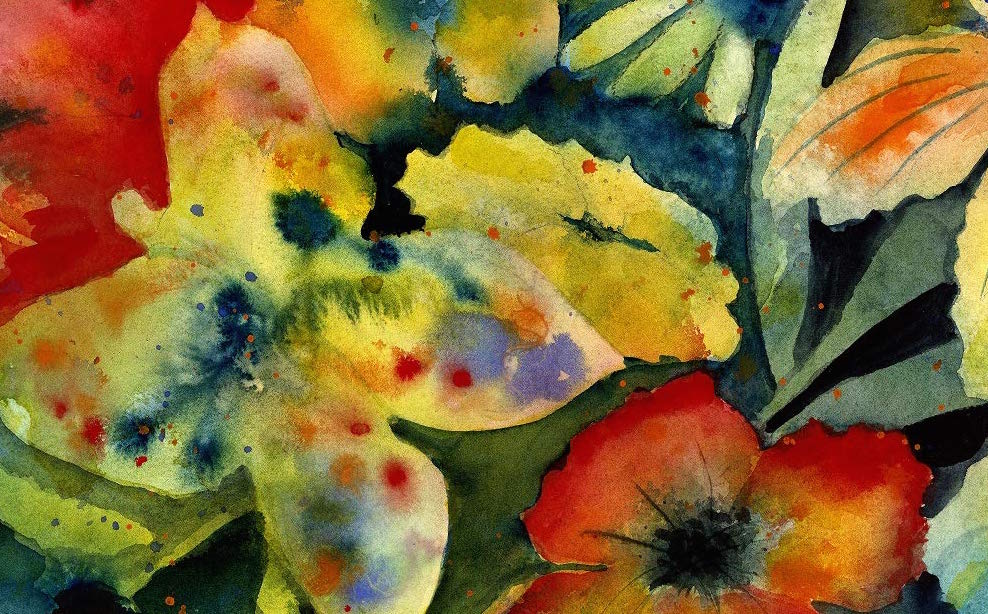Mythos der Frühvollendung
Mit ihrem dritten Album beweist Laura Marling erstaunliche Reife. Doch die noch so junge Songschreiberin trägt eine Maske zur Schau, die zugleich ihre Stärke und ihre Schwäche ist.
Sie wirkt älter, als sie ist. Oder vielleicht verstellt sie sich auch nur. Laura Marling ist gerade mal 21 Jahre alt, doch ihre Musik wirft bereits Köder in seelische Tiefen, in denen sonst nur Folk-Greise und Country-Käuze fischen. Behutsam streicht sie ihr blondes Haar aus der Stirn, als wolle sie nun – ausnahmsweise – einen raren Museumsrundgang durch ihren extrem empfindsamen Geist gestatten. Die skeptischen, fordernden Augen durchdringen alles und jeden.
Vorsicht ist geboten: Zu genau weiß Marling, was sie will und was nicht, welches Etikett sie sich ankleben lässt und welche Image-Schublade definitiv zu klein für sie ist. Etwas Altkluges schwingt stets in ihren Äußerungen mit, zu denen sie sich – so scheint es zumindest – gerade mit allergrößter Not aufraffen kann. Wäre sie Mitte 50, würde man sie als „saturiert“ bezeichnen. Doch so umweht sie der Mythos der Frühvollendeten.
Nur manchmal bekommt ihre erwachsene Oberfläche Risse, wenn sie begeistert über Platten spricht und dabei ein wiederholtes „I love it, love it!“ ausstößt. Oder wenn sie einem die Romane des kanadischen Schriftstellers Robertson Davies ans Herz legt, die sie während der Aufnahmen am neuen Album „A Creature I Don’t Know“ regelrecht verschlungen habe. „Seine Bücher sind bizarre, dunkle und lustige Schilderungen von akademischen Exzentrikern.“ Das Versponnene, Mystische schätzt Marling, dagegen reagiert sie auf Fragen nach dem Tagesgeschehen in ihrer Heimat mit pubertärer Trotzigkeit. „Ich empfinde mich in keiner Weise als politische Songwriterin. Ich bin stolz darauf, für nichts zu stehen“, sagt sie fast zornig.
Mehr Gefühlsregung geht allerdings wirklich nicht. Schließlich schickt sich Marling an, zur Grande Dame der new English folk scene aufzusteigen. Ihr Eifer und Fleiß wirken auf viele vielleicht streberhaft, dagegen steht die Lässigkeit, die Souveränität, mit der sie in der Öffentlichkeit auftritt. So ist denn auch ihr drittes Studioalbum „A Creature I Don’t Know“ ein Zeugnis von außerordentlicher Reife. Die Kreatur, das unbekannte Wesen, ist natürlich Marling selbst, die – mehr noch als auf dem vielversprechenden Debüt „Alas, I Cannot Swim“ und dem nicht minder gelungenen Nachfolger „I Speak Because I Can“ – von gescheiterten Beziehungen erzählt und die trügerischen Wonnen der Zweisamkeit in verstörend schöne Melodien taucht.
Obwohl Marling selten Fragen zu ihrem Privatleben beantwortet und die Klatschpresse naturgemäß verabscheut, ist „A Creature I Don’t Know“ geradezu offenherzig geraten, meint man in Stücken wie „Don’t Ask Me Why“ in Marlings Innerstes schauen zu können – eine Vorstellung, die auch mit ihrer blassen, fast durchsichtigen Haut zu tun haben könnte. Angst, dass sie zu viel von sich preisgeben könnte, kennt sie nicht: „Dieses Album hat eine charakteristische Erzählweise, aber ich wäre verwundert, wenn jedermann nur meine Person dahinter vermutet. Sicher steckt ein großer Teil meines Bewusstseins oder vielmehr meines Selbstbewusstseins in den Liedern.“ Die Grenze zwischen Kunst und Künstler sei eben fließend. „Ich würde nicht über Herzensangelegenheiten schreiben, wenn ich mich nicht in der Lage fühlen würde, über diese Themen zu singen.“ Und: „Selbst wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich immer noch eine Privatperson.“ Das mögen Gemeinplätze sein, aber wenn Marling sie so monoton und mollbelegt ausspricht, gewinnen sie ungeahnte Bedeutungsschwere.
Ähnlich klingen die neuen Songs: klassizistisch, erhaben und merkwürdig vertraut. Eine in schillernden Facetten nachempfundene Kathedrale, in der Joni Mitchell, Bert Jansch und Leonard Cohen gemeinsam Andacht halten. Die Ahnengalerie derer, die auf „A Creature I Don’t Know“ eine Würdigung finden, ist lang. Vieles erinnert an Mitchells „Ladies Of The Canyon“ oder „For The Roses“. Ein paar jazzige Elemente hat Marling auch von „Court And Spark“ geliehen, das eines ihrer absoluten Lieblingsalben ist. Auch Dylan kann nicht weit sein, wo Ethan Johns Hand anlegt, der laut Marling geradezu „obsessiv Dylan und die Beatles verehrt“ und als Produzent schon einige Meriten hat: Ryan Adams, Rufus Wainwright und Kings Of Leon haben bereits seine Dienste in Anspruch genommen. Seit „I Speak Because I Can“ zählt nun auch Marling zu seinen Kunden. Zwar geht ein Stück wie das Leonard-Cohen-hafte „Night After Night“ auf Marlings Konto, andererseits wird erst durch Ethans Produktion daraus eine Verbeugung vor dem Original, ohne dass das Ergebnis antiquiert wirkt. „Night after night you watch my body weaken/ My mind drifts away“, singt sie darin.
Elf solcher aufwühlenden Songs hat Marling für „A Creature I Don’t Know“ geschrieben. Harter Tobak für eine junge Frau, deren Gemüt sich in keinem guten Zustand befinden kann – oder? Müde reckt Marling die Schultern hoch: „Es ist einfacher für mich, einen traurigen Song zu schreiben. Fröhlichkeit musikalisch zum Ausdruck zu bringen fällt mir schwer. So gesehen sprechen meine Lieder wohl dafür, dass ich oft niederschlagen bin. Aber das ist natürlich nur eine Seite von mir.“ In andere gewährt sie allerdings keine Einblicke.
Wenig genug ist über Laura Marling bekannt: Am ersten Januar 1990 wird sie im südenglischen Küstenkaff Eversley geboren. Ihr Vater betreibt ein eigenes kleines Aufnahmestudio, macht seine Tochter mit der Musik von Neil Young bekannt und bringt ihr das Instrument nahe, das Marlings musikalische Laufbahn früh entscheidet: Auf ihrer akustischen Gitarre studiert sie fleißig Coverversionen ein, bevor sie sich mit 14 erstmals an eigenen Songs versucht, die sie heute als „furchtbar schlecht“ abtut.
2006 stößt sie in London zu einer Clique junger Musiker namens Noah And The Whale, deren Stil von der Presse schnell als, ,Indie-Folk“ identifiziert wird. Heute sträubt sich Marling gegen diese Einordnung: „Ich finde gar nicht, dass unsere Songs besonders nach Folkmusik klingen. Was Songwriting, Storytelling und Instrumentierung betrifft, ist Folk doch eine sehr klassisch geprägte Stilrichtung, mit der uns eigentlich nicht viel verbindet. Trotzdem habe ich mich mit dem Begriff abgefunden, weil mich viele Leute in diesem Genre verorten.“ Tatsächlich bedienen sich Noah And The Whale vorwiegend bei Pop und Bluegrass.
Marling verliebt sich in den Ukulelespieler Charlie Fink, mit dem sie zwischenzeitlich liiert ist. In der Erinnerung stellt sie leicht melancholisch fest, dass diese Phase vermutlich die schönste Zeit ihres Lebens gewesen sei – und das vor ihrem eigentlichen Durchbruch. „Viele Leute haben verfolgt, wie das alles angefangen hat, wie ich mit Freunden begonnen habe und wie wir uns alle entwickelt haben. Ich meine, was konnte mir als 16-Jähriger Besseres passieren, als die Schule zu verlassen, nach London zu ziehen und mit einer Band auf Tour zu gehen?“, fragt sie melancholisch. Viel hat sich seit 2006 geändert. „Jetzt sehen wir uns alle nur noch selten, weil wir alle so beschäftigt sind. Jammerschade! Aber die Gemeinschaft existiert weiter in unserer Musik.“
Mit ihrer Solokarriere hat es Marling zur gro-ßen Songwriterin gebracht. Dennoch tritt sie in der Öffentlichkeit, bei Interviews und TV-Auftritten, verschüchtert und in sich gekehrt auf. Ein bisschen muss man immer an eine Zeile aus dem Wilco-Song „Heavy Metal Drummer“ denken: „I miss the innocence I’ve known.“
Spätestens nach dem Gewinn eines Brit Awards 2011 als beste Solokünstlerin müsste das Selbstbewusstsein groß genug sein. Auch wenn sie ihren Erfolg gern ein bisschen herunterspielt. „Bei diesen Dingen ist es einfacher zu sagen, was es meinen Eltern bedeutet. Es war toll zu sehen, wie sehr sich meine Mutter gefreut hat. Für mich kam die Auszeichnung eher als Schock, weil ich absolut nicht damit gerechnet hatte.“
Und als wolle Marling die auf ihr lastenden Erwartungen möglichst zeitnah erfüllen, kommt nun das neue Album, nur wenige Monate nach dem Award. „Aber nein“, versichert sie, „das hat damit rein gar nichts zu tun.“ Zu viel Erwartungsdruck sei kontraproduktiv. „Das Leben ist schon hart genug“, sagt sie knapp. Sie schreibe einfach sehr viele, meistens komplette Stücke, da sie alles Kleinteilige hasse, weil „bei solchen Prozessen in der Regel nur Mist rauskommt“. Fast unflätig klingt das. Dabei heißt es wohl nur, dass sie beim Schreiben in Ruhe gelassen werden will.
Längst wird Laura Marling auch von denen gefeiert, die sich für solche Subtilitäten nicht interessieren. Von sogenannten Schläfern und Gelegenheitshörern, die sich nach „handgemachter Musik“ sehnen und in einer jungen Frau wie ihr natürlich gern die neue Mutter Maria des wahren Folk sehen. So paradox es klingt: Gerade diese Erwartungshaltung – die sie natürlich zu spüren bekommt – könnte ein Grund dafür sein, dass Marling in der Öffentlichkeit lieber ihre Maske trägt. Lieber nicht authentisch sein will. Ein Zirkelschluss.
Wir sind es schließlich gewohnt, dass besonders Frauen im Pop nicht einfach nur Musik machen. Dass sie nicht bloß Gitarre spielen, singen und Lieder schreiben, sondern zur weiblichen Identifikationsfigur werden. Was bei ihren männlichen Kollegen wahlweise als kauzig oder exzentrisch gilt, wird einer Musikerin wie Laura Marling als niedlich oder dröge ausgelegt. Aus dem Teufelskreis kommt sie nicht so leicht heraus – auch dann nicht, wenn „A Creature I Don’t Know“ zu dem Erfolg werden sollte, der sich ankündigt. Songs wie diese müssten ihr endlich auch beim skeptischen Publikum Respekt verschaffen. Dass genau diese Leute dennoch wieder fragen werden, warum sie mit 21 nicht von Leid und Freud des Erwachsenwerdens singt, ist zu erwarten.
Mitte Oktober beginnt die Großbritannien-Tour.Im ersten Teil wird Laura Marling, zwischen Exeter und Birmingham, nur in Kirchen auftreten. Bleibt zu hoffen, dass die Abende keine allzu andächtigen, heiligen Veranstaltungen werden. Sonst könnte diese so schüchtern wirkende Künstlerin doch noch irgendwann aus der Haut fahren.