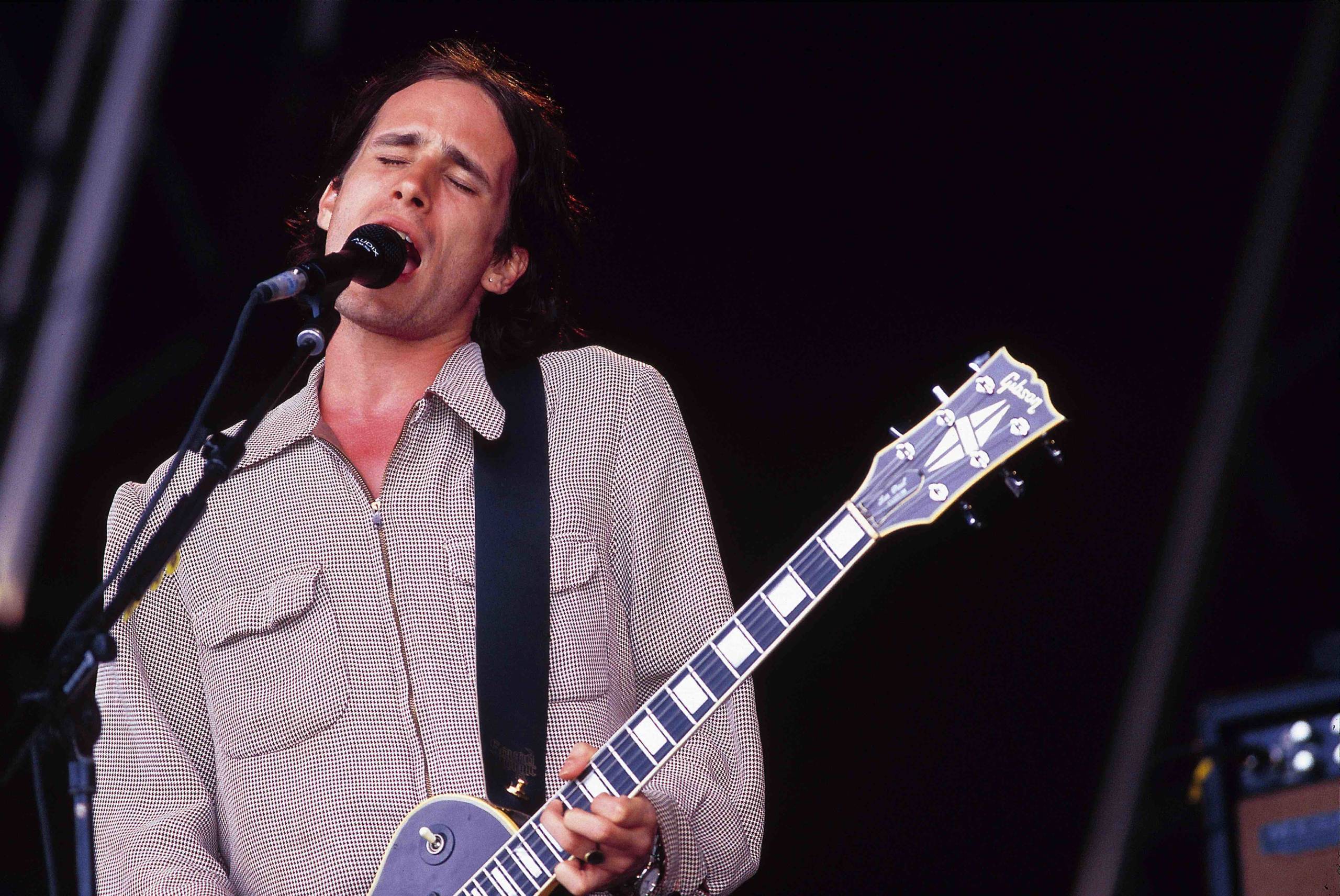Mitternachtskarneval – Das Dockville-Festival zeigt: Ein Pop-Event kann öffentliche Räume verzaubern

REIHERSTIEG-ELBDEICH, HAMBURG.
Taxifahrern, die am Anfang von Konzertkritiken oft altkluges Zeug plappern, hat unser Mann eines voraus: Er schweigt, als er den Wagen vor dem großen Tor des Hamburger Freihafens brüsk bremst. Wochenends geschlossen, verfahren. „Ist das bei der Wollkämmerei?“, fragt er ein paar Funksprüche später, und obwohl es natürlich bizarr ist, ein Festival nicht zu finden, klingt das umso besser: draußen bei der alten Wollkämmerei. Schauder! Schließlich sind wir eh schon auf der Elbinsel Wilhelmsburg, in einer der ungemütlichsten, notorischsten Areas der Stadt.
Kein Zufall, dass das neuste Hamburger Ding genau hier hergegangen ist. Dass das Dockville-Festival die Problemzone mit friedlichen Mittelstands-Kids schwemmt. Eine kleine Wiese im urbanen Niemandsland, eine Viertelstunde zu Fuß von der letzten Bushaltestelle, aber eben doch noch von allen Seiten hamburgisch umschlossen. Im Hintergrundrecken die Hafenkräne ihre Krähhälse, man kann durch ein Wäldchen runter zur Elbe laufen, einen der großen Kiesberge besteigen und auf dem Hintern runterrutschen, wie es das ganze Wochenende über die Leute tun. Rund 4000 sind da, obwohl es schnell sehr kalt wird und das musikalische Programm eher sanften Unterhaltungs- als Spektakelwert hat: Erlend 0yes The Whitest Boy Alive spielen lockenhaarigenJazz-Pop und Ersatz-Disco, das Duo To My Boy macht Radioalarm-Musik in Hochgeschwindigkeit.
Hinten überbrücken all die wahnsinnig sympathischen Verkäuferinnen die nervend langen Burger-Zubereitungszeiten, hinter dem Lichtdom des Zigarettensponsors findet man einen Stand mit sehr billigen, bestens gemixten Cocktails. „Das ist ja mehr so’n Gartenfest“, sagt einer ganz richtig, aber es fällt doch auf. wie stilsicher und nüchtern sie das arrangiert haben. „Rock am Ring“ ist geradezu ein Hippietanz dagegen. 2raumwohnungspielen noch, danach beschreibt ein Ansager, wie man im Dunkeln zu den verschiedenen Tanzflächen kommt.
Was viele Beobachter freilich auf die Palme bringt: Kunstfestival nennt sich das auch, Kulturwissenschaftler der Uni Lüneburg haben am Konzept mitgearbeitet. Daniel Richter, der eben in der Hamburger Kunsthalle einen Besucherrekord schaffte, hat selbst den kleinen Schrotthaufen und die Container an den Rand der Wiese gepflanzt und das „Elbphilharmonie“ getauft, eine Anspielung auf das städtische Prestigeprojekt. Statt T-Shirts führt der Festival-Merchandise hier echte Gemälde, beim Spazierengehen steht man plötzlich vor einem Schuppenkunstwerk, das von Spongebob-artigen Wesen bewohnt wird, vor einer Installation aus Kühlschränken und Teppichrohren, auf die eine im Automatikmodus vor sich hindudelnde Heimorgel geschnallt würde, oder, um wenigstens eine Unze Nachdenklichkeit zu schnupfen, vor einer Holzkonstruktion der Künstlerin Beate Eisfeld, die dem Inneren eines Weltkriegs-Bombenkraters am Hafen nachempfunden wurde.
Wer’s nicht haben wollte, den störte das alles nicht. Allein die Erkenntnis, dass nicht mal ein Popfestival unbedingt wie ein Campingplatz aussehen muss, dass es nicht um Survival geht, sondern darum, einen öffentlichen Ort zu schmücken und zu verwandeln, war beim Dockville unbezahlbar. Als am Samstagdie phänomenale Flensburger Punk-Mod-Band Turbostaat das Feld pflügte, stimmte auch der Rest. Tocotromc, die mit „Hallöchen Hamburg!“ auf die Bühne kamen, hatten einen unglücklichen Tag, kämpften leicht atemlos gegen den dumpfen Sound. An den Atemwolken der kleinen Publikums-Singkreise las man das Ende der Festivalsaison ab, und die Hoffnung, dass das fürs Dockville der Anfang einer langen Tradition gewesen sein sollte.