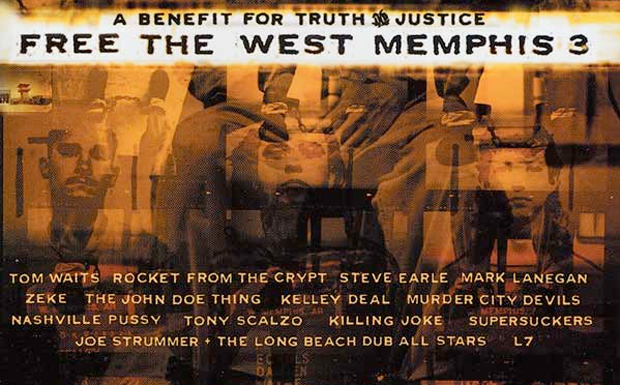Sie sind sexy, jedoch keine Schlampen. Die Dixie Chicks sind Beleg der Phrase „blondes have more fun“ – und drei talentierte Musikerinnen

Es kann nicht schaden, schon eine kleine Karriere zu haben, bevor man am großen Roulette-Tisch in Nashville Platz nimmt. Doch gerade dann gilt es, sich teuer zu verkaufen. Als die Dixie Chicks und Sony Music ihren Vertrag aushandelten, gab es genau vier Dinge, die für das Trio aus Dallas unverzichtbar waren. Fiddle-Spielerin Martie Seidel: „1. Kein neuer Name! 2. Niemals nur zehn Songs auf einer CD. 3. Wir nehmen keine Songs auf, die wir nicht aufnehmen wollen.“ Und 4.1 „Ach ja: Wir spielen selbst auf unseren Platten!“
Schriftlich wollte Sony diese Essentials – keine Selbstverständlichkeiten in Music City USA- nicht fixieren; die Firma fürchtete, einen Präzedenzfall zu schaffen. Ein Handschlag und ein paar ernste Blicke mussten reichen.
Und wenn’s schiefgegangen wäre? Seidel: „Wir dachten uns, wenn das nicht klappt, dann gehen wir einfach nicht ins Studio (lacht). Wir waren uns unserer Macht ja durchaus bewusst. Denn wir wussten: Wir brauchen die Sony nicht um jeden Preis.“
Tatsä’chlich konnten Seidel und die Banjo-/Dobro-Spezialistin Emily Robison mit wechselnder Begleitung ohne dayjobs gut von ihrer Musik leben, seit sie 1989 auf der Straße in Dallas noch incognito debütierten. Den Namen Dixie Chicks borgten sie wenig später von Lowell Geotge, dessen Little Feat-Klassiker „Dixie Chicken“ gerade im Radio lief. Frühe Fans wie Bück Owens und Emmylou Harris ermunterten sie weiterzumachen, nach den „ganz harten Gigs, wo das Geklapper des Geschirrs beim Essen lauter gar war als unsere Musik“ (Seidel). Drei angesagte Indie-LPs folgten ebenso wie Prestige-Gastspiele in der Grand Ole Opry und bei den Amtseinfuhrungs-Galas von Bill Clinton. Die Chicks repräsentierten Dallas als „Best Country Band“. Seidel: „Wir hatten unsere Nische gefunden.“
Erste Versuche indes, in Nashville Fuß zu fassen, schlugen Anfang der Neunziger fehl. „Damals“, resümiert Seidel, „war Bluegrass dort noch ein böses Wort.“ Doch auch Seidel und Robison wollten „kommerzieller“ werden, zwar die Musik, die sie von klein aufgespielt hatten, nicht gleich an den Nagel hängen, sich aber dennoch für andere Einflüsse öffnen. Vorhang auf für Natalie Maines: Denn erst die propere Tochter des Pedal-Steel-Gitarristen und Produzenten Lloyd Maines gab dem Trio ab 1995 stimmlich seine Identität – vom traumhaft stimmigen Image der drei selbstbewußten Blondinen mal ganz zu schweigen.
Heute schickt selbst Keith Richards begeistert Blumen in ihre Garderobe, sie dürfen als der einzige Country-Act auf die Hauptbühne von Lilith Fair, und ihr neues Album JFfy“ verkauft als No. 1 der US-Pop-Charts pro Woche mehr als Shania Twains LP. Seidel: „Sie nannten uns die Country-Spice Girls. Alle waren skeptisch. Der größte Kick für uns war immer der, wenn all denen, die dachten .ach, drei Blondinen!‘ die Kinnlade runterfiel, wenn wir es ihnen live gezeigt haben.“
Und so sind die Dixie Chicks doch noch der feuchte Traum auf dem Platin-vetedelten Mittelweg zwischen Musik und Marketing geworden. Sie sind zwar sexy, aber keine Schlampen. Sie gehen als Instrumental-Virtuosinnen durch und schreiben gute eigene Songs, sind aber nicht so dumm, darüber die Arbeitsvotlagen profilierter Nashville-Autoren wie Buddy Miller oder Darrell Scott zu ignorieren.
Im „Fly“-Booklet triumphieren die Dixie Chicks ab Verwandlungskünstlerinnen zwischen Latex-Vamps und Rüschen-Engeln – und sind damit dem Geheimnis ihres Erfolgs näher, als sie’s ahnen. „Uns verwirrt das ja selbst“, gesteht Martie Seidel lachend. „Die eine Hälfte der Fans sagt uns, dass sie Country sonst nicht mögen. Und die anderer Hälfte ist stolz auf uns, weil wir so traditionell klingen. Für uns fühlt sich das schon sehr traditionell an. Was kann traditioneller sein als ein Banjo-Solo in einem Song wie ,Sin Waggon‘?“ – Gute Frage. Gegenfrage: Welcher Traum harrt der Erfüllung? „Wir wollen unbedingt mal in die Sesamstraße. Auch wenn unser Manager andere Prioritäten hat.“